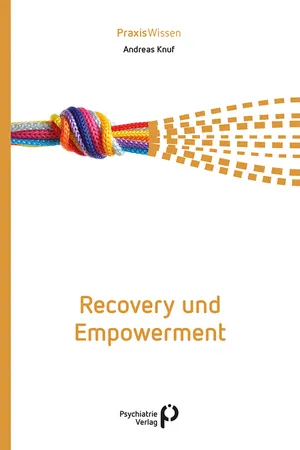
- 160 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Recovery und Empowerment
Über dieses Buch
Wie können Fachpersonen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen authentisch Hoffnung auf Genesung vermitteln und zu eigene Entscheidungen motivieren? Die Umsetzung der Konzepte »Empowerment« und »Recovery« ist dabei als Prozess zu verstehen.
Wer Klient*innen Selbstbestimmung und Selbstbefähigung ermöglichen will, muss die eigenen Handlungsweisen und Haltungen hinterfragen. So individuell jeder Gesundungsweg ist, so unterschiedlich sind auch die Anforderungen an die Profis. Bei der Bewältigung dieser Aufgabe hilft der kompakte und übersichtliche Aufbau dieser Einführung mit Fallbeispielen, Übungen und Merksätzen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Recovery und Empowerment von Andreas Knuf im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medicine & Medical Theory, Practice & Reference. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Selbstbestimmung fördern und ermöglichen
Selbstbestimmung ist in unserer Kultur ein sehr wichtiges und in seiner Bedeutung weiter zunehmendes Gut. Auch wenn dieser Trend bereits seit Langem zu beobachten ist, so hat er doch gerade in den letzten Jahrzehnten auch im Medizinbereich eine deutliche Stärkung erfahren. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass sich Menschen der westlichen Welt dann aktiver verhalten, Krisen und Krankheiten besser bewältigen und sich wohler fühlen, wenn sie über zentrale Bereiche ihres Lebens selbst entscheiden können. Immer mehr Patientinnen und Patienten wollen mitbestimmen, was die Art und Weise ihrer Behandlung betrifft. Sie wollen ihrem Arzt nicht länger die alleinige Entscheidung überlassen und haben oftmals auch das dazu nötige Vertrauen verloren. Das gilt offenbar auch für immer mehr psychiatrieerfahrene Menschen.
Lange Zeit wurde psychiatrischen Klienten wie wohl kaum einer anderen gesellschaftlichen Gruppe das Recht auf Selbstbestimmung abgesprochen. Begründet wurde dies damit, dass sie aufgrund ihrer Erkrankung nicht zu einer selbstbestimmten Entscheidung in der Lage seien. Eine Behandlungsverweigerung wurde (und wird auch heute noch) zu oft als Anzeichen für eine sogenannte Krankheitsuneinsichtigkeit (mangelnde Compliance) und eine fehlende Entscheidungsfähigkeit interpretiert. Doch auch hier vollzieht sich ein Wandel: Die Psychiatrie stellt sich, wenn auch langsam, dem zunehmenden Selbstbestimmungsbedürfnis seiner Nutzerinnen und Nutzer.
In diesem Kapitel soll es um die Voraussetzungen zur Selbstbestimmung gehen, ebenso wie um einen nutzerorientierten Umgang mit dem Selbstbestimmungsrecht psychiatrischer Klienten. Selbstverständlich gibt es Grenzen der Selbstbestimmung, wie sie nicht nur psychiatrischen Klienten, sondern allen Menschen auferlegt sind, dennoch werden vielen Psychiatrieerfahrenen bis heute sogar Selbstverständlichkeiten abgesprochen. > Psychopharmaka, Seiten 69 ff.
Selbstbestimmung ist ein Recht, aber keine Pflicht
So unterschiedlich Menschen sind, so verschieden ist auch der Grad an Mitbestimmung oder Selbstbestimmung, den sie sich wünschen. Längst nicht alle Patienten wünschen sich eine stärkere Selbstbestimmung oder fordern diese gar ein. Heute zeigt sich beispielsweise, dass viele ältere Menschen ein deutlich geringeres Bedürfnis nach Selbstbestimmung haben als die jüngeren Generationen. Das gilt ebenso für viele Menschen aus anderen Kulturen. Daran zeigt sich, dass der starke Wunsch nach Selbstbestimmung sowohl ein kulturhistorisch geprägtes als auch ein eher westliches Bedürfnis darstellt. Wie stark der Wunsch nach Selbstbestimmung ist, hängt auch davon ab, welche Erfahrungen der Betroffene bisher mit dem professionellen Hilfesystem gemacht hat. So wünschen sich etwa bei der Medikation vor allem jene Menschen einen hohen Grad an Selbstbestimmung, die bereits schlechte Erfahrungen mit Medikamenten gemacht haben oder Gewalt und Zwang im Zusammenhang mit der Medikamentengabe erlebt haben (HAMANN & KISSLING 2005).
Die meisten Klienten nehmen für sich ein gewisses Maß an Selbstbestimmung in Anspruch. Dieses auch gesetzlich abgesicherte Recht darf ihnen nicht verwehrt werden, nicht nur in krisenfreien Zeiten, sondern auch während ihrer Krankheitsphasen nicht. Für die Arbeit mit dieser Klientengruppe sind verschiedene Materialien und Verhaltensstandards entwickelt worden, etwa schriftliche Absprachemöglichkeiten. > Willensbekundungen, Seiten 57 f., 61 f.
Schwieriger wird es mit der Empowermentförderung bei jenen, die zuerst einmal keinen oder kaum einen Wunsch nach Selbstbestimmung zeigen. Worin besteht dann die Förderung? Professionell Tätige haben zunächst keine Legitimität, Selbstbestimmung zu fordern, wenn dies nicht von Klienten gewünscht wird. Aus dem Recht zur Selbstbestimmung darf keine Pflicht werden! In unserer Gesellschaft ist niemand zur Selbstbestimmung verpflichtet, auch Psychiatrieerfahrene Menschen nicht. Und doch gibt es viele Klienten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung nutzen würden, wenn bestimmte Hindernisse aus dem Weg geräumt wären. Sie haben beispielsweise Angst vor ihren eigenen Entscheidungen und den Konsequenzen, oder es fehlt ihnen das Vertrauen, dass ihre Entscheidung wirklich akzeptiert würde. Bei dieser Klientengruppe geht es darum, »ermöglichend« zu arbeiten. Ein Beispiel:
BEISPIEL
Herr Zeh lebt seit zwanzig Jahren in einem Wohnheim. Er beteiligt sich gerne am abendlichen Kochen, bringt aber nie eigene Vorschläge für Lieblingsspeisen ein. Die Mitarbeiter fragen ihn immer wieder nach seinen Wünschen und zeigen ihm ein Kochbuch, aus dem er auswählen könnte. Herr Zeh lehnt dies allerdings ab, und so entscheiden weiterhin die Mitarbeiter, was gekocht wird, bitten Herrn Zeh jedoch immer um seine Zustimmung. Nach mehreren Jahren stimmt er eines Tages dem Essensvorschlag nicht zu, sondern schlägt ein anderes Gericht vor. Auch in anderen Bereichen gestaltet Herr Zeh plötzlich sein Leben zunehmend selbstbestimmter. Etwas hat sich in ihm verändert.
Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung hängt sehr von der jeweiligen Situation ab, in der sich eine Person befindet. In einer Studie aus Berlin (TERZIOGLU 2005) wurde das Verhalten von niedergelassenen Ärzten untersucht, die von psychotisch erkrankten Betroffenen als »nutzerorientiert« eingeschätzt wurden. Diese Ärzte räumten ihren Klienten nicht das »absolute« Selbstbestimmungsrecht ein. Sie hatten vielmehr ein sehr feines Gespür dafür, wie lange ihre Klienten selbst entscheiden konnten, und achteten dann auch deren Entscheidungen. Sie waren allerdings auch sensibel dafür, wann ihre Klienten in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt waren, und übernahmen dann stellvertretend Verantwortung, stets aber nur so lange, solange es unbedingt nötig war. Die Kunst besteht also in der richtigen Balance zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge.
Fachleute können es sich nicht so einfach machen und von einer paternalistischen Beziehungsgestaltung (»Ich sage dir, was du machen sollst«) zu einer vermeintlich empowermentorientierten Haltung übergehen (»Mach, was du willst«). Diese Haltung ist eben nur vermeintlich empowermentorientiert, letztlich wird der Betroffene aber alleingelassen. Eine Balancierung ist weit schwieriger, denn der professionell Tätige muss seinen Verhaltensstil ständig daraufhin hinterfragen, ob er in der gegenwärtigen Situation angemessen ist, welchen Grad an Selbstbestimmung der Klient aktuell wünscht und ab wann Verantwortungsübernahme notwendig ist.
Selbstbestimmung will gelernt sein
Wer bisher in seinem Leben wenig selbst entscheiden durfte, der hat unter Umständen die Fähigkeit zur Selbstbestimmung gar nicht erst erworben. Oder wer lange nicht mehr selbst entscheiden durfte, hat diese Fähigkeit inzwischen vielleicht verloren. Auch Selbstbestimmung will gelernt sein. Die Fähigkeit dazu erwerben wir durch zahlreiche Lernerfahrungen, durch Versuch und Irrtum, durch Scheitern und Erfolg. Wer diese Lernmöglichkeit nicht oder zu selten hatte, der fühlt sich möglicherweise auch bei kleinsten Entscheidungen vollkommen überfordert, hat Angst vor den eigenen Entscheidungen oder hat ein nur geringes Gespür dafür, wie er sich zu seinem eigenen Wohl verhalten sollte. Werden diesem Menschen Selbstbestimmungsmöglichkeiten angeboten, dann wird er diese nicht zwangsläufig freudig ergreifen, sondern er wird sich womöglich überfordert fühlen und von Menschen seiner Umgebung erwarten, dass sie weiter für ihn die Fäden ziehen. Daher ist es nicht immer empowermentorientiert, einen Klienten auf sein Recht zur Selbstbestimmung zu verweisen. Eine Förderung von Empowerment besteht manchmal vielmehr darin, zunächst die Selbstbestimmungsfähigkeit zu unterstützen. Wenn wir das nicht tun, denken wir Empowerment vom Stärksten und nicht vom Schwächsten her.
Fachleute, die ihren Klienten über Jahre zunehmend mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten eröffnet haben, sind häufig enttäuscht darüber, dass ihre Klienten diese Möglichkeiten so wenig nutzen: »Jetzt dürfen sie selbst entscheiden, aber sie wollen gar nicht.« Diese Enttäuschung kann sogar in Ärger oder in einen Defizitblick umschlagen: »Wir wussten ja immer schon, dass unsere Klienten zu krank dazu sind.«
Auch Selbstbestimmung will gelernt sein. Selbstbestimmungsfähigkeit erwerben Menschen vor allem durch Lernerfahrungen. Dazu ist es erforderlich, dass professionell Tätige ihren Klienten das Recht auf Irrtum und Risiko zugestehen.
Gerade die Psychiatrie hat oft große Mühe damit, ihren Klienten dieses Recht auf Irrtum einzuräumen. Psychiatrische Institutionen haben ja gerade den Auftrag, den Irrtum, also das Nicht-Rationale, zu behandeln und zu verhindern. Wie soll es ihnen da leichtfallen, das Recht auf Irrtum und Risiko zuzulassen, ja, diesem im Sinne einer Förderung von Eigenständigkeit und Selbstverantwortung sogar positiv gegenüberzustehen? Betroffene beklagen das entsprechend oft. »Ich wurde in Watte gepackt, man hat mir nur Dinge erlaubt, die garantiert geklappt haben«, berichtet ein ehemaliger Bewohner eines Wohnheims. Oftmals fühlen sich Fachpersonen auch verantwortlich für das Gelingen oder Misslingen eines Hilfeangebots. Manchmal werden sie sogar von Kollegen dafür verantwortlich gemacht.
BEISPIEL 1
Eine Mitarbeiterin einer Kontakt- und Beratungsstelle berichtet, dass es in ihrem Team bei einer gesundheitlichen Verschlechterung eines Klienten immer wieder Kommentare gäbe wie: »Was hast du denn mit Frau Müller gemacht, der geht’s ja so schlecht in letzter Zeit.«
BEISPIEL 2
Ein Mitarbeiter eines Sozialpsychiatrischen Dienstes berichtet, ein ehemaliger Klient habe einen Arbeitsversuch unternehmen wollen, den andere Kollegen von vornherein für aussichtslos gehalten hätten, er aber habe die Entscheidung des Klienten mitgetragen. Der Arbeitsversuch sei mit einem sehr problematischen Ende gescheitert. Einige Monate später habe sich der Klient suizidiert. Seit dieser Zeit könne er etwas fragwürdige Entscheidungen seiner Klienten kaum noch mittragen und versuche immer, »auf die sichere Seite« zu kommen.
Mit der Freiheit zu Irrtum und Versuch ist eng verbunden, dass Klienten auch die Konsequenzen ihrer Entscheidungen und Handlungen erfahren müssen (bzw. dürfen), um zukünftig Entscheidungen besser abwägen zu können. Wer vor den Konsequenzen seiner Handlungen geschützt wird, wird an einer Form der Eigenständigkeit gehindert. Hier ist meistens ein Abwägen erforderlich, denn selbstverständlich werden Fachleute bemüht sein, ihre Klienten vor schwerwiegenden negativen Folgen einer Entscheidung zu schützen. Das muss aber auf Ausnahmen beschränkt bleiben, denn wenn ein Mensch die negativen Konsequenzen seiner Handlungen nicht mehr spürt, wird er diese Verhaltensweisen natürlich in Zukunft fortsetzen und ist damit an einer Lernmöglichkeit gehindert worden.
Wichtig ist es zudem, Entscheidungen des Klienten mitzutragen, auch wenn der Mitarbeiter sie nicht für optimal hält oder ihr Scheitern befürchtet. Das kann sehr schwierig sein. Mitarbeiter müssen dabei über »ihren eigenen Schatten springen« können. Wer nur recht behalten will, gerät schnell in eine Haltung von: »Soll er’s doch machen, wie er will, er wird schon sehen, dass es so nicht funktioniert.« Wenn Hilfe verweigert wird, erhöht sich aber das Risiko des Scheiterns. Bekäme der Klient sie, wäre er vielleicht erfolgreich. Ich meine damit nicht, dass Mitarbeitende alle Entscheidungen ihrer Klienten mittragen müssen. Vielmehr können sie durchaus ihre eigene Position deutlich machen, dürfen vor Risiken warnen, sollten aber auch von ihrer eigenen Position abrücken können und einmal getroffene Entscheidungen ihrer Klienten, wann immer möglich, akzeptieren und mittragen.
BEISPIEL
Herr Har hat aufgrund einer psychotischen Erkrankung sein Lehramtsstudium unterbrechen müssen. Nach Abklingen der Krise hat er insgesamt drei Anläufe unternommen, um wieder ins Studium einzusteigen, ist aber jedes Mal erneut psychotisch geworden. Jetzt bleibt ihm noch ein letzter Versuch, bevor er exmatrikuliert wird. Da der letzten Krise eine lange postpsychotische Depression folgte, vertritt seine Psychotherapeutin den Standpunkt, er sollte nicht noch einen weiteren Versuch unternehmen, sondern sich um die von ihm ebenf...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Zum Autor
- Impressum
- Inhalt
- Empowerment, Recovery und die eigene Arbeitszufriedenheit – Einleitung
- Was ist »Empowerment« und was »Recovery«?
- Wie werden Menschen wieder gesund?
- Ressourcenorientiert arbeiten
- Selbstbestimmung fördern und ermöglichen
- Empowerment bzw. Recovery und Psychopharmaka
- Förderung von Eigenaktivität
- Individuelle Selbsthilfe und Selbsthilfe in Gruppen
- Informationen vermitteln
- Selbststigmatisierung überwinden
- Das Annehmen der eigenen Person und der Erkrankung
- Mitarbeit von Betroffenen in Einrichtungen und Gremien –
- Schluss und Ausblick: Neue Rollenidentität der professionell Tätigen
- Literatur
- Internetadressen und Onlinematerialien