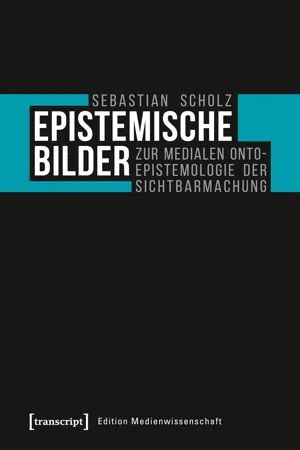![]()
II.Archäologie der Sichtbarmachung
Aus: Rainald Goetz: Kronos. Berichte
»Plötzlich sah ich alles richtig.
Bilder denken, wie die Schrift, vom Bild der Welt ganz ab gehackt, nie wirklich in Bildern spricht, ihr Denken stumm und ohne Worte als der Bilder und der Zeiger ihres Wissens, das so sichtlich, denken Bilder richtig, das Auge ist der Zeit, mit dem die Zeit in allem jetzt, was jetzt ist, sieht. Stumm ist das Reich des Sichtbaren des Lichts nicht nicht der Kerker, wie umgekehrt dem Wort die reinste Finsternis des Sagbaren der Worte logisch Haft ist, und dennoch müssen Bilder an der Mauer ihres Schweigens sich den Kopf nicht tot zerstoßen, sondern dort sich in der Ordnung ihres Wissens richtig so zu sich entschlossen zu geordnet wissen, um in der Macht des ja des Sichtbaren als schöne Könige zu herrschen. Spricht umgekehrt die Schrift, lügt sie, in ihrer Welt, die nichtnichtnicht von dieser Welt ist, nicht, sagt sie, im Anfang war das Wort, wo hingegen gleichzeitig, zillionen mal zillionen ferne Fernen fern, auf dem bestimmten Klumpen der Materie der Erde, in Wirklichkeit die Welt im Anfang ist, wie jedes Auge da, das sich da öffnet, sieht. So haben Bilder mit den Worten, wie Worte mit den Bildern, nichts zu schaffen, nichts zu vernichten. Denn Bilder sind, bevor sie da sind, nicht da, weshalb sie hin zu machen sind, so daß sie schließlich plötzlich, sind sie fertig da, ganz still gestellt da sind. Da ist Verrat des Fertigen an dem Verfertigen das Zeitgefängnis, in dem die Bilder ihrer Herrschaftsregel unterworfen herrschen im Geschichte in der Zeit. Hingegen ist die Position, von der aus Bilder zeigen, was sie wissen, an dem von ihnen selbst tatsächlich grenzenlos getrennten Ort im Raum des nein der Sagbarkeit der Worte der Blinde Seher, der alles, was zu sagen ist, sagbar in Worten sagbar sagt. Das Maß dieser Distanz zwischen dem Ort der Position, wo Bilder Weise und die Worte waren, bevor sie Bilder wirklich sind, und ihrem ja zum ja der Sichtbarkeit des Denkens ihres Wissens, zeigt so dem Sinn der Sicht, der Bilder fragt, wie er die Finsternis befragt, was denkt die Finsternis, was denkt das Wasser, was der Stein, was Bilder denken, im Maß der Nichtsvernichtung gleichzeitig die Richtigkeit der Position und die Entschlossenheit der Bilder zur Verschlossenheit der Lichtordnung als Kraft. Kraft ist die Macht, das nichts der Grenzenlosigkeit des nichts, das Sagbares getrennt vom Sichtbaren getrennt fest hält, als Nichtsvernichter zu vernichten.« [Sic!]
(Goetz 1993, 231f.)
Operationen: Zum Sichtbaren der Wissenschaft
Prozesse des Sichtbarwerdens, Operationen der Sichtbarmachung und epistemische Bilder als Kristallisationspunkte dieser Prozesse und Operationen sind, wie einleitend angedeutet, nicht vor- und darstellbar ohne einen dezidiert offenen und prozessualen Medienbegriff, der auf der Annahme fußt, Medien brächten ihnen entsprechende Formen des Wissens hervor. Sie sind somit an der Herstellung und Verbreitung spezifischer Wissensräume konstitutiv beteiligt und gehen selbst zugleich aus spezifischen Wissensräumen hervor. Dieser Zusammenhang von technischen Medien, Bildern, Wissen und ihrer jeweiligen Konfiguration wird besonders deutlich am Beispiel wissenschaftlichen (Bild-)Mediengebrauchs, da in der konkreten Experimentalsituation des Laboratoriums durch Bildgebung oder Aufzeichnung gewonnene Bilder eben nicht (zumindestin den seltensten Fällen) allein der Veranschaulichung dienen. Vielmehr werden über diskursive Evidenzgesten Bilder als Produzenten neuer, unhintergehbarer Sichtbarkeiten selbst zu ›epistemischen Dingen‹ im Sinne Hans-Jörg Rheinbergers (vgl. u.a. Rheinberger 2006).
Was sichtbar wird, wird dies, weil es sichtbar gemacht wird. Die Produktion von Wissen bestimmt sich in starker Weise über ebendiese sichtbar gemachten Dinge. Im Prozess der Sichtbarmachung verschränken sich Wissen und technische Medien zu einem Konglomerat von Sichtbarem und Sagbarem, dem, wie bereits angedeutet, stets Machtverhältnisse im Sinne Foucaults eingeschrieben sind, wenn damit mehr oder weniger verbindliche Räume des Sichtbaren – und damit, über einen tradierten und konventionalisierten epistemologischen Kurzschluss: des Wissens – aufgespannt werden.
Wenn die Moderne durch eine wachsende Zahl technischer Darstellungsmittel eine zunehmende Fülle von Möglichkeiten buchstäblicher Sichtbarkeitsproduktion gewonnen hat, darf dabei nicht übersehen werden, dass Erkenntnisse vor allem dann erzielt wurden und werden, wenn sich Erkenntnisobjekte und Darstellungsmedien eng ineinander verschränken. Die dabei erzeugten ›epistemischen Bilder‹ sind geprägt von einer konstitutiven Vagheit und Differentialität, denn sie können sich sowohl selbst zu Tatsachen verfestigen als auch erneut in den Forschungsprozess einfließen, um wiederum neue Wissensräume zu erschließen. Die Konstitutions- und Erschließungsleistung betrifft also vor allen Dingen Darstellungsräume des Wissens im Modus der Sichtbarmachung. Insbesondere im Zeitalter technischer (später vor allem: elektronischer) Medien kann von einer regelrechten Sichtbarkeitsproduktionsindustrie seitens der Wissenschaften und der an diese anknüpfenden Diskurse gesprochen werden. Treten ›neue Medien‹ als materiell-diskursive Assemblagen in Wissenskonstellationen ein, so kommt es nicht selten zu einer umfassenden Rekonfiguration des Verhältnisses von Macht, Medien und Wissen, zu einer Neuregelung des Sichtbarkeitsraumes und damit zu einer veränderten Anordnung der Elemente des Sichtbaren und Sagbaren, des Auges und des Blicks, des individuellen wie des kollektiven Wissenshorizonts.
Derlei Rekonfigurationen verschieben die mögliche Ordnung des Sichtbaren oder bringen letztere zumindest in Bewegung. Sie zeitigen demnach Folgen, welche einerseits medial bedingt, andererseits zugleich an der Hervorbringung neuer oder andersartiger medialer Dispositive beteiligt sind. Um Kontinuitäten und Brüche innerhalb solcher Sichtbarkeitsordnungen präziser bestimmen zu können, lohnte folglich der Blick in jene, ganz buchstäblich zu verstehenden, Räume des Wissens und der Sichtbarkeitsproduktion: die Laboratorien natur- oder lebenswissenschaftlicher Forschung und ihre Experimentalsysteme. Selbstverständlich sind Studien zum Thema wissenschaftlicher Visualisierung seitens der Medien- und der Bildwissenschaft und (mehr noch) der Wissenschaftsforschung sowie der Science and Technology Studies (STS) inzwischen mehr oder weniger Legion. Seltener jedoch wird, ungeachtet der Konjunkturen der Rede von Wissensgesellschaft und pictorial turn, der Versuch unternommen, das Verhältnis von Wissen(schaft), Sichtbarkeit und Bildlichkeit ausgehend von einem nicht bereits als gesichert geltenden Medienbegriff zu konzeptualiseren, um die medientheoretischen Implikationen genauer zu erfassen und das Verhältnis als wechselseitiges zu problematisieren.
Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu formulieren: Die medialen Verfahren bildlicher Darstellung wirken nicht nur stets auf den Vorgang der Erkenntnis selbst zurück; technische Darstellungsverfahren ermöglichen diesen in konstitutiver Weise und beeinflussen dessen konkrete Ausformungen und Inhalte. Vorausgesetzt den medientheoretischen Gemeinplatz, dass Medien nicht leere Gefäße oder neutrale Kanäle der Vermittlung sind, sondern Dinge überhaupt nur wahrnehmbar sind »in einem diese Wahrnehmung vermittelnden Medium« (vgl. Heider 1926), ist jede Erkenntnis durch die mediale Vermittlung der sie bedingenden Wahrnehmung vorstrukturiert. Diese spezifische Voraussetzung für Erkenntnis als Effekt des hervorbringenden Mediums gilt es einerseits zu untersuchen – andererseits muss dabei zunächst genauer bestimmt werden, was hier als ›Medium‹ Wahrnehmung strukturiert, insbesondere, wenn wie hier davon ausgegangen wird, dass die Medien-Funktion sich dem Gebrauch verdankt, also operativ ein funktionales Medien-Werden einsetzt.
Wenn beispielsweise die Mikrofotografie ein Bild hervorbringt, dann erzeugt sie damit den Gegenstand, der ein bestimmtes, von einer Frage abhängiges Wissen produziert, das ›epistemische Ding‹. Das Bild fotografierter Mikroskopien ist (ebenso wie das Nanobild) ein vom Medium hervorgebrachtes Wissensobjekt. Als epistemisches Bild wird es wiederum Gegenstand der Untersuchung, wenn es selbst zum Untersuchungsobjekt wird, d.h. abfotografiert, vergrößert, geschnitten, neu belichtet etc. wird. Diese rekursiven Prozesse der Sichtbarmachung erst lassen das Bild im eigentlichen Sinne von einem Wissenschaftsbild zum epistemischen Bild werden. In genau dieser Konfiguration liegt die Bedeutung des epistemischen Bilds in seiner Beziehung zur Sichtbarmachung begründet, die einer medienwissenschaftlichen Perspektive vor allem dann zugänglich wird, wenn diese auf die Vorgänge eines ›Sichtbar-Werdens‹ im Zusammenhang mit einem ›Medien-Werden‹ fokussieren kann.
Konsequenz dieser doppelten Strategie der Problematisierung von Sichtbarkeit und Medien ist eine Verschiebung der Frage nach der historischen, medialen und materiell-diskursiven Konstitution von Darstellungsräumen des Wissens, die seitens der Wissenschaften mithilfe epistemischer Bilder laufend bearbeitet und rekonfiguriert werden. Die Ausgangsthese, dass bildliche Darstellungen von wissenschaftlich zu untersuchenden Sachverhalten aus der Wechselwirkung von materiellen (Medien-)Techniken und sozialen Forschungspraktiken und -umwelten resultieren, zugleich aber auch Objekte der sie konstituierenden Wissenschaften sind, kann fraglos im Rahmen des vorliegenden Buchs nicht vollumfänglich bewiesen werden. Weniger denn als Abschluss, versteht sich dieses daher als Versuch der Erschließung eines theoretischen Horizonts und als Anschubimpuls für eine Forschung, die sich in stärkerer Weise als bisher darum bemüht, den Problemhorizont nicht durch die Setzung einer der an der Wissenskonstitution beteiligten Agenturen (das forschende Erkenntnissubjekt, die Medien und Apparate, der Forschungsgegenstand als entweder einfach vorhanden oder sozial konstruiert, das Sichtbare als natürliche Gegebenheit usw.) als stabil, gegeben, vorgängig oder schlicht unproblematisch, künstlich zu verengen. Eingrenzungen dieser Art können zweifelsohne abhängig von der jeweiligen Fragestellung taktischer Natur und diskurs- und forschungsstrategisch dringend geboten sein. Doch sollten sie in diesen Fällen begründet und das, was infolge der strategischen Begrenzung außer Sicht gerät, mitreflektiert werden.
Aus medienwissenschaftlicher Perspektive werden im Folgenden also jene produktiven »Räume des Wissens« (vgl. Rheinberger, Hagner, Wahrig-Schmidt 1997) in den Blick genommen, in denen epistemische Bilder als Gegenstand und Medium von Sichtbarmachung entstehen – und damit auch jene bildräumlichen Ordnungen, die als Effekt von Sichtbarkeitsproduktionen konstituiert werden und das gesellschaftliche Bild des Wissens prägen. Hagner und Rheinberger geben aus einem wissenschaftshistorischen Blickwinkel die Programmatik gewissermaßen vor, wenn sie notieren: »Ein wie auch immer geartetes natürliches Objekt bedarf somit eines spezifischen Repräsentationsraumes, um wissenschaftlich attraktiv zu werden. Es kann umgekehrt aber auch an der Konstituierung eines solchen Raumes einen entscheidenden Anteil haben.« (Hagner/Rheinberger 1997, 21)
Dabei, so ist man zunächst geneigt festzustellen, spielen die Autoren, zumindest im ausgewählten Zitat über die Verwendung des missverständlichen Wortes »attraktiv«, auf den ersten Blick die Bedeutung der Rolle des Repräsentationsraumes tendenziell stärker als nötig herunter. Erst in der Zusammenfügung zu »wissenschaftlich attraktiv« deutet sich die tatsächliche Dimension der Bedeutung an, denn damit ist selbstverständlich nicht bloß eine Attraktivität im Sinne einer möglichen Popularisierung gemeint, sondern die Repräsentation eines Gegenstandes als Bestandteil einer Frage oder als mögliches ›epistemisches Ding‹. Ausgehend von den Gegenstandsbereichen Mikrofotografie und mit einem Schwenk zur nanotechnologischen Bildgebung werden auf den folgenden Seiten exemplarisch zwei epistemisch über diskontinuierliche Linien verbundene Zeiträume (Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts sowie Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts) hinsichtlich ihrer jeweils prägenden Verfahren der Sichtbarmachung angesprochen. An diesen lässt sich zeigen, in welcher Weise die Emergenz neuer Medientechniken nicht nur mit der Herausbildung neuer Praktiken der wissenschaftlichen Untersuchung einhergeht, sondern auch zu einer Rekonfiguration des wissenschaftlichen Wissens und seiner mit Wissen aufgeladenen Gegenstände führt – kurz: zu einer Rekonfiguration des materiell-diskursiven Gefüges der Experimentalpraktiken zur epistemischen Sichtbarmachung.
Das angesprochene Ziel einer tentativen Erarbeitung des theoretischen Rahmens für eine mediale Onto-Epistemologie des Wissens(chafts)bildes im Hinblick auf dessen Sichtbarkeit und Sagbarkeit re-distribuierende Dimension versteht sich dezidiert nicht als Rahmung im Sinne einer Schließung, Verfugung oder Versiegelung. Vielmehr verweist auch ein solcher Rahmen notwendig auf ein Außen des Nichtgerahmten, Nichteingeschlossenen oder Nichtberücksichtigten. Der Rahmen weist die vorliegenden Überlegungen damit als vorläufig und explorativ aus – und somit jederzeit Kritik, Korrektur und Konjektur offen stehend.
Epistemische Bilder wirken im Kontext von Diskurspolitiken, die sie mitkonstituieren und aus denen sie mithervorgehen. Daher gilt es, im produktiven Rückgriff auf Konzeptionen der »Archäologie des Wissens« (Foucault 1973), das dort eingeführte Instrumentarium gleichsam vom Gegenstand der Sag- auf die Sichtbarkeiten und auf deren mediale Möglichkeitsbedingungen auszuweiten. Ansätze dafür sind in den frühen Arbeiten Foucaults im Umfeld der »Archäologie« durchaus angelegt. Dabei geht es im Vorliegenden weniger darum, »epistemische Bilder« als in zentraler Weise beteiligt an der Produktion von normativen Sichtbarkeitsräumen (welche ihrerseits das Zustandekommen solcher Bilder präfigurieren) zu analysieren, sondern zu verstehen, wie spezifische Verteilungen von Sicht- und Sagbarkeit in ihrem Zustandekommen zu denken sind, die im epistemischen Bild als Element eines Experimentalsystems fixiert worden sind. Wenn diese später anderen Kontexten (dem Hörsaal, der Fachwelt, einem Laienpublikum, der Populärkultur) zugänglich gemacht werden, verweisen die Bilder häufig kaum mehr auf die Bedingungen ihres Zustandekommens, obschon diese sich unvermeidlich in das Bild eingeschrieben haben. Die Bilder zirkulieren also nicht zwangsläufig in ihrer primär produzierten Form, sondern müssen (und können) gegebenenfalls dem Gebrauch und der Adressatengruppe entsprechend umcodiert werden: als Lehrmaterial im Rahmen didaktischer Kommunikationsprozesse, als bildliche Evidenzgeste innerhalb eines meist sprachlich-rhetorisch verfassten Diskurses in der Öffentlichkeit, oder ikonographisch als Strategie der Verwissenschaftlichung in Zeitschriften, Filmen, Fernsehserien etc.
Hierin offenbart sich das wirkmächtige Potential von Bildpolitiken, die mit autoritativen Evidenzgesten operieren, deren bloße Bildlichkeit »Evidenz« exemplifiziert und in einen spezifischen Darstellungsraum einführt, der fortan einen kollektiven Wissenshorizont teilweise markiert. Dabei ...