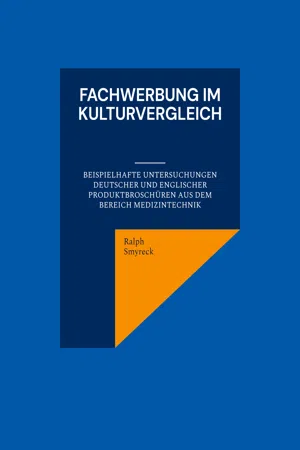![]()
1 Einleitung
Durch den sogenannten Cultural turn in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fand auch innerhalb der allgemeinen Sprachwissenschaft eine Perspektiverweiterung um kulturwissenschaftliche Problemstellungen statt. Mit der Erforschung massenmedialer Kommunikation rückt nun auch Werbung verstärkt in den Mittelpunkt soziokultureller und sprachwissenschaftlicher Untersuchungen (z. B. Garbe/Nieroda-Kowal 2016; Janich 2012a, 2013; Stöckl/Grösslinger/Stadler 2013 für die deutsche Werbesprache; Wells/Burnett/Moriarty 2003 für die englische Werbesprache).
Ein wesentliches Merkmal von Werbekommunikation ist ihre Zielgerichtetheit. Werbung muss Überzeugungsarbeit leisten und verknüpft hierfür geschickt sowohl rationale als auch emotionale Stilmittel, sowohl sprachliche als auch nichtsprachliche Elemente. In der Sprachwissenschaft wird in diesem Zusammenhang deshalb auch vom „Funktionalstil der Werbung“ (Hoffmann 2012:182) gesprochen. Zahlreiche Untersuchungen haben zu neuen Erkenntnissen unter anderem im Bereich der pragmatischkommunikativen Funktionen (z. B. Weber/Fahr 2013), der Lexik (z. B. Römer 2012), des Stils (z. B. Hoffmann 2012), der Vertextungsstrategien (z. B. Stein 2011) oder der vielfältigen Bild-Text-Verknüpfungen (z. B. Stöckl 2004; Schierl 2017) in der Werbung geführt. Entstanden sind verschiedene textlinguistische und bildsemiotische Modelle zur Analyse der einzelnen Bestandteile von Werbekommunikation sowie der wechselseitigen Wirkungsmechanismen (siehe z. B. Hennecke 2012 für einen Überblick zu verschiedenen Analysemodellen).
Insbesondere in den vergangenen Jahren wurde der Werbung auch in der Angewandten Linguistik und Translatologie verstärkt Aufmerksamkeit zuteil. Untersuchungen auf diesem Gebiet verfolgen häufig das Ziel, kulturelle Unterschiede bei der Gestaltung von Werbekommunikation aufzudecken (siehe z. B. Gau 2007 für deutsch- und französischsprachige Werbung; Friedrich 2015 für deutsch- und englischsprachige Werbung). Ein weiterer Schwerpunkt solcher Studien liegt auf der Beantwortung der Frage, wie Werbung übersetzt und an unterschiedliche Märkte angepasst werden kann (siehe z. B. Valdés 2011 für einen Überblick zur Forschungshistorie auf diesem Gebiet).
Ein Großteil der bisherigen Untersuchungen im Bereich der Werbekommunikationsforschung hat vor allem Werbung für Consumer Products und hier besonders Printanzeigen in Publikumszeitschriften zum Untersuchungsgegenstand (z. B. Minucci 2008; Opiłowski 2006; Perlina 2008; Sulikan 2012). Oft steht auch die Analyse politischer Werbung im Vordergrund (z. B. Klemm 2011).
Erstaunlich wenig Beachtung wird hingegen Werbeformaten geschenkt, die sich an Fachleute in einem bestimmten Bereich richten, zum Beispiel in der Medizin. Insbesondere fehlen bislang Untersuchungsmodelle und kulturkontrastive Studien zur stark fachlich geprägten Werbung in einzelnen Sprachen. Der Frage, wie stark fachlich geprägte Werbung an verschiedene Zielgruppen angepasst und in andere Sprachen übersetzt wird, ist bislang ebenfalls nicht ausgiebig nachgegangen worden. Mit Blick auf die weiterführende Erforschung von kulturell geprägter (Fach-)Kommunikation und den damit verbundenen (Fach-)Textsorten ergibt sich somit für die Angewandte Linguistik und Translatologie ein hochaktuelles Forschungsthema, das mit der vorliegenden Arbeit aufgegriffen wird.
1.1 Anliegen und Ziele der Arbeit, Korpus
In der Werbekommunikationsforschung steht zumeist die Frage im Mittelpunkt, wie sich die Bestandteile und Eigenheiten unterschiedlicher Werbetexte erkennen, beschreiben und kategorisieren lassen. Um dies für die stark fachlich geprägte Werbung zu ermöglichen, soll ein neues Analysemodell erarbeitet werden, welches verschiedene Ansätze aus der interdisziplinären Werbekommunikationsforschung, der Textlinguistik und der Bildsemiotik vereint. Bisherige Modelle sind zwar oft paralleltext- aber nicht kulturtransferbezogen. Oder die besondere Konstellation der an der Kommunikation beteiligten Personen bleibt unbeachtet (vgl. zum Beispiel das Modell von Nielsen 2012). Damit kann Fachwerbung im Zielgruppen- oder Kulturvergleich also nicht umfassend untersucht werden.
Die Weiterentwicklung existierender Untersuchungsmethoden zur Werbetextgestaltung und die Erschließung fachexterner Ergebnisse stellt ein Novum dar, das nicht nur der Angewandten Sprachwissenschaft und Translatologie, sondern auch der Fachkommunikationsforschung, der Semiotik, der kontrastiven Fachtextlinguistik und der Kulturwissenschaft neue Perspektiven eröffnen kann.
Das Modell soll es ermöglichen, den folgenden Fragen nachzugehen: Welche kulturellen Unterschiede werden bei der Ausgestaltung eines Werbekommunikats im Hinblick auf Form, Syntax, Lexik, Stil, Semiotik sowie der verwendeten Werbestrategien und der Art der Bild-Text-Verknüpfungen ersichtlich? Wie lässt sich der Fachwerbestil in den untersuchten Sprachen charakterisieren? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur Werbung für Consumer Products werden ersichtlich? Inwieweit nimmt die Konstellation der an der Kommunikation beteiligten Personen Einfluss auf die Ausgestaltung des Werbekommunikats? Wie wird fachlich geprägte Werbung übersetzt und welcher Grad der Anpassung wird verfolgt?
Um das vorgeschlagene Modell auf seine Brauchbarkeit hin zu überprüfen und damit die oben genannten Fragen zu beantworten, wird es auf ein Korpus aus deutsch- und englischsprachigen Produktbroschüren aus dem Bereich Medizin angewandt, die sich an Healthcare Professionals und Patient:innen richten. Mit Healthcare Professionals (nachfolgend „HCP“ genannt) ist in der vorliegenden Arbeit i. w. S. medizinisch geschultes Personal gemeint.
Die Untersuchung konzentriert sich damit auf ein bestimmtes Werbemittel der fachlich geprägten Werbung. Die Frage, wie das Medium (z. B. Print- vs. Online-Werbung) die Ausgestaltung der Werbebotschaften beeinflusst, bleibt im Rahmen dieser Arbeit daher unberücksichtigt. Durch die Beschränkung des Untersuchungsgegenstands auf Werbung, in der ausschließlich medizinische Produkte vermarktet werden, wird auch nicht auf solche Aspekte der Ausgestaltung von Werbekommunikation eingegangen, die vorrangig inhaltlich-gegenständlicher Natur sind (z. B. der Vergleich von Werbung für unterschiedliche Produkte).
![]()
1.2 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit besteht aus einem theoretischen Teil (Kapitel 1-4) und einem empirischen Teil (Kapitel 5-7). Zu Beginn des Theorieteils wird Werbung als Kommunikationsform beschrieben. Dabei wird insbesondere auf texttypologische und werbepsychologische Aspekte eingegangen. Zudem werden verschiedene Werbestrategien in Abhängigkeit der verfolgten Ziele und der Zielgruppe diskutiert.
Am Beispiel von Printanzeigen werden im Anschluss die typischen Bestandteile und Merkmale schriftlicher Werbekommunikation dargestellt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Beschreibung von Form und Funktion des Werbebilds sowie der Bild-Text-Relationen. Daraufhin wird auch auf intertextualitätsstiftende Verfahren in der Werbung sowie auf Berührungspunkte zwischen Werbekommunikation und Fachkommunikation eingegangen.
Zur genaueren Betrachtung der sprachlichen Bestandteile von Werbung werden im Anschluss verschiedene Untersuchungen auf mehreren Einzelebenen diskutiert. Im Vordergrund steht dabei die syntaktische, die lexikalisch-semantische und die stilistische Ebene von Werbekommunikation.
Zum Abschluss des Theorieteils wird die Betrachtung auf interkulturelle Aspekte des Werbens ausgedehnt. In diesem Zusammenhang wird besonders auf die Frage der Übersetzbarkeit von Werbekommunikation eingegangen. Als eines der möglichen Übersetzungsprobleme wird die Verknüpfung von Werbebild und Text thematisiert.
Am Ende eines jeden Kapitels werden anhand der diskutierten Aspekte die jeweils relevanten Untersuchungsschritte für das zu entwickelnde Modell zur Analyse fachlich geprägter Werbekommunikation und die in diesem Zusammenhang aufgeworfenen Forschungsfragen aufgelistet.
Im empirischen Teil der Arbeit wird im Anschluss das neue Modell entwickelt. Zunächst werden einige Vorüberlegungen zur Methodik kulturkontrastiver Untersuchungen angestellt. Daraufhin werden die im Theorieteil aufgelisteten Untersuchungsschritte in ein neues Modell zur Analyse fachlich geprägter Werbung überführt.
Im darauffolgenden Kapitel wird das Korpus mithilfe des vorgeschlagenen Modells ausgewertet. Zu Beginn werden das Analysematerial und die Methode der Untersuchung beschrieben. Anschließend werden die an HCP gerichteten Produktbroschüren auf formaler, textstruktureller, syntaktischer, lexikalisch-semantischer und stilistischer Ebene ausgewertet. Die Analyse der Text-Bild-Relationen erfolgt zum Schluss.
In drei Fallstudien wird die Analyse der Produktbroschüren danach um zwei Aspekte erweitert. In den ersten beiden Fallstudien soll untersucht werden, wie stark fachlich geprägte Werbung an unterschiedliche Zielgruppen angepasst wird. Dazu werden Produktbroschüren für jede Ausgangssprache (Englisch und Deutsch) miteinander verglichen, in denen jeweils ein bestimmtes Produkt einmal für HCP und einmal für Patient:innen vermarket wird. In der dritten Fallstudie wird der Fokus auf die Analyse übersetzter Werbekommunikation gelegt, um Übersetzungsstrategien zu untersuchen und den Grad der Anpassung zu beschreiben. Dazu wird exemplarisch eine im Original auf Englisch verfasste Produktbroschüre mit der Übersetzung ins Deutsche verglichen.
Die Arbeit schließt mit der Diskussion und Einordnung der Untersuchungsergebnisse.
Soweit nicht anders angegeben, stammen alle Hervorhebungen im folgenden Text vom Verfasser der Arbeit.
![]()
2 Werbekommunikation aus pragmatischer Sicht
Mit dem Ziel, mögliche Forschungsfragen und Kategorien für ein zu erarbeitendes Analysemodell fachlich geprägter Werbung aufzustellen, wird die Kommunikationsform Werbung in diesem ersten theoretischen Kapitel aus texttypologischer und werbepsychologischer Sicht heraus betrachtet. Zunächst werden Werbetexte als Form der strategischen Kommunikation beschrieben und Werbeziele erörtert. Anschließend werden verschiedene Vermarktungs- und Vertextungsstrategien in Abhängigkeit der Zielgruppenbestimmung vorgestellt. Am Beispiel von Printanzeigen werden dann die einzelnen Bestandteile und Merkmale von Werbekommunikation ausführlicher diskutiert. Abschließend wird gesondert auf das Phänomen der Intertextualität in der Werbung eingegangen.
2.1 Werbung als Kommunikationsform
Aus der Sicht der Unternehmenskommunikation (siehe z. B. Zerfaß/Piwinger 2014) ist Werbung ein wichtiger Bestandteil des Marketings und damit laut Klein (2011:31) der „Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle von Programmen, die darauf gerichtet sind, zum Erreichen des Organisationsziels einen für beide Seiten nützlichen Austausch einzuleiten, aufzubauen und zu erhalten“. Die zwei von Klein genannten Seiten, die hier miteinander kommunizieren, sind werbetreibende Unternehmen bzw. die in ihrem Auftrag handelnden Werbeagenturen (als Textproduzent:innen) und eine meist unbestimmte Menge an Beworbenen (als Textrezipient:innen). Da von den Textrezipient:innen im Regelfall keine Antwort erwartet wird, ist diese Form der Kommunikation laut Janich (2013:119f.) jedoch monologisch und das Produkt (der Werbetext) wird zudem nicht unmittelbar, sondern mit räumlicher und zeitlicher Distanz rezipiert.
Unter Werbetext sollen im Folgenden in Anlehnung an Janich (2012b:215), die für eine semiotische Öffnung der Betrachtung von Werbetexten plädiert, auch gesprochensprachliche und visuelle Komponenten verstanden werden. Damit wird dem Fakt Rechnung getragen, dass Werbetexte meist multimodale Konstrukte sind, deren einzelne Bestandteile ineinandergreifen und oft erst durch ein Wechselspiel von Bedeutungskonstruktion und -verschiebung die Gesamtbotschaft formen.
Aufgrund dieser Komplexität bilden Werbetexte Smith (2006) zufolge
keinesfalls einen homogenen Texttyp, denn die Werbeindustrie bedient sich sämtlicher textueller und sprachlicher Mittel wie Rhetorik, Intertextualität, Prosodie, Wortspiel, Metapher usw., um die Werbebotschaft erfolgreich zu vermitteln. (Smith 2006:238)
Weiterhin hält sie fest: „Atypische Textsorten, z.B. Bericht, Erzählung“, innerhalb eines Werbekommunikats, können dazu führen, dass „die konative Absicht (oder Appellfunktion) nicht sofort erkannt wird“ (Smith 2006:238). Eine nicht klar umrissene Textsorte sowie nicht eindeutig zuordenbare Merkmale sind für sprachwissenschaftliche Analysen eine Herausforderung. Interdisziplinäre Beschreibungsansätze werden in diesem Fall benötigt, um zumindest bestimmte Textmuster erkennen zu können.
Versuchen wir aber zunächst, Werbung weiterhin über die Handlungsabsicht der Textproduzent:innen zu definieren, so können darunter mit Adamzik (1994) alle Texte verstanden werden, auf die Folgendes zutrifft:
Mittelbarer oder unmittelbarer Sender ist jemand, der irgendwelche Waren oder Ideen produziert, vertreibt oder vertritt und der mit dem Text das Verhalten oder die Einstellung einer unspezifizierten Menge von Rezipienten in eine Richtung beeinflussen will, die seinen eigenen Interessen (als Produzent) dient, wobei unterstellt wird, daß das schließliche Verhalten der Rezipienten prinzipiell in ihrer freien Entscheidung liegt. (Adamzik 1994:174)
Solche Texte sind unter diesen Gesichtspunkten als eine Form der zu manipulieren versuchenden Kommunikation anzusehen. Durch ihren vorrangig persuasiven Charakter lassen sich Werbetexte daher in erster Linie dem von Brinker et al. (2000) definierten Texttyp des „Appelltextes“ zuordnen.
Werbetexte können jedoch ganz verschiedene Sprechakte (informieren, auffordern, danken, raten, anleiten etc.) enthalten; und das in den allermeisten Fällen auf makro- und mikrotextueller Ebene gleichzeitig, wie Simon/Dejica-Cartis (2015) zeigen. In ihrer Untersuchung von Printwerbung aus Publikumszeitschriften und Zeitungen schlussfolgern sie:
[W]ritten advertisements have the primary function of persuading or informing the addressee, and the secondary function of informing, giving directions and making positive statements about the offer, without bringing the necessary evidence to support them. (Simon/Dejica-Cartis 2015:238)
Neben der Identifikation der am häufigsten genutzten Sprechakte lässt vor allem die fast beiläufig erscheinende Ausführung von Simon und Dejica-Cartis aufhorchen, wonach für die in der Werbung gemachten Angaben keine Beweise geliefert werden. Wenn nicht durch Beweise und Fakten, wodurch überzeugt uns Werbung dann?
Werbetexten gelingt dies, da sie zunächst ein Produkt bzw. eine Dienstleistung thematisieren und Adamzik (1994:175) zufolge den „Konsumenten in einer Bedürfnisbzw. Bedürfnisbefriedigungssituation [abholen]“. Andererseits können Werbediskurse aber auch ein bis dato nicht vorhandenes Bedürfnis bei den Konsument:innen wecken oder es verstärken. Werbung tut dies, so Adamzik weiter, durch den „Informations- und Appellcharakter“, aber auch durch ihren „Unterhaltungswert und die ästhetische Funktion“ (beides ebd.:175). Das primäre Ziel jeglicher professioneller Werbehandlung ist es dabei laut Stoeckl (2013:121), den Adressat:innen einen Mehrwert zu vermitteln und sie zur Kaufhandlung zu bewegen.
Die Werbekommunikationsforschung hat darüber hinaus verschiedene Teilziele identifiziert, die Unternehmen beim Anpreisen ihrer Waren oder Dienstleistungen mittels Werbung verfolgen. Abstrakt formuliert nennen Weber/Fahr (2013:334f.) folgende fünf Kommunikationsziele des Werbens: Werbung will informieren (über die Verfügbarkeit oder Verwendbarkeit), unterhalten (die Aufmerksamkeit wecken), motivieren (Kaufanreize schaffen), sozialisieren (Verhaltensmöglichkeiten beschreiben) sowie verstärken (Auslösen eines Hochgefühls bei Konsument:innen nach angestrebtem Verhalten).
In seinen Ausführungen zu Vermarktungsstrategien von Unternehmen betrachtet auch Stoeckl (2013:134) Werbung als „Instrument der Kommunikationspolitik eines Unternehmens“ und nennt als vordergründige Ziele ...