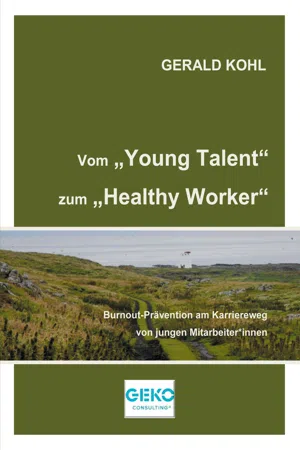
eBook - ePub
Vom Young Talent zum Healthy Worker
Burnout-Prävention am Karriereweg von jungen Mitarbeiter*innen
- 236 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Vom Young Talent zum Healthy Worker
Burnout-Prävention am Karriereweg von jungen Mitarbeiter*innen
Über dieses Buch
"So weit bin ich noch nicht, das drück ich schon durch" - "Über solche Dinge spricht man nicht unter Kolleg*innen" - "Schlimm ist das Gefühl, mit seinen Themen alleingelassen zu werden". Solche und ähnliche Aussagen gab es in den Interviews im Zuge der Forschungsarbeit zu diesem Buch zu hören.
Begeben Sie sich gemeinsam mit dem Autor auf eine Forschungsreise und erleben Sie am Praxisbeispiel eines Technologieunternehmens interessante, aber auch überraschende Einblicke, weshalb junge Mitarbeiter*innen oft unbemerkt ein hohes Burnoutrisiko haben und sich engagierte Präventionsanstrengungen gerade in Krisensituationen als (nicht) wirksam erweisen können.
Dieses Buch wendet sich an alle, die sich selbst, als Team oder im Unternehmen mit dem in unserer heutigen Leistungsgesellschaft so wichtigen volkswirtschaftlichen Thema der Burnout-Prävention auseinandersetzen wollen, um bereits im frühen Beschäftigungsalter der "Young Talents" die Voraussetzungen für einen nachhaltigen "Healthy-Worker-Effekt" zu schaffen.
Für Personalverantwortliche, aber auch Studierende kann dieses Buch eine Anregung zur praktischen Umsetzung eigener Forschungsprozesse und Unterstützung bei der kompetenten Interpretation der erhaltenen Ergebnisse darstellen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Vom Young Talent zum Healthy Worker von Gerald Kohl im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Betriebswirtschaft & Geschichte & Theorie in der Psychologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1. Einleitung
Dieses Buch befasst sich mit dem Thema der Erschöpfungskrankheiten („Burnout“) und ihrer Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der Belegschaft in Unternehmen. Burnout, oft im Zusammenhang mit Stress und in Krisensituationen betrachtet, ist ein weitreichend verwendeter Begriff, der die Gesellschaft aktuell stark beschäftigt. Speziell da Burnout als Trigger für spätere Erkrankung gesehen werden kann, sollte der Prävention und der Frage, was Personen mit höherer Widerstandfähigkeit („Resilienz“) von Personen mit weniger Belastbarkeit unterscheidet, besonderes Augenmerk geschenkt werden. Laut aktuellen Forschungsergebnissen wird Burnout meistens durch Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz ausgelöst, weswegen eine gleichzeitige Betrachtung mit den dort vorhandenen Belastungsfaktoren für die Prävention als unerlässlich erscheint (BMASK, 2017).
Zusätzlich kann beobachtet werden, dass es in einer zunehmend dynamischeren und schnelllebigen Welt manchen Organisationen besser gelingt, ihre Funktionsfähigkeit und innere Struktur angesichts dramatischer Veränderungen zu bewahren und sogar gestärkt aus Krisen hervorzugehen, als anderen (Weick & Sutcliffe, 2010). Die Förderung einer widerstandsfähigen und gesundheitsbewussten Unternehmenskultur nimmt somit in den heutigen Unternehmen im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und weitere Herausforderungen wie alternde Belegschaft und Fachkräftemangel eine zunehmend strategische Bedeutung ein (Fisch, 2013). Trotz der Aktualität des Themas scheint es kaum allgemein anwendbare Lösungsstrategien für diese Problemstellung zu geben. Ein präventiver Ansatz im Bezug auf Burnout entwickelt sich demnach zur Schlüsselkompetenz, nicht nur für die Unternehmensführung, sondern auch für die einzelnen Mitarbeiter*innen.
Wird von Burnout im Kontext von Unternehmen gesprochen, gilt es, jene Voraussetzungen näher zu betrachten, die für eine Organisation und ihre Belegschaft wichtig sind, um auch in schwierigen Zeiten Handlungsalternativen zur Verfügung zu haben, damit Herausforderungen zeitnah und zukunftsorientiert gelöst werden können. In der früheren Industriegesellschaft stand die sachliche Ebene für den Geschäftserfolg im Vordergrund und es galt, Maschinen und Technik zu optimieren. In der heutigen Wissensgesellschaft stellen jedoch der Mensch, seine kognitive und kreative Leistungsfähigkeit sowie die Beziehungen zwischen den Akteuren im Unternehmen die ausschlaggebenden Faktoren dar (Bertelsmann Stiftung, 2015). Das Bedürfnis nach schnellen Resultaten und Abschlüssen um jeden Preis führt zu permanentem Zeitdruck und Stress sowie nachweislich schlechteren Ergebnissen (Melchers & Plieger, 2017). Die aktuelle Schnelllebigkeit und die generationsbedingten Werteverschiebungen, in denen kaum mehr Platz für Geduld, Berechenbarkeit und Akzeptanz von Unsicherheiten existiert, fördern diese Symptome und machen eine umfassendere Betrachtung auf der sachlichen und menschlichen Ebene notwendig (Böhle & Busch, 2012). Die Stärkung der Widerstandsfähigkeit („Resilienz“) durch primärpräventive Maßnahmen kann hierbei als eine wichtige Ressource angesehen werden. Für die Entwicklung einer zielführenden Unternehmensstrategie haben Stressprävention und Resilienzfähigkeit somit Priorität und der Erhalt der psychischen und körperlichen Gesundheit stellt heute eine gesamtgesellschaftspolitische Aufgabe dar.
Mit diesem Buch verfolgt der Autor das Ziel, einerseits auf den in der Literatur beschriebenen theoretischen Hintergrund von Stressfaktoren und Burnout sowie deren organisatorische Bedeutung im Unternehmen einzugehen und andererseits Handlungsempfehlungen aufzuzeigen, die sich in der Praxis als wirksam erweisen und verwertbare Ansätze primärpräventiver Maßnahmen für Unternehmen und seine Mitarbeiter*innen darstellen könnten.
1.1. Burnoutrelevanz für „Young Talents” und der „Healthy-Worker-Effekt”
Laut aktuellen Forschungsergebnissen wird Burnout meistens durch Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz ausgelöst, weswegen eine gleichzeitige Betrachtung mit den dort vorhandenen Risikofaktoren für die Prävention als unerlässlich erscheint. In der Repräsentativerhebung des BMASK, 2017, zur Prävalenz des Burnout-Syndroms in Österreich ergibt sich folgende Zuordnung der Prävalenzzahlen: 19% Problemstadium, 17% Übergangsstadium sowie 8% Burnout-Erkrankungsstadium. Die daraus resultierenden Kosten für Betriebe und Wirtschaft sind signifikant, Tendenz steigend. Es wird somit deutlich die Notwendigkeit eines differenzierten, sowohl an das Individuum als auch an die Institutionen angepassten, graduierten Vorgehens zur Burnout-Prophylaxe belegt.
Aus der Sicht der besonders gefährdeten Altersgruppen findet sich in der Gruppe der unter 30-Jährigen ein besonders hoher Anteil an Personen im Burnout-Erkrankungsstadium, welcher mit zunehmendem Alter wieder geringer wird und ab dem 50. Lebensjahr wieder ansteigt. Erst nach dem 59. Lebensjahr sinkt das Erkrankungsrisiko wieder. Auch weisen die 30-bis 39-Jährigen beim Faktor der Distanzierungsfähigkeit, die für die Regeneration von zentraler Bedeutung ist, die schlechtesten Werte auf. Dies ist insofern plausibel, da gerade in diesem Lebensabschnitt die Weichenstellungen für das weitere (Berufs-)Leben erfolgen und der Druck am Arbeitsplatz entsprechend groß ist. Deshalb sollte gerade in der Altersgruppe der jungen Mitarbeiter*innen mit Maßnahmen der Prävention die Kompetenz hinsichtlich der Fähigkeiten der Distanzierung vom Arbeitsalltag, der Psychohygiene auf Persönlichkeitsebene und des Aufbaus interner und externer Ressourcen gestärkt werden, um eine Trendumkehr im späteren Erwerbsalter zu bewirken (BMASK, 2017)1. Die WHO definiert den Begriff des „aging worker“ ab einem Alter von 45 Jahren, womit die Grenze zwischen jüngeren und älteren Mitarbeiter*innen etwa bei 40 bis 45 Jahren gezogen werden kann.
Für die zum Thema der Distanzierungsfähigkeit beschriebene Gruppe der heute 30- bis 39-Jährigen, im Kontext der Unternehmen oft als „Young Talents“ oder Generation Y (Millennials) bezeichnet, stellt der Beruf eine entscheidende Stütze des Selbstkonzeptes dar (Myers & Sadaghiani, 2010). Die fortschreitende Individualisierung der Arbeit mit dem Leitbild „Unternehmerische Arbeitskraft“ und überzogenes Konsumdenken treiben das Burnout-Risiko gemeinsam mit dysfunktionalen Glaubenssätzen wie: „Du kannst alles schaffen!“ entsprechend an (Väth, 2011).
Um sich mit zunehmendem Alter eine überdurchschnittliche Gesundheit und eine starke Arbeitsmotivation zu erhalten, sind präventive Maßnahmen und Bewusstseinsbildung für das Thema Burnout und seine Konsequenzen unerlässlich. Dieser „Healthy-Worker-Effekt“ kann immer dann beobachtet werden, wenn gesundheitliche Indikatoren mit der Altersstruktur der Beschäftigten in Bezug gebracht werden. Berechnungen für die Verlaufsszenarien von Burnout zeigen deutlich, dass damit verbundene volkswirtschaftliche Kosten signifikant höher ausfallen, je später der Diagnosezeitpunkt eintritt (Biffl et al., 2011)2. Da auch die psychosozialen Belastungen mit zunehmender Intensität und Dauer exponentiell steigen, ist eine frühe Intervention somit entscheidend und ein präventiver Ansatz im Bezug auf Burnout, um zu vermeiden, dass eine Erkrankung überhaupt erst auftritt, entwickelt sich demnach zur Schlüsselkompetenz, nicht nur für die Unternehmensführung, sondern auch für jede*n Einzelne*n (Wirtz, 2010).
Trotz der Aktualität des Themas scheint es kaum allgemein anwendbare Lösungsstrategien für diese Problemstellung zu geben. Psychische Belastungsfaktoren innerhalb der Belegschaft von Unternehmen werden im Zuge des BGM überwiegend jährlich als „Snapshot“ mit Selbstbeurteilungsfragebögen, z. B. nach dem Maslach Burnout Inventory (MBI), erfasst. Viele Konzepte nationaler Programme und Initiativen von Wirtschafts- und Regierungsvertretungen zum Burnout-Syndrom in Österreich setzen den Fokus darauf, die im Risikostadium befindlichen älteren Mitarbeiter*innen im Arbeitsleben zu halten beziehungsweise nach überwundener Erkrankung wieder einzugliedern. Spezifische Betrachtungen der stressauslösenden Faktoren für jüngere Mitarbeiter*innen und darauf aufbauende Maßnahmen im Rahmen der Primärprävention sind jedoch in bisherigen Studien wenig behandelt. Gezielte Instrumente zur Fremdbeurteilung oder qualitative Interviewverfahren unter Beachtung von individuellen oder organisationalen Dynamiken und Interdependenzen werden eher selten eingesetzt (BMASK, 2017; BMASK, 2019).
Auf Grund dieser empfundenen Defizite bildet der Zusammenhang zwischen praxisrelevanten Stressfaktoren bei jungen Mitarbeiter*innen und der Effektivität primärpräventiver Maßnahmen zum Zweck der frühzeitigen Vorbeugung von Erschöpfungskrankheiten alias Burnout im Kontext eines Unternehmens den Untersuchungsgegenstand in diesem Buch ab. Sozusagen gilt es, zugehörige Wirkfaktoren bei der Entwicklung vom „Young Talent“ zum „Healthy Worker“ zu erforschen.
1.2. Das Forschungsvorhaben als roter Faden zur Prävention
Aus der beschriebenen Problemstellung und der daraus resultierenden Forschungsidee möchte der Autor der Problematik von praxisrelevanten Stressbelastungen bei jungen Mitarbeiter*innen und der Wirksamkeit gleichzeitig verfügbarer Bewältigungsmaßnahmen in einem Forschungsprozess nachgehen. Der Betrachtungszeitraum dieser Studie bezieht sich dabei in einem Review auf ein aktuelles, repräsentatives Kundenprojekt eines spezifischen IKT-Unternehmens und konzentriert sich vor allem auf die frühe Phase der Primärprävention, das heißt auf mögliche Maßnahmen, die verhindern, dass eine Erkrankung überhaupt auftritt.
Die zu diesem Zweck durchgeführte Praxisuntersuchung wird von folgender Forschungsfrage motiviert:
„Welche Stressfaktoren werden von jungen Mitarbeiter*innen im Rahmen eines Kundenprojektes als besonders belastend empfunden und was sind die Gründe dafür? Inwiefern wird diesen Belastungen nach Einschätzung der Befragten mit den angebotenen primärpräventiven Maßnahmen entsprochen beziehungsweise welche Maßnahmen fehlen oder müssten noch ausgebaut werden?“
Als Zielsetzung soll dieses Forschungsvorhaben in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung von Leistungsfähigkeit und Resilienz innerhalb der Belegschaft eines Unternehmens:
- Die für junge Mitarbeiter*innen praxisrelevanten Stressfaktoren und deren Hintergründe ermitteln.
- Die dazu subjektiv entweder als wirkungsvoll erlebten, fehlend wahrgenommenen oder noch auszubauenden primärpräventiven Maßnahmen im Unternehmenskontext darstellen.
- Etwaige andere in diesem Zusammenhang in Anspruch genommene primärpräventive Maßnahmen (z. B. von externen Institutionen) aufzeigen.
- Basierend auf diesen Ergebnissen entsprechende Handlungsempfehlungen zu zielgerichteten institutionellen oder individuumszentrierten Maßnahmen für das Unternehmen und seine Mitarbeiter*innen ausarbeiten.
Im Zuge der Analyse wurden demnach im ersten Forschungsabschnitt die Erfahrungswerte aus der Praxis erhoben und kategorisiert. Dazu wurden mittels Interviews Praxisreflexionen, basierend auf den individuellen Erfahrungen von jungen Mitarbeiter*innen im Zuge der Projektarbeit, durchgeführt, um die zugehörigen Stressfaktoren und existierenden primärpräventiven Maßnahmen herausarbeiten und kategorisieren zu können. Diese wurden im darauffolgenden zweiten Abschnitt mit den Ergebnissen einer hermeneutischen Analyse zu Theorieaspekten undModellen aus der Literatur abgeglichen, um daraus Schlüsselkategorien zu bilden. In dieser Gegenüberstellung der erhobenen Kategorien konnten etwaige Zusammenhänge oder Gemeinsamkeiten zwischen dem erlangten theoretischen Wissensstand und der individuellen Sicht der Praxisquellen für den spezifischen Unternehmenskontext ermittelt und daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
Da primärpräventive Maßnahmen zu Erschöpfungskrankheiten im Unternehmensumfeld nicht nur als Einzelaspekt, sondern in einem ganzheitlichen Zusammenhang gesehen werden sollten (Fengler & Sanz, 2011), können die Forschungsergebnisse gleichzeitig als Feedback für etwaige Personal- und Organisationsentwicklungsprozesse dienen. Im Idealfall kann diese Arbeit auch einen roten Faden zum Thema der Vorbeugung von Erschöpfungskrankheiten junger Mitarbeiter*innen für die Beratung oder das Management in anderen Unternehmen anbieten.
1.3. Zum weiteren Aufbau und Inhalt des Buches
Im Anschluss an diese Einleitung widmet sich Kapitel 2 zuerst der Einführung in das eigentliche Thema dieses Buches. Dabei wird zum einen die Problematik Stressbelastung und Burnout, zum anderen das Zusammenspiel von Resilienz und Prävention beleuchtet. In weiterer Folge wird der Bezug zur Wirtschaft und den Unternehmen hergestellt, und in Kapitel 3 wird die Thematik für die Ebene der Organisation, der Teams und des Individuums betrachtet und werden erste Kategorien für die weitere Untersuchung aufgezeigt. Kapitel 4 widmet sich der empirischen Forschungsarbeit, Methodik und Design zur qualitativen Erhebung sowie Aufbereitung und Auswertung der in der Praxis analysierten Fälle werden dort beschrieben. Daran anschließend folgt in Kapitel 5 zur Beantwortung der Forschungsfrage zunächst die Betrachtung der Themenschwerpunkte von der Reflexion der Praxisergebnisse und ihrer Gegenüberstellung mit der Theorie hin zu den analysierten Schlüsselkategorien und den dazu erhobenen Stressfaktoren. Anschließend werden Handlungsempfehlungen in Bezug aufprimärpräventive Maßnahmen abgeleitet. Die Interpretation und kritische Diskussion der Forschungsergebnisse sowie Zusammenfassung und Ausblick im Sinne des Ziels der Forschungsarbeit bilden den Schlussteil dieses Buches.
In den Anhängen finden sich ergänzende Zusatzinformationen beziehungsweise Details zur Forschungsarbeit, wie Abstract, Informationen und Tabellen zu den Projektphasen, Interviewleitfäden, Transkriptionen und Kategorientabellen sowie Hilfestellungen für Coaching und Intervention.
1 Verfasser: Österr. Gesellschaft für Arbeitsqualität und Burnout / Anton Proksch Institut Wien.
2 Donau-Universität Krems, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung. Im Auftrag der
2 Donau-Universität Krems, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung. Im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien.
2. Theoretische Hintergründe zum Burnout-Syndrom
Allem voran steht die Theorie. In diesem Kapitel werden unterschiedliche Literaturquellen zum Thema Burnout-Vermeidung analysiert, um einerseits einen Überblick über die derzeitige Sichtweise zu erhalten und andererseits die Praxisuntersuchung starten zu können. Besonderes Augenmerk wurde bei der Auswahl sowohl auf die entsprechende Nähe zum Forschungs...
Inhaltsverzeichnis
- Zu diesem Buch
- Danksagung
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Hintergründe zum Burnout-Syndrom
- 3. Präventionsmöglichkeiten und Interventionsstrategien
- 4. Methodik und Untersuchungsdesign der Forschungsarbeit
- 5. Ergebnisse aus der Forschungsarbeit
- 6. Diskussion und Interpretation der Forschungsergebnisse
- 7. Zusammenfassung und Ausblick
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Anhang 1 – Abstract zur Forschungsarbeit
- Anhang 2 – Untersuchungsplan
- Anhang 3 – Interviewleitfaden
- Anhang 4 – Transkription
- Anhang 5 – Kategoriensystem
- Anhang 6 – Fragen und Hypothesenformen
- Anhang 7 – Interventionsmethoden
- Exkurs – Interkulturelle Kompetenz in der Organisationsentwicklung (Reflexion zur Bedeutung kultureller Vielfalt in Unternehmen)
- Nachwort
- Über den Autor
- Ebenfalls vom Autor erschienen
- Impressum