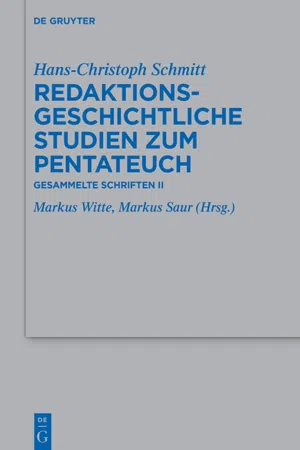
Redaktionsgeschichtliche Studien zum Pentateuch
Gesammelte Schriften II
- 364 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Redaktionsgeschichtliche Studien zum Pentateuch
Gesammelte Schriften II
Über dieses Buch
Ein Charakteristikum der Pentateuchforschung der zurückliegenden 20 Jahre ist das Bemühen um neue literatur- und religionsgeschichtliche Synthesen. Wichtige Impulse dazu kamen und kommen seitens der redaktionsgeschichtlichen Forschung. Zu dieser hat der Erlanger Alttestamentler Hans-Christoph Schmitt (1941–2020) seit seiner 1980 veröffentlichten Habilitationsschrift "Die nichtpriesterliche Josephsgeschichte" in sehr vielfältiger und origineller Weise wesentliche Beiträge geliefert. Der vorliegende Band versammelt 20 Aufsätze, die Schmitt in den Jahren 2003 bis 2020 an unterschiedlichen Orten publiziert hat. Sie zieleln alle auf eine Erhellung des literarischen Wachstums des Pentateuchs und der in ihm vereinten Theologien priesterlicher, deuteronomistischer und weisheitlicher Prägungen. Neben Einzelexegesen prominenter Texte aus den Büchern Genesis, Exodus und Deuteronomium stehen methodologische Auseinandersetzungen mit Tendenzen der jüngsten Pentateuchforschung sowie hermeneutische und theologische Überlegungen zum israelitisch-jüdischen Monotheismus.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Menschliche Schuld, göttliche Führung und ethische Wandlung – Zur Theologie von Gen 20,1 – 21,21* und zum Problem des Beginns des „Elohistischen Geschichtswerks“
Abstract
1 „Elohistische“ Texte in Gen 20 – 22
2 Die Gefährdung der Ahnfrau im Harem Abimelechs (Gen 20*)
3 Die Vertreibung Hagars und Ismaels (Gen 21,8 – 21*)
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Zum Geleit
- Erzvätergeschichte und Exodusgeschichte als konkurrierende Ursprungslegenden Israels – ein Irrweg der Pentateuchforschung
- Menschliche Schuld, göttliche Führung und ethische Wandlung – Zur Theologie von Gen 20,1 – 21,21* und zum Problem des Beginns des „Elohistischen Geschichtswerks“
- „Versuchung durch Gott“ und „Gottesfurcht“ in Gen 22,1.12 und Ex 20,20
- Die Josefs- und die Exodus-Geschichte: Ihre vorpriesterliche weisheitstheologische Verbindung
- Parallel Narrative Patterns between Exodus 1 – 14* and the Ancestral Stories in Genesis 24* and 29 – 31*
- Redaktion und Tradition in Ex 3,1 – 6 – Die Berufung des Mose und der „Elohist“
- Der erstgeborene Sohn Moses als „Blutverschwägerter“ Zipporas – Ex 4,24 – 26 – eine Fortschreibung aus hellenistischer Zeit?
- Die Jahwenamenoffenbarung in Ex 6,2 – 9* und die zwei Zeiten der Landgabe – Zum Ende der Priesterschrift und zu ihrem Zeitverständnis
- Nomadische Wurzeln des Päsach-Mahls? – Aporien bei der Rekonstruktion einer Vorgeschichte der Päsach-Feier von Ex 12,1 – 13*.28
- Wie deuteronomistisch ist der nichtpriesterliche Meerwunderbericht von Exodus 13,17 – 14,31?
- „Das Gesetz aber ist neben eingekommen“ – Spätdeuteronomistische nachpriesterschriftliche Redaktion und ihre vorexilische Vorlage in Ex 19 – 20*
- Die „Sinai-Ouvertüre“ in Ex 19,3b – 9 als nachpriesterliche Verbindung zwischen Pentateuch und Vorderen Propheten – Mal’ak-, Hexateuch- oder Enneateuch-Fortschreibung?
- Das Altargesetz Ex 20,24 – 26 und seine redaktionsgeschichtlichen Bezüge
- „Reue Gottes“ im Joelbuch und in Exodus 32 – 34
- Das sogenannte jahwistische Privilegrecht in Ex 34,10 – 28 als Komposition der spätdeuteronomistischen Endredaktion des Pentateuch
- Die „Ältesten“ in der Exodusüberlieferung und im Aramäischen Briefbericht von Esra 4,8 – 6,15
- „Eschatologie“ im Enneateuch Gen 1 – 2 Kön 25 – Bedeutung und Funktion der Moselieder Dtn 32,1 – 43* und Ex 15,1 – 21*
- Spätdeuteronomistisches Geschichtswerk und Priesterschrift in Deuteronomium 34
- Mose, der Exodus und der Monotheismus – Ein Gespräch mit Jan Assmann
- Register
- Nachweis der Erstveröffentlichung