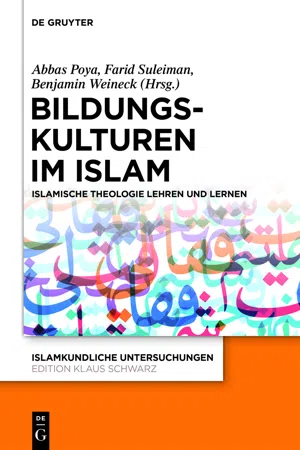
Bildungskulturen im Islam
Islamische Theologie lehren und lernen
- 411 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Bildungskulturen im Islam
Islamische Theologie lehren und lernen
Über dieses Buch
Der Band ist das Ergebnis des Projekts "Islamische Lernkulturen", einer Kooperation zwischen den Universitäten Erlangen und Bayreuth. Die Forschung der Arbeitsgruppe ist von der Grundannahme geleitet, dass Formen und Funktionen der Unterrichtung islamischer Theologie nicht bereits in ihr selbst angelegt sind, sondern vor dem Hintergrund der breiteren geistigen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ausdifferenziert werden. Die Beiträge beleuchten die Lehr- und Lernformen islamischer Theologie in Geschichte und Gegenwart aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen sollen dadurch die unterschiedlichen Kontexte, Ressourcen und Praktiken der theologischen Unterweisung und des Lernens herausgearbeitet werden, zum anderen wird ein Beitrag zur Herausbildung eines reflektierten Selbstverständnisses der Islamischen Theologie in Deutschland geleistet. Dabei kommen muslimische Theologinnen und Theologen unterschiedlichster Ausrichtung ebenso zu Wort wie Islam- und Sozialwissenschaftler/innen. In unterschiedlichen Fallstudien werden Grundlagen von Bildung und Wissen, die Übertragbarkeit islamischer Lehr- und Lernkulturen in das deutsche Wissenschaftssystem, Formen und Funktionen des neuen Faches sowie (politische) Erwartungen daran thematisiert.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Islamische Theologie an deutschen Universitäten – Struktur, Macht, Handlungsfelder
Religiöse Pluralität aus islamisch-religionspädagogischer Perspektive
1 Einführung
In jeder der großen Religionen finden sich recht unterschiedliche Einstellungen zur religiösen Vielfalt. Diese Unterschiede betreffen sowohl die Frage, wie man diese Vielfalt aus der Perspektive der Glaubenslehren der jeweiligen Religionen deuten soll, als auch den praktischen Umgang mit ihr.1
2 Zugänge zum religiös Anderen
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Einleitung
- Prolegomena
- Historische Perspektiven auf islamische Lehr- und Lernkulturen
- Islamische Theologie an deutschen Universitäten – Struktur, Macht, Handlungsfelder
- Autorenverzeichnis