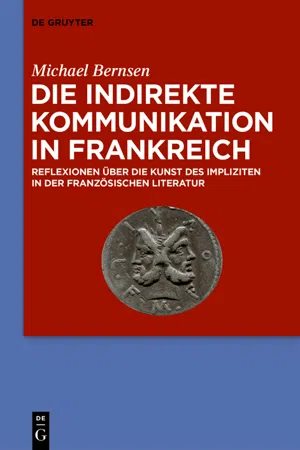Observer […] les sociétés d’une grande ville, assigner le caractère des propos qu’on y tient, y distinguer exactement le vrai du faux, le réel de l’apparent, et ce qu’on y dit de ce qu’on y pense, voilà ce qu’on accuse les Français de faire quelquefois chez les autres peuples, mais ce qu’un étranger ne doit point faire chez eux ; car ils valent la peine d’être étudiés posément.
Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse1
Le bon ton dans le grand monde est, pour les pensées, ce qu’étoit un lit de fer inventé par un tyran ; on coupait les pieds ou la tête de ceux qui y couchoient, quand leur stature le débordait.
Mme Necker (=Suzanne Churchod), Pensées et souvenirs2
Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer – Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie (AHK) mit Sitz in Paris veröffentlicht im Internet einen Leitfaden unter dem Titel „Erfolgreich auf dem französischen Markt -- deutsch-französische Mentalitätsunterschiede“. Die darin beschriebenen Verhaltensmuster französischer Geschäftsleute gegenüber denen ihrer deutschen Partner richten sich vor allem an deutsche Unternehmer, die in Frankreich tätig werden wollen. Genauer werden sechs herausragende Unterschiede beschrieben, die deutschen Geschäftsleuten in Frankreich besonders auffallen. Deren Beachtung gehört für die Verfasserin des Leitfadens zum „Ein-Mal-Eins des interkulturellen Managements“3:
1. Die zentralistische Denkweise in Frankreich: Frankreich ist ein zentralistisches, in den meisten gesellschaftlichen Bereichen vertikal ausgerichtetes Land. Dies lässt sich an der Stellung der Hauptstadt Paris ablesen, auf die sich die wirtschaftlichen Aktivitäten des Landes ganz wesentlich konzentrieren. Dies zeigt sich auch am völlig anderen Führungsstil französischer Manager, die gewohnt sind, Entscheidungen anders als in Deutschland von oben herab zu treffen. Französische Unternehmen sind pyramidal strukturiert: An der Spitze steht der PDG, der Président directeur général, über den alle Entscheidungen eines Unternehmens laufen.
2. Die Bedeutung des persönlichen Kontakts: Dialog und persönliche Beziehungen sind im französischen Geschäftsleben weitaus bedeutender als im deutschen, wo vor allem Kompetenz und Sachlichkeit geschätzt werden. In Verhandlungen und Meetings geht es oft mehr darum, sich als Person in Szene zu setzen, als um eine nüchterne Darstellung von Fakten. Geschäftsfördernd sind somit vor allem Wertschätzungen der Person und der Aufbau persönlicher Beziehungen, denen z. T. zeitaufwändige gemeinsame Gespräche vorausgehen.
3. Die Bedeutung einer guten Beherrschung der französischen Sprache: Die notwendigen persönlichen Kontakte lassen sich nur durch eine möglichst gute Beherrschung der französischen Sprache aufbauen, zumal in Frankreich die Rolle der Landessprache besonders großgeschrieben wird. Dieser wird seit 1994 per Gesetz eine fundamentale Funktion in der französischen Nation zugeschrieben: Sie stellt das kulturelle Erbe par excellence dar und sorgt somit für die Identität der Person4.
4. Die herausragende Stellung von Kultur und Geschichte im französischen Bewusstsein: Frankreich versteht sich spätestens seit dem 17. Jahrhundert nicht nur als Bote der Zivilisation in Europa, sondern misst auch seiner Kultur eine Sonderstellung zu, belegt mit dem über mehrere Jahrhunderte verbreiteten Topos der ‚exception culturelle‘. Daher sind Gespräche über kulturelle Phänomene und ihre Geschichte besonders hilfreich, persönliche Kontakte zu knüpfen und so die Voraussetzungen für erfolgreiche Geschäfte zu schaffen. Dies vor dem Hintergrund, dass die Franzosen ihre eigene Historie in den meisten Fällen mit Stolz als Erfolgs- und Fortschrittsgeschichte empfinden.
5. Die komplizierten Regeln französischer Kommunikation: Die französische Kommunikation ist traditionsbedingt stark mündlich geprägt. Sie ist dadurch erheblich ausschweifender als die deutsche, die stärker auf die Vermittlung von Informationen ausgerichtet ist. Französische Kommunikation ist auch erheblich indirekter als die deutsche, die auf Klarheit und Sachlichkeit abzielt. Die Subtilitäten französischer Kommunikation, oftmals eine Kunst des Impliziten, zu durchschauen und zu beherrschen, ist somit eine der größten Herausforderungen in der interkulturellen Begegnung zwischen Deutschen und Franzosen.
6. Die Andersartigkeit im Umgang mit der Zeit: Aus den bereits genannten Punkten lässt sich erschließen, dass man in Frankreich eine andere Einstellung zur Zeit mitbringt. Änderungen von Zeitplanungen sind gängig und verlangen ein Improvisationsvermögen der Beteiligten. Rigide Tagesordnungen sowie exakte Planungen von Zeitabläufen stehen dem französischen Bedürfnis entgegen, die Dinge sich im Gespräch entwickeln zu lassen und Themen oftmals langatmig einzukreisen.
Nun kann man es – wie dies Managerhandbücher in der Regel tun – mit diesem rudimentären Wissen über die Andersartigkeit französischer Verhältnisse gegenüber den deutschen bewenden lassen, wenn man die Unterschiede einmal wahrgenommen hat und in der täglichen Praxis berücksichtigt. Es ist jedoch gerade im Umgang mit französischen Partnern von großem Vorteil, wenn man die Ursprünge der seit langem existierenden Unterschiede genauer kennt und diese in ihre historischen Entwicklungen einordnen kann. Dies ist umso mehr von Vorteil, da Frankreich ein Land ist, welches auf seine ‚exception culturelle‘ schon immer einen großen Wert gelegt hat und dieser sogar im Alltagsbewusstsein der Franzosen eine erhebliche Rolle einräumt. Kulturelle Fragen sind von großer Bedeutung und historische Kenntnisse dieser Kultur werden in der Zusammenarbeit mit Franzosen von diesen äußerst goutiert. Die Cinquième République der Nachkriegszeit hat unter ihrem Kulturminister André Malraux aktiv auf den Bereich einer kulturell geprägten Innen- und Außenpolitik gesetzt, um Frankreich auch weiterhin den Status der ‚exception culturelle‘ zu erhalten. Dieser Ansatz wurde von dem sozialistischen Kulturminister Jacques Lang in den achtziger Jahren aufgegriffen. Auch Präsident Emmanuel Macron stellt sich in diese Tradition. Ein historisches Wissen über die Entstehung und die lang verfestigten mentalen Grundeinstellungen ist somit auch praktisch höchst wertvoll, um Zugang zu französischen Verhandlungspartnern zu erhalten, und das vor allem vor dem Hintergrund der Besonderheit, dass persönliche Beziehungen in Frankreich eine herausragende Rolle spielen.
Die Analyse des Verhaltens französischer Partner lässt sich erheblich weiter vertiefen als es die Managerhandbücher tun. Die eingangs genannten sechs Punkte hängen nämlich unmittelbar miteinander zusammen. Die beobachteten Einstellungen und Verhaltensweisen haben sich in einer besonderen historischen Situation aufgrund spezieller struktureller Veränderungen herausgebildet. Der französische Zentralismus formiert sich über einen historischen langen Zeitraum seit dem Mittelalter, genauer seit dem 13. Jahrhundert, und wird strukturell mit der Entstehung des absolutistischen Machtstaates im 17. Jahrhundert verfestigt. Die vertikal-zentralistischen Strukturen der Gesellschaft dieser Epoche bedingen eine Entwicklung der Sprache, welche einheitlichen Regeln unterworfen wird. Durch die Konzentration des Lebens der französischen Oberschicht am Hof von Versailles und in den Salons von Paris entsteht zugleich eine herausragende Kultur, die für ganz Europa zum Vorbild wird. In dieser Gesellschaft, die sich vor allem über ihre kulturellen Leistungen definiert, bildet sich naturgemäß ein besonderes, entspanntes Verhältnis zur Zeit heraus. Und letztlich – dies ist das auffälligste Merkmal französischen Verhaltens – haben die vertikalen Strukturen der Gesellschaft unmittelbare Auswirkungen auf die Art und Weise der Kommunikation: Insbesondere in den Salons entwickelt sich ein Umgang miteinander, der auf eine spielerische Weise nicht nur die kulturelle Ausnahmestellung der einzelnen Gesprächspartner sondern in der Konsequenz des Landes zur Geltung bringt. Die Klarheit der diatopisch und diaphasisch geregelten Sprache in Kombination mit dem rationalistischen anthropologischen Modell des Descart’schen ‚cogito ergo sum‘ ermöglicht gleichsam kompensatorisch die Verwendung indirekter Formen der Kommunikation. Diese können spielerisch-ästhetische Funktionen ausfüllen oder der Sicherung der Person qua Verstellung in hierarchisch-vertikal geprägten Situationen dienen. Die Konversation eröffnet dem Einzelnen die Möglichkeit, sich als perfekter ‚honnête homme‘ zu beweisen, der maßgebliche Persönlichkeitsideale wie die ‚civilité, die ‚politesse‘ oder die ‚grâce‘ verkörpert. Er kann sich als eine Persönlichkeit zeigen, die sich einerseits durch eine geschickte Art und Weise der indirekten Kommunikation den zentralen Geboten der ‚bienséance‘ stellt oder sich andrerseits diesen Geboten per Verstellung entzieht oder widersetzt. Die indirekten Formen der Kommunikation werden zum Maßstab des Verhaltens, die über den Bereich der Freizeit hinaus auch den Umgang im geschäftlichen Bereich und sogar der wissenschaftlichen Auseinandersetzung bestimmen. Die indirekte Form der Äußerung ist gattungsübergreifend; sie betrifft vor allem die Konversation, aber auch den ‚entretien‘5 oder den Dialog. Die indirekte Kommunikation in Frankreich ist nicht nur ein Gebot der Höflichkeitsregeln, die in zahlreichen Traktaten des 17. Jahrhunderts diskutiert werden. Sie ermöglicht die Anreicherung der Gespräche mit kulturellen Inhalten in einer Sprache, auf deren Bedeutung schon die Zeitgenossen des 17. Jahrhunderts großen Wert gelegt haben.
Das Bewusstsein einer solchen kulturellen Besonderheit Frankreichs wird selbst zum Thema der Konversationen im 17. Jahrhundert. Die Konversation ist, wie es Marc Fumaroli in mehreren Arbeiten formuliert, „le genre des genres“6, da die Gesellschaft im 17. Jahrhundert wesentlich auf der mündlichen Kommunikation beruht. Fumaroli sieht in der Konversation des 17. Jahrhunderts eine herausragende literarische Gattung der Oralität. Im Übergang zum 18. Jahrhundert verlagert sich die mündliche Konversation dann hin zur Schriftlichkeit. Autoren wie Voltaire haben die Regeln der Konversation, die dort verwendete Sprache sowie die Art und Weise des indirekten Sprechens zum Vorbild für die schriftliche Literatur erklärt, die dann ihrerseits Normen für eine Bildung schafft, an denen sich die französische Gesellschaft und der Staat in der Schulausbildung seit dem 19. Jahrhundert orientieren. Die vorliegende Studie geht der historischen Entstehung der genannten mentalen Einstellungen und der Verhaltensweisen der Kommunikation in Frankreich nach. Sie tut dies an literarischen Beispielen und das vor allem aus zwei Gründen:
1. Es ist vor allem die Literatur, die Konversationen übermittelt, wie sie in älteren Epochen geführt worden sind. Die Literatur ist das Medium, in dem Gespräche nicht nur konserviert, sondern darüber hinaus in all ihren Aspekten reflektiert werden. Für die Fokussierung auf die Literatur als Untersuchungsgegenstand gibt es weitere überzeugende Gründe. Grundsätzlich gilt, dass Literatur den Leser zum Nachdenken anregen will, ohne unidirektionale Antworten zu liefern und programmatische Aussagen zu treffen. Aus diesem Grund hat der Europarat 2008 in seiner Empfehlung 1833 mit dem Titel Förderung des Unterrichts in europäischer Literatur in Abs. 3 festgestellt: „Eine Sprache zu kennen bedeutet mehr als sie zu Kommunikationszwecken zu beherrschen. Die Kenntnis großer Werke der Literatur bereichert das Denken und gibt dem Leben mehr Sinn.“7 Die Kenntnis der Literatur anderer Nationen, deren Sprache die Schule vermittelt, wird in der Empfehlung als besonders geeignet angesehen, interkulturelle Kompetenz – in den Worten der Empfehlung „europäische[n] Bürgersinn“ – zu lehren: „Das Erlernen anderer europäischer Sprachen und die Bekanntschaft mit ihrer Literatur können dazu beitragen, europäischen Bürgersinn zu vermitteln.“ Dies gilt im Besonderen für den hier verhandelten Fall der indirekten Kommunikation.
2. Zwischen der mündlichen Konversation, die in Frankreich stark vom indirekten Sprechen geprägt ist, und der Literatur im Sinne von ‚Wort-Kunst‘ besteht eine enge Verbindung: Literatur hat per definitionem mit indirekten Formen der Äußerung zu tun. Sie lebt von vielfältigen Möglichkeiten der Einkleidung der Gedanken in Worte, wovon schon Cicero in seinen Schriften zur antiken Rhetorik gesprochen hatte8. Im Mittelalter wird dieses eher rhetorisch-technische Verständnis substantialisiert: So sah man die Bibel als Wort Gottes mit gleich vier Schriftsinnen ausgestattet, die in der Allegorese, der Auslegung der Schrift, herausgelesen werden. Die weltliche Literatur gilt als semantisch mehrschichtige Rede; sie beinhaltet, so die Auffassung von Macrobius in seinem Kommentar zu Ciceros Somnium Scipionis in ihrer Erzählung, der ‚narratio fabulosa‘, verborgene Wahrheiten. Ihre Rede ist ein ,integumentum‘ bzw. ‚involucrum‘, d. h. ihre Aussagen sind durch Formen indirekten Sprechens verhüllt. Mit dieser Auffassung hatte die ‚École de Chartres‘ im 1...