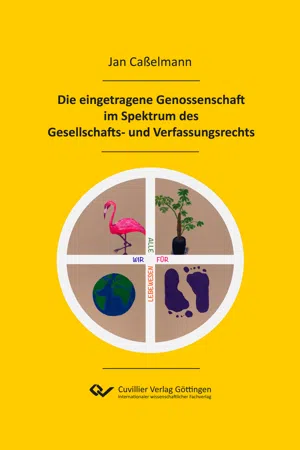
- 322 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Welche Bedeutsamkeit wollen wir Werten wie kollektiver Selbsthilfe, Verwaltungsautarkie, Freiheit, Gleichheit oder Demokratie in Bezug auf unsere privatautonom gestaltbare Lebensführung zumessen? Wer diese philosophische Frage rechtlich interpretieren möchte, muss auf das Gesellschaftsrecht und mittelbar auch auf das Verfassungsrecht schauen. Denn das Gesellschaftsrecht regelt das rechtliche Können innerhalb unserer Gesellschaftsformen. Das Verfassungsrecht wiederum gibt ein Mindest- sowie ein Übermaß an Regelung vor. Die eG ist eine außergewöhnliche Gesellschaftsform und ihr Konzept stark an den oben genannten Werten orientiert. Das verrät bereits ein Blick in § 1 GenG, wonach die Förderung der Mitglieder als gesetzlich manifestierte Zwecksetzung verankert wird. Die Förderwirtschaft sowie andere Essenzen der eG laufen Gefahr – vor dem Hintergrund eines vorherrschend kapitalwirtschaftlich orientierten Anpassungsdrucks – abgeschafft bzw. bis zur Unkenntlichkeit aufgeweicht zu werden. Die vergleichsweise Darstellung besonderer Eigenarten der eG, ob und inwieweit die Legislative zu Wesensveränderungen bemächtigt ist und was aus verfassungsrechtlicher Sicht Bestandsschutz genießt oder genießen sollte, erörtert der Verfasser in dieser Arbeit.What significance do we want to attach to values such as cooperative self-help, administrative self-sufficiency, freedom, equality or democracy in relation to our autonomous lifestyle as one of many indivduals?Anyone who wants to interpret this philosophical question in legal terms has to take a look at corporate law and, indirectly, to constitutional law. For corporate law regulates the legal ability within our corporate forms. Constitutional law specifies, in turn, a minimum as well as an excess of regulation.The eG is an exceptional corporate form and its concept is strongly oriented towards the values mentioned above. This reveals a glance at § 1 GenG, according to which the promotion of the members via cooperational self-help is anchored as a legally manifested purpose. This foundational principle as well as other essences of the eG are in danger of being abolished or softened beyond recognition against the backdrop of a predominantly capital-economy oriented pressure to adapt.In this paper, the author discusses the special characteristics of the eG in comparison to other german national legal forms, whether and to what extent the legislature is empowered to change its nature, and what enjoys or should enjoy constitutional protection.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil 1: Grundlagen des Genossenschaftsgesetzes und der eingetragenenGenossenschaft als Rechtsform
- § 1 – Eine Bestandsaufnahme der eingetragenen Genossenschaft
- A. Das genossenschaftliche Verbandswesen – ein bundesweiter Förderkreislauf
- B. Eingetragene Genossenschaften als Faktor in der Volkswirtschaft
- I. Finanzsektor
- II. Landwirtschaft
- III. Gewerblicher Handel und Dienstleistungen
- IV. Sonstige Branchen
- V. Resümee
- C. Genossenschaften im internationalen Rechtsverkehr
- I. Internationale Ebene
- II. Europäische Ebene
- D. Resümee
- § 2 – Rechtshistorische Wurzeln des Genossenschaftsgesetzes
- A. Frühzeitliche genossenschaftliche Formen
- B. Rechtsgeschichtliche Grundlagen von der Frühzeit bis ins Mittelalter
- C. Die Entwicklung der Wirtschaft und des freien Markts als zentraler Faktor für dieEntstehung des Gesellschaftsrechts
- I. Gebremste Geldwirtschaft im Mittelalter
- II. Entstehung der Banken und Kapitalwirtschaft als Grundlage für den industriellenFortschritt und die vertragliche Gestaltung des Handels
- III. Wandel der gesellschaftlichen Strukturen durch staatliche Beteiligung an der Wirtschaft
- IV. Verfassungsgeschichtlicher Hintergrund
- D. Die Verrechtlichung des genossenschaftlichen Konzepts
- I. Die Vorstufe der Kodifizierung: Die Industrialisierung der führenden europäischenWirtschaftsstaaten
- II. Ausgangspunkt der Kodifizierung des Genossenschaftsgesetzes und die Anfänge desVerbandswesens
- E. Resümee
- § 3 – Grundlagen des Genossenschaftsgesetzes
- A. Die konzeptionelle Prägung der eG
- I. Der rechtliche Genossenschaftsbegriff
- II. Die konzeptionelle Prägung durch den überpositiven Genossenschaftsbegriff
- I. Der rechtliche Genossenschaftsbegriff
- II. Die konzeptionelle Prägung durch den überpositiven Genossenschaftsbegriff
- B. Die Merkmale des § 1 I GenG als integrale Regelungsstrukturen desGenossenschaftsgesetzes
- I. Die Zielsetzung der eingetragenen Genossenschaft: Förderung der Mitglieder durchgemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb
- II. Offenes Mitgliedschaftsverhältnis
- C. Die Gründung, Organisationsverfassung und Willensbildung
- I. Gründung und Gründungsvoraussetzungen
- II. Organstruktur und Willensbildung
- D. Die Mitgliedschaft
- I. Erwerb der Mitgliedschaft
- II. Rechte und Pflichten
- III. Genossenschaftsrechtliche Mitgliedschaftsgrundsätze
- E. Die Haftungs- und Finanzverfassung
- I. Die Haftungsverfassung
- II. Die Finanzverfassung
- F. Das Prüfungswesen
- I. Pflichtmitgliedschaft und Pflichtprüfung
- II. Genossenschaftliche Prüfungsverbände
- G. Die Umwandlung, Auflösung und Beendigung
- I. Umwandlung
- II. Auflösung und Beendigung
- H. Resümee
- Teil 2: Die eingetragene Genossenschaft im Vergleich mit anderen nationalenRechtsformen
- § 4 – Einordnung der eingetragenen Genossenschaft im System des nationalenGesellschaftsrechts
- A. Das Gesellschaftsrecht als rechtliche Dachstruktur
- B. Personengesellschaften und Körperschaften
- I. Wesensgehalt und charakteristische Unterschiede
- II. Das gesellschaftsrechtliche Spannungsverhältnis zwischen Typenzwang undVertragsfreiheit
- III. Vorblick auf die verfassungsrechtliche Relevanz der Grundtypen
- C. Resümee – Einordnung der Genossenschaft in das System der Personengesellschaftenund Körperschaften
- § 5 – Gesetzlicher Vereinigungszweck
- A. Systematik
- B. Rechtsformen mit universeller Zweckvorgabe
- I. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts
- II. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- III. Die AG
- C. Rechtsformen mit beschränkter Zweckvorgabe
- I. Die Personenhandelsgesellschaften
- II. Nichtwirtschaftliche und wirtschaftliche eingetragene Vereine
- III. Bereichsspezifische Sonderformen
- D. Resümee
- § 6 Gründung
- A. Systematik
- I. Personengesellschaften
- II. Körperschaften
- B. Gründungsvoraussetzungen
- I. Personengesellschaften
- II. Körperschaften
- C. Auswirkungen von Gründungsfehlern
- I. Grundsatz der fehlerhaften Gesellschaft
- II. Personengesellschaften
- III. Körperschaften
- D. Resümee
- § 7 Willensbildung und Organisationsgewalt
- § 7 Willensbildung und OrganisationsgewaltA. Systematik
- I. Strukturelle Unterschiede zwischen Personengesellschaften und Körperschaften – Prinzipder Selbst- und Fremdorganschaft
- II. Grundlagengeschäfte und die allgemeine Geschäftsführungsbefugnis
- III. Die Beschlussfassung
- IV. Mittelbare Willensbildung durch Kontroll- und Informationsrechte
- V. Resümee
- B. Willensbildung im Vergleich
- I. Personengesellschaften
- II. Körperschaften
- III. Mittelbare Einwirkung
- C. Resümee
- § 8 Mitgliedschaft
- A. Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft
- I. Personengesellschaften
- II. Körperschaften
- B. Mitgliedschaftsrechte und -pflichten
- I. Personengesellschaften
- II. Körperschaften
- III. Allgemeine Rechte und Pflichten
- C. Resümee
- § 9 Haftungsverfassung
- A. Systematik
- I. Haftungssubjekte
- II. Unbeschränkte oder beschränkte Haftung im System der Personengesellschaften undKörperschaften
- III. Innen-, Außen- und Durchgriffshaftung
- IV. Das Verhältnis von Haftung und Entstehung der Personenvereinigungen – Haftung beiVorgesellschaften
- B. Die Haftungsverfassungen im Vergleich
- I. Personengesellschaften
- II. Körperschaften
- C. Resümee
- § 10 Finanzverfassung
- A. Grundlagen und Systematik
- B. Grundlagen der Finanzverfassungen im Vergleich
- I. Die Kapitalaufbringung
- II. Kapitalerhaltung
- C. Resümee
- § 11 Steuerrecht
- A. Grundlagen und Systematik des Steuerrechts – Gesellschaftsrechtliche Relevanz
- I. Unterschiedliche Systematik in der Besteuerung von Personengesellschaften undKörperschaften
- II. Reformen der Unternehmensbesteuerung zielen auf rechtsformneutrale Besteuerung
- III. Rechtsquellen für die Besteuerung von Unternehmen
- B. Genossenschaftsrechtliche Besonderheiten bei der rechtsformabhängigen Besteuerung
- I. Einkommen-, Körperschafts- und Gewerbesteuer
- II. Sonstige Unternehmenssteuerarten
- C. Resümee
- § 12 Rechnungslegung, Prüfung und Publizität
- A. Grundlagen und Systematik
- I. Allgemeine Regelungen zur Rechnungslegung
- II. Spezielle Regelungen für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften
- B. Die Grundlagen des Rechnungslegungs-, Prüfungs- und Publizitätswesens im Vergleich
- I. Personengesellschaften und Vereine
- II. Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften
- C. Resümee
- § 13 Umwandlung und Beendigung
- A. Umwandlung
- I. Systematik
- II. Besonderheiten der genossenschaftlichen Rechtsform im Umwandlungsrecht
- B. Auflösung, Abwicklung und Beendigung
- I. Systematik
- II. Die Auflösungs- und Liquidationsvorschriften im Vergleich
- C. Resümee
- § 14 Resümee Teil 2
- Teil 3: Die Verfassungsmäßigkeit des Genossenschaftsgesetzes
- § 15 Die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen der Gesetzgebung
- A. Die Gesetzgebung als Kernaufgabe der Legislativgewalt
- II. Das Spannungsfeld zwischen Gesetzgebung und Judikative
- B. Die grundrechtliche Bindungswirkung als maßgebliche Begrenzung der Gesetzgebungund verfassungsgerichtlichen Kontrolle
- I. Das Übermaßverbot als (Ober)Grenze
- II. Das Untermaßverbot als (Unter)Grenze
- III. Weitere Obliegenheiten des Gesetzgebers
- IV. Zwischenresümee
- C. Die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers
- I. Grundlegendes
- II. Pflichten zur Darlegung der Prognosebasis innerhalb der Entscheidungsprärogative
- III. Beobachtungs- und Nachbesserungspflichten des Gesetzgebers
- D. Resümee
- § 16 Verfassungsrechtliche Normen mit gesellschaftsrechtlicher Relevanz
- A. Zuordnung zu grundrechtlichen Normenkomplexen
- I. Das Gesellschaftsrecht im System der Rechtsordnung
- II. Üblicherweise tangierte Rechtsgüter
- III. Anwendbarkeit der Grundrechte auf juristische Personen i.S.d. Art. 19 III GG
- B. Der abstrakte Normgehalt einzelner Grundrechte in Bezug auf gesellschaftsrechtlicheThemenkomplexe / Rechtsprechung des BVerfG zu Grundrechten mitgesellschaftsrechtlichem Bezug
- I. Art. 9 I GG - Vereinigungsfreiheit
- II. Art. 14 I GG – Eigentumsfreiheit
- III. Art. 12 I GG - Berufsfreiheit
- IV. Art. 2 I GG – Allgemeine Handlungsfreiheit
- V. Art. 3 I GG – Gleichheitssatz
- VI. Die Staatsstrukturprinzipien
- C. Resümee
- § 17 Einfluss des internationalen und ausländischen Rechts auf die Gestaltung desnationalen Gesellschaftsrechts
- A. Generelle Einwirkungsmöglichkeiten internationalen und ausländischen Rechts in diedeutsche Rechtsordnung
- B. Internationales Gesellschaftsrecht als Kollisionsrecht
- I. Gründungs- und Sitztheorie
- II. Konsequenzen für den nationalen Gesetzgeber
- III. Resümee
- C. Das europäische Gesellschaftsrecht
- II. Harmonisierungsbestrebungen durch europäische Richtlinien
- III. Rechtsangleichung durch supranationale Rechtsformen und europäische Verordnungen
- D. Resümee
- § 18 Die Verhältnismäßigkeit des Genossenschaftsrechts am Maßstab desGesellschaftsrechts
- A. Abstrakte Mindestanforderungen für den Gesetzgeber
- I. Feststellung der Mindestanforderungen
- II. Das Spektrum interferierender Verfassungsgüter im Rahmen einer Gesamtbetrachtungdes deutschen Rechtsformenensembles
- B. Leitsätze des Gesetzgebers bei der Gestaltung des Gesellschaftsrechts
- C. Spezifische Bewertung in Bezug auf das Genossenschaftsgesetz
- I. Begrenzung auf den Förderzweck gem. § 1 I GenG
- II. Organisationsstrukturelle Ausgestaltung
- D. Einhaltung der verfassungsmäßigen Mindestanforderungen
- Resümee und Fazit
- Literaturverzeichnis