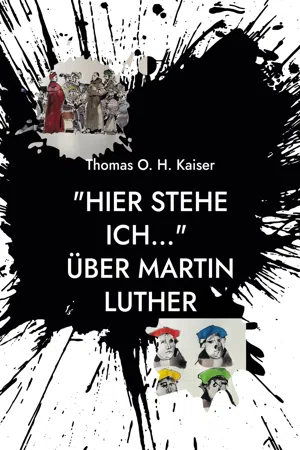
"Hier stehe ich..." Über Martin Luther
Eine persönliche Annäherung an den Reformator. Mit einem Personenverzeichnis und einem Glossar
- 492 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
"Hier stehe ich..." Über Martin Luther
Eine persönliche Annäherung an den Reformator. Mit einem Personenverzeichnis und einem Glossar
Über dieses Buch
Das vorliegende Buch über Leben und Werk Martin Luthers (1483-1546) erscheint in dem Jahr, in dem sich nicht nur der Todestag des Wittenberger Reformators zum 475. Mal jährte, sondern in das auch das Datum der 500. Wiederkehr des Reichstags zu Worms fiel. In Worms hatte sich Luther einst geweigert, vor dem mächtigen Kaiser Karl V. und den Reichsständen seine Ideen, mit denen er die mächtige römisch-katholische Kirche erschüttert hatte und die evangelische Kirche begründete, zu widerrufen. Einige sehen deshalb nicht den Anschlag der 95 Thesen, sondern Luthers Verhör in Worms als das eigentliche Gründungsdatum der evangelischen Kirche an.Der Autor geht auf das Leben und das Denken Martin Luthers ein. Er erläutert dessen Theologie, die Theologie seiner Widersacher und die Veränderungen, die die Reformation für die Gesellschaft mit sich brachte. Ausführlich berücksichtigt er die einzelnen Stationen im Leben Luthers. Dabei spart er auch die Schattenseiten der Reformationszeit im Allgemeinen und Martin Luthers im Besonderen nicht aus.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
1. Einleitung
Inhaltsverzeichnis
- Widmung
- Motto
- Vorwort
- Abkürzungsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. In Eisleben und Mansfeld
- 3. In Erfurt
- 4. In Wittenberg
- 5. Im Konflikt mit Kirche und Obrigkeit
- 6. Auf der Wartburg
- 7. Im Konflikt mit radikalen Reformatoren
- 8. Zurück in Wittenberg
- 9. Luthers Tod in Eisleben
- 10. Mit Luther über Luther hinaus
- Zeittafel allgemein
- Zeittafel zu Martin Luther
- Zeittafel zu Philipp Melanchthon
- Zeittafel zu Thomas Müntzer
- Personenverzeichnis
- Glossar
- Literaturverzeichnis
- Über den Autor
- Über den Künstler und die Bilder
- Impressum