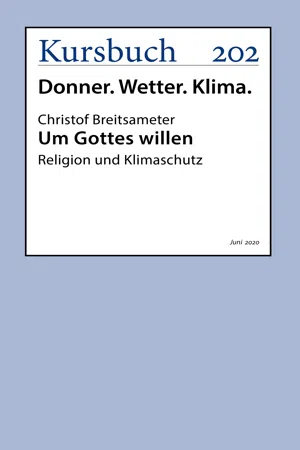![]()
Christof Breitsameter
Um Gottes willen
Religion und Klimaschutz
Der strafende Wettergott
Donner. Wetter. Klima. Das sind – man möchte es nicht für möglich halten – Stichworte einer theologischen Debatte, die sich zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert, übrigens konfessionsübergreifend, zutrug. Genauer gesagt ging es mehr um den Blitz als um den Donner und mehr um das Unwetter als um das Wetter. Das Klima bildete eine Art von Hintergrundrauschen zu alledem: Die Auswirkungen der »kleinen Eiszeit« seit etwa 1570 stellten die Prediger vor die Aufgabe, zu erklären, warum Gott die Menschen härter bestraft als zuvor. Offenbar sündigten die Menschen schwerer, so die Theologen, weshalb auch die göttliche Strafe heftiger ausfallen müsse.
Eine zentrale Stellung in diesem Diskurs nahm das Phänomen ein, das am konkretesten und unmittelbarsten wirkte, nämlich das Gewitter, weniger weil es das Leben eines Menschen auszulöschen vermochte, vielmehr weil durch einen plötzlichen Tod, der keine Zeit mehr dafür ließ, sich auf das nahe Ende vorzubereiten, das ewige Leben in Gefahr stand. Wettergebete, Wetterpredigten und Wettertraktate liefern, wie Heinz D. Kittsteiner in einer detaillierten Untersuchung darlegt, heute noch Anhaltspunkte für die damalige Furcht vor einem überraschenden Ende, der sogenannten mors repentina. Vermochte ein Gewitter den Menschen unvorbereitet zu treffen, war er fast sicher ein Kandidat für die Hölle, andernfalls war es ihm eine Warnung, zu Gott umzukehren, um in den Himmel zu gelangen. Das Gewitter konnte ein sündiges Leben allerdings nicht nur von einem Augenblick auf den anderen beenden, es konnte schon zu Lebzeiten davor warnen, das ewige Leben nicht zu verwirken: Es hat also nicht nur strafende, sondern auch mahnende Funktion. Gott, so sagte man, kenne zweierlei Wege der Verkündigung: Der eine erfolgt durch die Prediger, die das Wort Gottes von der Kanzel an alle Bußwilligen richten; der andere durch die Bußpredigt der Natur, also durch das Gewitter.
Wo die Kirchen in dieser Weise zurechneten, bildeten sich im Volk Gegenstrategien und bei den Kirchen wiederum Gegengegenstrategien heraus: Die Menschen überlegten, ob Blitz und Donner, statt von Gott, nicht in Wirklichkeit vom Teufel und seinen Hexen gesandt seien (es kam deshalb auch tatsächlich zur Verfolgung von Hexen). Die Ursache des bösen Treibens der Natur konnte auf diese Weise vom Menschen weg, hin zum Bösen und allen, die ihn bei seinem Treiben unterstützen, verlagert werden. Die Theologen wandten dagegen wiederum ein, Gott sei der Herr des Gewitters. Der Mensch dürfe seine Schuld nicht auf andere Kräfte abwälzen, sondern müsse selbst Verantwortung übernehmen. Allerdings bestand die Folgelast dieser Begründung darin, dass Gott nun für das Gewitter und alles Unheil, das damit angerichtet wurde, verantwortlich gemacht werden konnte. Manche ließen sich sogar zu der Aussage hinreißen, der Teufel und seine Helfer agierten im Namen Gottes. Akademisch gedämpfter erschien die Lösung, Gott lasse das Walten böser Geister nur zu, denn, so konnte angeführt werden, schuld daran sei doch schließlich der in Freiheit sündigende Mensch. Würde er nicht sündigen, hätte Gott einen Grund, dem Treiben der unheilvollen Kräfte Einhalt zu gebieten.
Doch beließ man es nicht bei solchen Mahnungen. Es wurden eine Reihe von Hilfsmitteln angeboten, um der göttlichen Strafe zu entgehen: Zunächst ist es das protestantische Wettergebet, das Hilfe verspricht, das katholischerseits freilich Konkurrenz durch den Wettersegen und andere magische Hilfsmittel wie Glockenschall und Kerzenschein bekommt. Auch wenn der Christ nach Ansicht der Theologen Verantwortung für den Zustand der Welt, also auch für das Unwetter übernehmen soll, steht nicht die langfristige sittliche Verbesserung des Menschen und damit auch des Wetters und der klimatischen Verhältnisse im Vordergrund, sondern die eschatologische Perspektive, rechnete man doch mit dem baldigen Ende der Welt, sodass es für ...