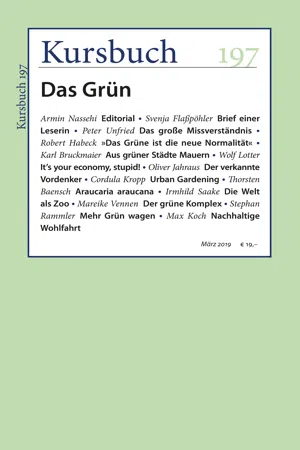![]()
Stephan Rammler
Mehr Grün wagen
Grüne Verkehrspolitik zwischen Nachhaltigkeit und Kulturkampf
Wir leben in bewegten Zeiten. Wir bewegen uns räumlich mehr als jemals zuvor und zeitlich so schnell wie noch nie. Ein kurzer Blick in die Verkehrsgeschichte zeigt bereits für die vormodern-organischen Zeiten massive Eingriffe in natürliche Lebensräume zum Zwecke der Ermöglichung immer besserer und schnellerer Raumüberwindung und Raumbeherrschung. Angefangen bei der Domestizierung großer Reit- und Zugtiere und der damit verbundenen Umwandlung von ursprünglichen Naturräumen in Gras- und Weidelandschaften über den antiken Straßenbau bis hin zu den riesigen Flotten von aus Holz gebauten Schiffen der alten Chinesen, der antiken Seefahrervölker des Mittelmeerraumes und der Kriegs- und Handelsmarinen der frühen Neuzeit, die in der Entwaldung und dauerhaften ökologischen Veränderung von Landflächen und einen Umbau natürlicher Küstenlinien in Hafeninfrastrukturen mündete – immer schon führte der Wunsch nach Erleichterung und Beschleunigung der Raumüberwindung zu »Zurichtungen«, je nach Lesart auch zu »Zerstörungen« bei der Umwandlung ursprünglicher Naturräume in mobilisierte Kulturräume.
Mit Eintritt in die fossil-mechanische Epoche spitzt sich dieses prinzipiell problematische Naturverhältnis der Raumüberwindung nur noch weiter zu. Es kommt zu einer neuen, globalen Dimension der Eingriffe in die natürlichen Ökosysteme vor allem durch die Emissionen von im Brennstoff gespeichertem CO2 und weiteren sogenannten Luftschadstoffen. Doch nicht nur die Antriebe der Verkehrsmittel, auch die für ihren Betrieb notwendigen Infrastrukturen hinterlassen ihre Spuren. Häfen, Straßen, Parkplätze, Schienen, Bahnhöfe, schließlich Flughäfen und Raumbahnhöfe markieren den immer materialintensiver werdenden und deswegen mit immer größeren ökologischen Rucksäcken belasteten Weg in die Technisierung der Mobilität. Die großtechnischen Systeme der verschiedensten Verkehrsinfrastrukturen verbinden sich heute zu einem globalen Metasystem der Mobilität und sind sichtbarster Ausdruck des Umbaus der Welt zur Beschleunigungsarena, die mit ihren Lichtspuren stets und ständig das Gewebe unserer mobilen Zivilisation in den Nachthimmel schreibt.
Es scheint also, als könne die globale Moderne nur mit einem Höchstmaß an Beschleunigung und Mobilisierung funktionieren. Es scheint, als wären Mobilität und Modernisierung wahlverwandt, zwei Seiten einer Medaille, nur zusammen ganz, funktional und stabil. Zugleich wachsen die ökologischen und sozialen Kosten dieser – je nach Sichtweise – (un)heiligen Allianz so stetig und intellektuell unabweisbar ins Unermessliche, dass nur Ignoranz oder bewusste Verleumdung und Bigotterie dieser Einsicht standhalten können.
Vor diesem allgemeinen Hintergrund zeigt sich Anfang 2019 in der verkehrspolitischen Diskurslage in der Bundesrepublik ein verworrenes, widersprüchliches und vielschichtiges Bild. Dieselskandal, CO2-Emissionen, Elektromobilität, Fahrverbote und Tempolimits auf Autobahnen kumulieren sich in der jüngsten Einschätzung eines großen Nachrichtenmagazins sogar zur These eines »automobilen Kulturkampfes«. Die Einzelthemen sind dabei sehr unterschiedlich, vereint sind sie aber in ihrer Anzeigefunktion als Senkbleie in die Tiefen einer seit Jahrzehnten ganz grundsätzlich vermurksten Debatte. Die Einschätzung des Kulturkampfes ist nicht unplausibel. In kaum einem anderen Politikfeld werden wie in diesem die mit der modernen fossilen Mobilität verbundenen Wohlstands- und Freiheitsversprechen regelmäßig zu machtpolitischen Vehikeln in den Arenen parteipolitischer Zukunftssicherung. Wenn Verkehrsminister Andreas Scheuer davon spricht, ein Tempolimit stünde gegen jede Form des gesunden Menschenverstandes, dann schielt er gleichermaßen auf die strukturkonservativen Wähler im ländlichen Niederbayern wie auf die Industriearbeiter als auch die Manager bei BMW und Audi. Scheuer kann bislang als einer der schlechtesten Verkehrsminister in der Geschichte der Bundesrepublik gelten. Und das will etwas heißen angesichts einer knapp eine Dekade andauernden »Ingeiselhaftnahme« der deutschen Verkehrs- und Infrastrukturpolitik durch bayrische Sonderinteressen. Scheuer agiert offenkundig in Ermangelung klügerer Konzepte in fast idealtypischer Reinform als Lordsiegelbewahrer einer autogerechten Verkehrspolitik, als Traditionalist und tagesaktuell inspirierter Cheflobbyist der Automobilindustrie, während er die echten strategischen Zukunftsfragen der Mobilitätspolitik systematisch vernachlässigt. Er hat offenbar nicht erkannt, dass es die Synergien mächtiger Trends in globalen Entwicklungsprozessen sind – gegen die selbst ein bayrischer Verkehrsminister nicht ankommen kann –, die zu einer rasanten Transformation der Verkehrsmärkte beitragen: Bevölkerungswachstum, Urbanisierung, wachsende Mobilitätsnachfrage und ansteigende Verkehrsmengen mit zeitgleich anwachsenden externen Effekten für Menschen und ökologische Systeme erzwingen schon heute Politikwechsel in den wichtigsten Zukunftsmärkten der deutschen Automobilindustrie.
Für die Zukunft würde das Autoland Deutschland in Wirklichkeit nur dann fit werden, wenn es sich selbst radikal verändert in Richtung mehr nachhaltiger Stadt- und Verkehrsentwicklung, den Umbau der deutschen Industrie in Richtung elektrischer Antriebe und digitaler Mobilitätsdienstleistungen massiv beschleunigt und vor allem die öffentlichen Verkehrsinfrastrukturen auch in strukturschwachen Regionen ausbaut und modernisiert. Dazu bräuchte es eine konzeptfähige, kritikfähige, intellektuell differenzierte und mutige Verkehrspolitik und eine politisch-kulturelle Verständigung auf ein Primat der Politik, das anzeigen würde, dass die Politik sich selbst wieder ernst nimmt als legitime Gestaltungsinstanz statt als Sachverwalter des Status quo. Zugleich gälte es, die Notwendigkeit, weil Unausweichlichkeit dieser Transformationspolitik zu erläutern, zu plausibilisieren und in ihren zwangsläufigen beschäftigungspolitischen und sozialen Folgewirkungen abzufedern.
Das sind mittlerweile Binsenwahrheiten kluger Mobilitätspolitik in vielen Teilen der Welt. Im Gegensatz dazu aber nimmt die deutsche Verkehrspolitik Zuflucht zur Vergangenheit, adressiert oft genug niedere Instinkte und schlägt sich sehr vermeintlich auf die Seite des Bürgers, indem sie die durch schlechte Infrastrukturpolitik und vernachlässigte Daseinsvorsorge jahrzehntelang erzwungene Automobilität in ländlichen Regionen nach wie vor als Freiheitsversprechen verkauft. Ebenso kurzsichtig agieren die Gewerkschaften und die von ihnen getriebene Sozialdemokratie. Beide entdecken ihr Herz für den Automobilarbeiter immer dann, wenn die böse Elektromobilität »Hunderttausende Arbeitsplätze zu vernichten droht«, nicht aber, wenn die Autoindustrie systematisch mit beschäftigungsvernichtender digitaler Produktionsoptimierung die Gewinne erhöht oder Standorte in die Nähe der überseeischen Märkte verlagert, ebenfalls aus Gründen der Kosteneinsparungen durch kürzere und sicherere Transportwege und günstige Arbeiter.
Was ist also los im Autoland Deutschland? Man kann sich angesichts der »Verfahrenheit« dieser Debatte mit guten Gründen die Frage stellen, ob Mobilität und Nachhaltigkeit womöglich prinzipiell unvereinbar sind beziehungsweise einen so mutigen und konsequenten politischen Steuerungsimpuls benötigen, wie er vor dem Hintergrund einer über 100-jährigen Automobilisierungsgeschichte und ihren diversen ökonomischen, sozialen und kulturellen Pfadabhängigkeiten in einer demokratischen Kultur unseres Zuschnitts kaum möglich erscheint. Nun ist die verkehrspolitische Debatte dieses Frühjahrs nicht die einzige interessante politische Entwicklung. Wir erleben zeitgleich ein zumindest rhetorisches »Ergrünen« der Politik. Mit Blick auf die aktuellen Wählerstimmenprognosen in den wöchentlichen Sonntagsfragen scheint es, als könnten es die Grünen sein, denen in der näheren Zukunft die Aufgabe in den Schoß fällt, »mehr Grün« in der Verkehrspolitik zu wagen, ja wagen zu müssen, um auch den Wirtschaftsstandort Deutschland mittel- und langfristig zukunftsfest zu machen.
Woran könnten sie sich dabei orientieren? Wo bliebe dabei die Nachhaltigkeit? Und wie soll angesichts der beschriebenen engen Symbiose von gesellschaftlicher Modernisierung und wachsenden Verkehrsleistungen eine transformative mobilitätspolitische Nachhaltigkeitsperspektive in Zukunft überhaupt möglich sein? Um sich einer Antwort anzunähern, wird zunächst die Begriffs- und Realgeschichte von Nachhaltigkeit und Mobilität bis zum heutigen Zeitpunkt nachgezeichnet. Danach werden die beiden Konzepte im Hinblick auf nötige und hinreichende Zielhorizonte, Bewertungskriterien und Handlungsstrategien miteinander verknüpft. Der Beitrag endet mit einer optimistischen Antwort auf die eingangs formulierte Frage nach der prinzipiellen Vereinbarkeit von Raumüberwindung und Nachhaltigkeit. Vor allem dem wohl in vielerlei Hinsicht grundstürzenden Prozess der Digitalisierung der Mobilität werden dabei große Potenziale zugeschrieben, was in der abschließenden These von der Möglichkeit einer »digitalen Schubumkehr« der modernen Mobilität mündet.
1. Begriffs- und Realgeschichte der nachhaltigen Mobilität
Gesellschaftliche und wissenschaftliche Begriffsverwendungen ändern sich mit der gesellschaftlichen Praxis. Insofern sind die im Folgenden nachgezeichneten Real- und Begriffsgeschichten der Konzepte von Nachhaltigkeit und Mobilität nicht voneinander zu trennen. Gleiches gilt für die zunehmende Verschränkung der beiden Begriffe und die Konvergenz und Überlagerung der jeweiligen fachwissenschaftlichen wie öffentlichen Diskussionen. Die realgeschichtlichen Entwicklungen drängten zu einem neuen und erweiterten Begriffsapparat, in dem sich nun auch die Anerkennung der normativen Verantwortlichkeit des Menschen für seine zukünftige Entwicklung in der Epoche des »Anthropozän« gleichermaßen zum Ausdruck und zum Diskurs bringen konnte.
Vom Umweltschutz zur Nachhaltigkeit
Die Geschichte der ökologischen Bewegung ist so facettenreich, komplex und oft in sich widersprüchlich, dass es selbst einem Meister seines Fachs wie dem Sozialhistoriker Joachim Radkau nur mit großem Aufwand gelingt, den enormen Stoff zu bewältigen. Für die Zwecke dieses Beitrags ist die angesichts der Fülle sehr pointierte Darstellung von zwei real- und begriffsgeschichtlichen Wendepunkten in der »Weltgeschichte« der Ökologie von Interesse, die er um die 1970er- und die 1990er-Jahre herum ausmacht.
Das erste Zeitfenster bezeichnet Radkau als die Jahre der »ökologischen Revolution« , in der es in einer Art »Kettenreaktion« unter dem Begriff des Umweltschutzes zur Verknüpfung unterschiedlichster Themenfelder, Aktivitäten und Politikarenen kommt, wie dem Naturschutz, dem Tier-, Wald- und Wasserschutz, der Luftreinhaltung und dem Arbeits- und Verbraucherschutz. Markantestes Kennzeichen des neuen ökologischen De...