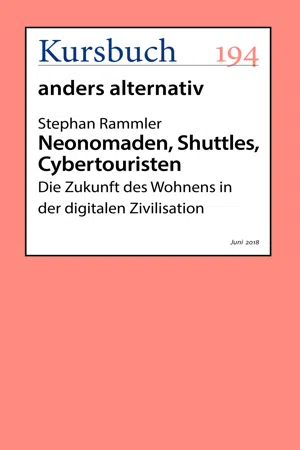![]()
Stephan Rammler
Neonomaden, Shuttles, Cybertouristen
Die Zukunft des Wohnens in der digitalen Zivilisation
1. Einleitung: Megatrends und Wohnwandel
Die Megatrends des demografischen Wandels, der Urbanisierung und der Digitalisierung schaffen eine neue und zunehmend extreme Knappheit an Lebensraum und Lebensqualität, insbesondere in den urbanen Regionen. Sie eröffnen aber womöglich auch Chancen für die Entwicklung neuer, nachhaltigerer Lebensstile und Wohnformen. An idealtypischen Szenarien – »Alles! Immer! Sofort! – Das Schlaraffenideal neo-nomadischer Just-in-time-Lebensstile« und »Rasender Stillstand – Die neue digitale Sesshaftigkeit in Stadt und Land« – soll in diesem Beitrag über mögliche Entwicklungen spekuliert werden, die beide stark durch die Digitalisierung getrieben werden könnten, jedoch auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Insofern können sie – je nach eigener Haltung und Einstellung – auch als Prototypen einer aus gesamtgesellschaftlicher Sicht wohl eher zu befürchtenden weiteren Mobilisierung, Beschleunigung und Flexibilisierung des Lebens einerseits und der womöglich eher als wünschenswert empfundenen möglichen Entkopplung von Wohnen, Arbeit und Mobilität andererseits interpretiert werden.
Doch diese Entwicklungen treffen nicht auf die Tabula rasa einer unformatierten Welt, sondern auf die Wirtschafts-, Raum-, Verkehrs- und Siedlungsstrukturen hochinterdependenter Gesellschaften, die eine lange Geschichte hinter sich haben. Diese auch als »Pfadabhängigkeit« interpretierbare »Macht der Anfänge über die Zukunft« definiert die Spielräume und Wahrscheinlichkeit des Eintretens unterschiedlicher Zukunftserwartungen und damit auch die Frage der Gestaltbarkeit und Gestaltungsnotwendigkeit durch Politik, Unternehmen und Zivilgesellschaft.
2. Wo ist zu Hause? Wohnwandel zwischen Kulturkritik und Apologie
Das ganze Elend kommt daher, dass die Menschen nicht zu Hause bleiben. Wenn die Menschen zu Hause blieben, so sinngemäß der französische Philosoph Blaise Pascal, müssten sie ihre Körper nicht unmäßigen Strapazen aussetzen, und die Seele hätte die Muße, derer sie bedarf, um zum Frieden zu finden. Wo ist zu Hause? Diese Frage konnte Pascal für sich gut beantworten, heute aber ist sie für viele Menschen prekär geworden. Versteht man »zu Hause sein« oder »sich heimisch zu fühlen« psychologisch, als subjektives Empfinden für »gelungenes Wohnen« mit Gefühlen von Stabilität, physischer Sicherheit und Wohlbefinden, mit sozialer Zugehörigkeit und Eingebundenheit, so kann man diesbezüglich ein wachsendes Unbehagen in der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion darüber feststellen, dass »gelungenes Wohnen« sich offenbar immer weniger einstellt.
Durch politische und ökonomische Internationalisierung, die rasante digitaltechnologische Innovation und kulturellen Wandel werden starke Schübe der Mobilisierung, Flexibilisierung und Beschleunigung in allen Nischen des modernen Lebens ausgelöst, insbesondere aber in den eng verknüpften Bereichen der Mobilität, des Arbeitens und Wohnens. Die Folgen sind häufige Umzüge, neue flexible Wohnformen, in bestimmten Berufsgruppen ein regelrechtes Nomadendasein, unterstützt von den sogenannten »choses nomadique« neuester digitaler Verkehrs- und Kommunikationstechnologien. Das Wohnen gerät also immer mehr in Bewegung, und das in einem Tempo, dass dieser für zunehmend viele Menschen oft nur schwer zu verarbeitende soziale Wandel Empfindungen der Entwurzelung, des Sinnverlustes und der Verlassenheit verursacht. Für die kritische Fachöffentlichkeit stellt sich das Problem noch einmal anders dar: Man macht sich Sorgen um die erodierenden Fundamente gesellschaftlicher Solidarität und des sozialen Zusammenhalts.
Doch Kulturkritik allein würde der Sache nicht gerecht werden. Wie viele andere soziale Phänomene organisiert sich das Wohnen innerhalb einer dialektischen Ordnung von Freiheit und Zwang, von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Wohnen – insbesondere in seinen spezifischen mobilen und flexiblen Ausprägungen – ist immer schon auch ein Medium und eine Ausdrucksform von Individualität, Identität, Freiheit und Selbstverwirklichung gewesen. So wäre zum Beispiel auch der besonders mobile, aufbruchsbereite und freiheitsliebende Charakter der nordamerikanischen Lebensweise nicht verständlich ohne einen Blick auf seine historischen Ursprünge im Mythos des »going west«. Für Generationen war diese immer weiter nach Westen rückende »inner frontier« zwischen vermeintlicher Wildnis und vermeintlicher Zivilisation Herausforderung und Chance für ein besseres Leben. Oft jahrelang kämpften sich die Wagentrecks durch die Wildnis, endeten nicht selten im menschlichen Desaster. Die Eisenbahn und die Highways verbanden entlegenste Gebiete. All die Geschichten und Sagen darüber verbinden sich heute zur großen Erzählung des modernen nordamerikanischen Arbeitsnomaden. Mobilität und Aufbruchsbereitschaft verbinden sich seit dieser Zeit aufs Engste mit dem Aufstiegs- und Leistungsethos des berühmten »Tellerwäschers«. Und auch die »zweite Entdeckung« Amerikas durch das touristische Nomadentum in der Welle der Picknick-, Urlaubs- und Reisebewegungen seit Beginn des 20. Jahrhunderts schließt eng an diesen Mythos an. Vor diesem Hintergrund könnte der Kontrast zu den oben beschriebenen Problemen kaum deutlicher zum Ausdruck kommen als in der Behauptung, Wanderung sei »Leben und Fortschritt« – Sesshaftigkeit »Stagnation«.
Aus dieser Sicht ist »Wohn…« – zunächst mit Stabilität und Geborgenheit assoziiert – » …wandel« also nur scheinbar eine paradoxe Formulierung. Stattdessen entfaltet sie einen Spannungsbogen, unter dem sich die Variabilität und Spannbreite der historisch vorfindbaren Lebens- und Wohnweisen ebenso gut einsortieren lässt wie die aktuellen Entwicklungen. Ist mobiles und flexibles Wohnen ein neues oder altes Phänomen, ist es positiv oder negativ zu bewerten? Beides trifft zu, und der Blick in die Kultur- und Sozialgeschichte des Wohnens wird zeigen, dass die Frage eigentlich zu schlicht gestellt ist. Ob wir mit den aktuellen Flexibilisierungs- und Beschleunigungsschüben auf eine historisch bislang unbekannte Qualität gesellschaftlicher Entwicklung zustreben, ist hingegen eine offene Frage. Die Kenntnis der gegenwärtigen sozialen Trends kann dabei helfen, Maßstäbe für eine kritische Annäherung zu entwickeln und einen abschließenden und bewertenden Blick in die Zukunft des Wohnens zu werfen.
3. Was hat bewegtes Wohnen mit Soziologie zu tun?
»Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben«, schreibt Rainer Maria Rilke. Seit Martin Luther preisen die Protestanten ihren Gott als eine »feste Burg«. Und die Etymologie des Wortes »Wohnen« verweist auf einen Ursprung in Wortbedeutungen wie zufrieden sein, lieben oder schätzen. Dies alles unterstreicht die tiefe zivilisatorische Verankerung des Wohnens als ein menschliches Grundbedürfnis. Wohnen, ein Zuhause haben, bevor der Winter beginnt, sich und seine Lieben im Schutze einer festen Burg zu wähnen, ist von ebenso existenzieller Bedeutung wie die Bedürfnisse etwa nach Nahrung und Fortpflanzung, ja es ist sogar Voraussetzung für die Verwirklichung der anderen Grundfunktionen und damit ein ganz fundamentaler Lebenszweck. Aus Sicht des Sozialanthropologen Arnold Gehlen ist Wohnen eine Form der Existenzbewältigung des Menschen, eine Herausforderung und Notwendigkeit aufgrund seiner physiologischen Unspezialisiertheit und Weltoffenheit. Nun sind Menschen keine Monaden, sondern leben in Gemeinschaften und Gesellschaften. Sie sind in ihren Handlungsweisen stets aufeinander bezogene soziale Wesen und auch nur so in allen ihren Zielen ...