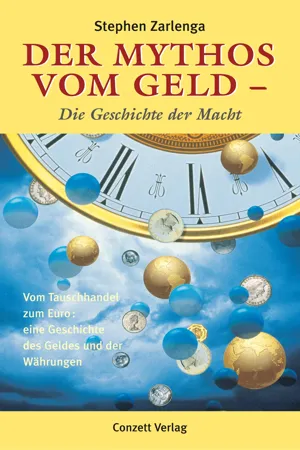
eBook - ePub
Der Mythos vom Geld - die Geschichte der Macht
Vom Tauschhandel zum Euro: eine Geschichte des Geldes und der Währungen
- 525 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Der Mythos vom Geld - die Geschichte der Macht
Vom Tauschhandel zum Euro: eine Geschichte des Geldes und der Währungen
Über dieses Buch
Zarlengas umfassende Geschichte des Mythos vom Geld - vom Tauschhandel bis hin zur europäischen Währungsunion - vermag Wissenschaftler, Fachleute und Laien gleichermaßen zu faszinieren.Dies ist die kritische Geschichte des Geldes und der Währungen. Die oft überraschenden Thesen Zarlengas belegen, dass die säkulare Macht in einer Gemeinschaft vor allem von ihrem Geld- und Bankensystem ausgeübt wird - und nicht, wie wir anzunehmen gewillt sind, von Regierungen und Volksvertretern.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Der Mythos vom Geld - die Geschichte der Macht von Stephen Zarlenga im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Geschichte unterrichten. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1. Kapitel
Die Ursprünge des Geldwesens
Es muss also ein Eines geben, welches das gemeinsame Maß vorstellt, und zwar kraft positiver Übereinkunft vorstellt, weshalb es auch Nomisma heißt, gleichsam ein vom Gesetz, Nomos, aufgestelltes Wertmaß.
Aristoteles
Der Kampf um die Ausübung der monetären Macht in einer Gesellschaft wird auf vielen Ebenen ausgetragen, sogar auf der Ebene der Theorien über die Anfänge des Geldwesens. Die Ursprünge des Geldes sind in Dunkel gehüllt. Da es nur wenige gesicherte Erkenntnisse gibt, sind die meisten Theorien nichts als geistreiche Spekulation. Die Entstehung des Geldes wird im wesentlichen auf drei verschiedene Ursprünge zurückgeführt: auf einen religiösen Ursprung, auf einen gesellschaftlichen oder staatlichen Ursprung und auf einen wirtschaftlichen oder durch den Warenhandel bedingten Ursprung. Die meisten Ökonomen vertreten die letztgenannte Auffassung. Diese Theorie spiegelt den heute weit verbreiteten Wunsch wider, Regierungen von der Übernahme einer geeigneten monetären Rolle abzuhalten.
Der Ursprung des Geldes im Warenhandel
Dieser Theorie zufolge wurden in einer prämonetären Gesellschaft Waren direkt getauscht. Das Bedürfnis nach Geld entstand, weil die zu tauschenden Waren nicht immer denselben Wert hatten und weil Händler die Waren, die jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt angeboten wurden, nicht immer erwerben wollten. So entwickelte sich ein bestimmtes Gut aufgrund seiner günstigen Eigenschaften (hoher Stückwert, Transportfähigkeit, Teilbarkeit und Beständigkeit) nach und nach zu einem Zwischengut im Tauschhandel, einem sogenannten Tauschmedium.
Die andauernde Verwendung dieses Guts verstärkte seine Rolle beim Warenaustausch, so dass es schließlich als allgemeines »Geldgut« akzeptiert wurde. Händler nahmen es bereitwillig an, da sie wussten, dass sie es zu einem späteren Zeitpunkt leichter gegen gewünschte Waren eintauschen konnten. Darüber hinaus war das Geldgut aufgrund seiner physischen Eigenschaften ein praktisches Wert- oder Rechenmaß und zumindest zeitweilig ein Wertspeicher.[1]
Einige ökonomische Schulen treten besonders vehement für diese wirtschaftliche Herkunftstheorie ein, da sie die Regierungen von monetären Entscheidungen ausgeschlossen sehen wollen und deshalb eine marktorientierte Herkunftstheorie bevorzugen, die von Beschlüssen einer Regierung oder anderen Organen unabhängig ist. Doch möglicherweise ist ihr Urteil auch von dem heute herrschenden starken Misstrauen gegenüber Regierungsbeschlüssen beeinflusst.
Denn obwohl die wirtschaftliche Herkunftstheorie sehr plausibel erscheint, hält sie einer genaueren Überprüfung nicht stand. Sie setzt nämlich bereits hohe Entwicklungsstufen voraus, etwa die Anerkennung von Privateigentum im Unterschied zu Stammeseigentum und die Anerkennung von Handelsverträgen sowie vermutlich auch ein System zu deren Durchsetzung. Wäre all dies möglich gewesen, ohne dass es bereits irgendeine andere Form von Geld gegeben hätte?
Bedenkt man, dass Vieh eine der am weitesten verbreiteten Vorformen des Geldes war, verliert die Handelstheorie erheblich an Glaubwürdigkeit. Sie stellt in Wahrheit den Versuch dar, die Entstehung von Metallgeld zu erklären, nicht aber von Geld an sich. Die entscheidende Frage aber, was dem Metallgeld eigentlich seinen Wert verlieh, wird anhand dieser Theorie weder beantwortet noch ernsthaft betrachtet.1
Der Ursprung des Geldes in der Gesellschaft
In ihrem Buch A Survey of primitive Money vertritt die Anthropologin A. H. Quiggin eine völlig andere Herkunftstheorie. Zwar kann die Anthropologie alleine keine historischen Entwicklungen oder Ereignisse erklären, aber sie kann wertvolle Hinweise geben. Quiggin setzte bei der Untersuchung von Geldformen in noch existierenden primitiven Gesellschaften an, um auf diese Weise Erkenntnisse über die Ursprünge des Geldes zu gewinnen. Ihre Beobachtungen hätten gezeigt, dass der Tauschhandel nicht der einzige Faktor bei der Entstehung von Geld sei. Die beim Tauschhandel üblicherweise ausgetauschten Gegenstände entwickeln sich nicht auf natürliche Weise zu Geld, und die als Geld verwendeten Gegenstände von größerer Bedeutung tauchen nur selten im alltäglichen Tauschhandel auf. Darüber hinaus empfinden einfache Gesellschaften die Unannehmlichkeiten des Tauschhandels nicht als Nachteil. Quiggin hat diese Situation noch zur Zeit der Abfassung ihres Buches (1949) in mehr als der Hälfte aller Länder vorgefunden. Sie kommt deshalb zum Schluss, dass die einem Geldersatz am nächsten kommenden Gegenstände ihre Funktion vermutlich durch ihre Verwendung bei innergemeinschaftlichen Zeremonien erhalten haben und nicht beim Tauschhandel.2 Nach diesen anthropologischen Untersuchungen wurde Geld hauptsächlich als standardisiertes Brautgeld oder als Blutgeld bei Verletzungs- und Todesfällen verwendet.
Der Ursprung des Geldes in der Religion
Zu den Vertretern einer religiösen Herkunftstheorie zählen Paul Einzig und Bernard Laum. In seinem Buch Primitive Money schreibt er, die Menschen in primitiven Lebensgemeinschaften seien überwiegend von nicht-wirtschaftlichen Erwägungen geleitet worden. Hierzu zählt der Glaube an übernatürliche Kräfte und die Furcht vor diesen. Dieser Faktor spielt eine außerordentlich wichtige Rolle im Leben der primitiven Kulturen, und aus diesem Grund sind religiöse Zwänge an der Entstehung des Geldes wahrscheinlich stärker beteiligt als wirtschaftliche Erfordernisse. Die Entwicklung des Wirtschaftssystems im allgemeinen war stark von religiösen Faktoren beeinflusst.3
Laums geschichtliche Forschung ist in seinem Buch Heiliges Geld dargelegt. Nach ihm liegt der Ursprung des Geldes im religiösen Kult als vorgeschriebener Opfergabe an Götter und als Bezahlung an Priester. »Das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Das älteste Recht ist das Recht der Götter. Folglich ist auch das durch den sakralen Nomos geschaffene Geld ein Geschöpf der Rechtsordnung. Die Normen des sakralen Geldes sind in das profane Recht übernommen. Die Geschichte des Geldes ist letzten Endes die Geschichte der Säkularisation der kultlichen Formen.« Die Regeln für religiöse Zahlungen wurden später auch auf private Zahlungen ausgedehnt. Laum schlussfolgert, dass der griechische Stadtstaat Schöpfer des Geldes geworden sei, »weil er Träger des Kultus war«.4
Vielleicht entstand Geld also ursprünglich aus dem Bedürfnis nach einheitlichen Opfergaben oder Abgaben für Götter und Vergütungen für Priester. Die Furcht der Menschen vor dem Übernatürlichen, ihre Ehrfurcht vor der Fähigkeit der Priester, in die Zukunft zu sehen (etwa in bezug auf die richtige Pflanzzeit), und vor deren primitivem Wissen über Medizin und Gifte – dies alles übte vermutlich einen beträchtlichen Einfluss aus.
Entwicklungen in der Archäologie, Numismatik und anderen Wissenschaften werden vielleicht mit der Zeit ein klareres Bild der Ursprünge des Geldes liefern. Obwohl wir wohl nie genau wissen werden, wie es entstand – möglicherweise aus einer Kombination der oben beschriebenen Faktoren, die höchstwahrscheinlich eng miteinander verbunden sind –, so wissen wir doch mindestens, woraus es bestand. Am weitesten verbreitet waren Ochsen und Kühe. Von Irland bis zum Mittelmeer, sogar bis Afrika wurde Vieh als Geld verwendet. Außerdem hatte Vieh offenbar einen ziemlich stabilen Wert: Sowohl im antiken Irland als auch im Griechenland zur Zeit von Homer betrug der Tauschwert einer Sklavenfrau drei bis vier Kühe.5
Etwa zwischen 1500 und 1000 v. Chr. gingen die Geldsysteme der Gesellschaften im östlichen Mittelmeerraum langsam, aber ohne Zwischenstufen vom Viehstandard auf den Goldgewichtstandard über. Dabei spielten offenbar östliche Tempel eine wichtige Rolle.
Die monetäre Rolle der Tempelkulte
Die ersten und einflussreichsten Tempelkulte entstanden in Ägypten und in Mesopotamien. Nach der Schilderung von William Linn Westermann6 waren die Tempel von Re, Ptah und Ammon um das 2. Jahrtausend v. Chr. mächtige Organisationen geworden. Im Papyrus Harris aus dem 11. Jahrhundert v. Chr. finden sich Berichte über die gewaltigen Besitztümer des Gottes Ammon, dessen Hauptsitz sich in Theben befand (der sagenhafte Komplex von Luxor und Karnak). Von dort aus wurden große Anbauflächen und die sie bewirtschaftenden Sklaven verwaltet. Zum Tempeleigentum zählten außerdem auch Städte an der Küste des Roten Meeres und in Syrien sowie Schiffe zum Transport der überschüssigen Produktion nach Orten außerhalb der ägyptischen Grenzen. In industrieller Hinsicht war dieser Tempel ein einflussreiches und autarkes Gebilde.
Tempel nahmen scheckähnliche Überweisungen von Getreide zwischen Deponenten vor, sogar an Zweigstellen in anderen Städten. So entwickelte sich mit großer Wahrscheinlichkeit Getreide zu einem Geldmittel.
Obwohl in Ägypten die größte und dichteste fest angesiedelte Bevölkerung aller Mittelmeeranrainer lebte – weshalb es eigentlich kein Stadtstaat, sondern eher eine Nation oder zumindest ein Flussstaat war – und obwohl Ägypten einen der fortschrittlichsten Priesterstände der Welt hatte, dessen Anfänge dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot zufolge 17 000 Jahre zurückliegen, fand man dennoch nie eine pharaonische Münze. In großer Zahl fand man hingegen Glas- und Porzellanskarabäen, was manche Geldhistoriker zu der Vermutung veranlasst hat, dass Skarabäen ein frühes Geldsystem darstellten.7
Nach William Ridgeway geht die Einführung der Münzprägung im Westen vermutlich auf eine griechische Entwicklung zurück. Die Tempelstätten von Delphi und Olympia sowie von Delos und Dodona waren Zentren nicht nur des religiösen Kults, sondern auch des Handels. Kaufleute und Händler zogen aus der Zusammenkunft zahlreicher Tempelbesucher aus allen Stadtvierteln Nutzen, um sie mit ihren Waren in Versuchung zu führen. Die Tempelverwaltungen förderten den Handel in jeder Form: Sie bauten geweihte Straßen, die zu einer Zeit, in der Straßen nahezu unbekannt waren, das Reisen ermöglichten, und sie stellten die Reisenden auf diesen Straßen unter den Schutz ihres Gottes. Während der Feiertage war das geschäftige Treiben jedoch untersagt – eine willkommene Atempause für die Händler und Kaufleute. Ridgeway meint deshalb, es lasse sich mit einiger Wahrscheinlichkeit die These aufstellen, dass die Kunst der Münzprägung im Heiligtum einer Gottheit ihren Anfang genommen habe.8
Dabei handelt es sich möglicherweise um eine isolierte Entwicklung. Quiggin beschreibt, wie sich der Gebrauch echter Metallhaken, -messer und -spieße als Geld hin zur Verwendung von Abbildungen dieser Gegenstände entwickelte. Sie warnt jedoch vor einer zu starken Verallgemeinerung. Rückblickend erscheine der nächste Schritt offensichtlich und unvermeidlich, doch nur an einigen wenigen Orten, möglicherweise sogar nur an einem einzigen, habe sich die Entwicklung bis zum letzten Schritt vollzogen, d. h. der Schaffung von rundlichen, flach geschlagenen, geprägten Metallstücken mit einem bestimmten Gewicht, die man als Münzen bezeichnen könne.9
Nach Andreas Andreades waren die panhellenischen Kultstätten von Athen und Olympia bzw. von Delphi und Ephesus die einzigen »großen Kapitalisten«.10 Die Finanzverwaltungen der Tempel fungierten zuweilen als Banken, denn sie gewährten nicht nur ihr eigenes Geld als Darlehen, sondern auch das Geld, das ihnen zur sicheren Verwahrung anvertraut wurde.
Gold wird zum Zahlungsmittel
Für die Völker der Antike war Gold das am einfachsten zu gewinnende Metall. Es kommt geologisch in den erzhaltigen Vulkangesteinsadern der meisten Gebirgsketten vor. Es wäre sicher schwierig gewesen, das Metall aus dem Fels herauszulösen, doch wurde das Gestein durch Witterungseinflüsse und Erosion aufgespalten. Dadurc...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Kapitel: Die Ursprünge des Geldwesens
- 2. Kapitel: Roms Bronzegeld: besser als Gold
- 3. Kapitel: Der Untergang Roms aus monetärer Sicht
- 4. Kapitel: Die Wiedereinführung von Geld im Westen
- 5. Kapitel: Die Kreuzzüge beenden den monetären Würgegriff von Byzanz
- 6. Kapitel: Der Kampf um die monetäre Vorherrschaft in der Renaissance
- 7. Kapitel: Scholastiker und Reformatoren
- 8. Kapitel: Das Jahr 1500 – Dreh- und Angelpunkt der Geschichte
- 9. Kapitel: Der Aufstieg des Kapitalismus in Amsterdam
- 10. Kapitel: Der Transfer des Kapitalismus nach England
- 11. Kapitel: Die Bank of England wird ausgeheckt
- 12. Kapitel: Die Nationalökonomen: die Priesterschaft der Bankentheologie
- 13. Kapitel: These versus Antithese: Synthese
- 14. Kapitel: Die Kolonialwährungen der USA
- 15. Kapitel: Die Geldmacht gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten
- 16. Kapitel: Ein Vergleich zwischen der staatlichen und der privaten Geldemission der Vereinigten Staaten
- 17. Kapitel: Greenbacks – echtes amerikanisches Geld
- 18. Kapitel: Die monetären Verbrechen des 19. Jahrhunderts – die großen Demonetisierungen
- 19. Kapitel: Der Triumph der Bankiers – die Einrichtung des Federal Reserve System
- 20. Kapitel: Das Federal Reserve System ruiniert Amerika
- 21. Kapitel: Ein Plädoyer für eine vierte Staatsgewalt
- 22. Kapitel: Die deutsche Hyperinflation von 1923 unter einer privaten Zentralbank
- 23. Kapitel: Internationale Währungssysteme
- 24. Kapitel: Die Europäische Währungsunion
- Quellennachweise