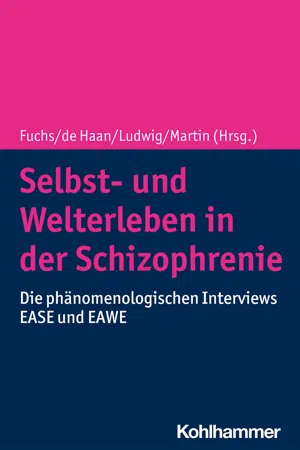
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Selbst- und Welterleben in der Schizophrenie
Die phänomenologischen Interviews EASE und EAWE
- 234 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Selbst- und Welterleben in der Schizophrenie
Die phänomenologischen Interviews EASE und EAWE
Über dieses Buch
Die Veränderungen des Selbst- und Welterlebens bei Menschen mit Schizophrenie sind in den letzten Jahren in den Fokus der Erforschung und Behandlung der Erkrankung gerückt. Das Buch enthält die erste deutsche Übersetzung der beiden ausführlichen phänomenologischen Interviews EASE und EAWE zur Erfassung dieser oft nur schwer beschreibbaren Erfahrungen. Einführende Texte, Interview-Leitfäden und Auswertungshinweise ergänzen das Werk, das in der Schizophrenie-Früherkennung ebenso wie in der Versorgung von Erkrankten aus dem Schizophrenie-Spektrum Einsatz findet.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Selbst- und Welterleben in der Schizophrenie von Thomas Fuchs, Sanneke de Haan, Max Ludwig, Lily Martin, Thomas Fuchs,Sanneke de Haan,Max Ludwig,Lily Martin im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medicine & Psychiatry & Mental Health. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Schizophrenie – eine Störung des basalen Selbsterlebens
Lily Martin, Max Ludwig und Thomas Fuchs
1.1 Einleitung
Störungen aus dem schizophrenen Spektrum sind nach ICD-10 und DSM-5 als eine Agglomeration von Symptomen definiert, die sich in erster Linie an der akuten Psychose orientieren (ICD-10 und DSM-5). Retrospektive Studien an Patienten mit einer erstmaligen Episode haben jedoch gezeigt, dass den meisten psychotischen Erstmanifestationen eine im Durchschnitt etwa fünf Jahre währende Prodromalphase voraus geht (Häfner et al. 1995). Präpsychotische, subklinische Störungen von Antrieb, Affekt, Wahrnehmung und Denken wurden schon in den 1960er Jahren im Rahmen des »Basissymptom-Konzepts« von Gerd Huber und seinen Mitarbeitern beschrieben (Huber 1966). Diese subtilen Veränderungen der Selbstwahrnehmung konnten mithilfe der 1987 veröffentlichten »Bonner Skala für die Beurteilung von Basissymptomen – BSABS« erfasst werden (Gross et al. 1987).
Eine Arbeitsgruppe um den dänischen Psychiater Josef Parnas und den amerikanischen Psychologen Louis Sass integrierte diese Basissymptome seit etwa 2000 in eine umfassendere phänomenologische Theorie, die die Schizophrenie als eine Störung des basalen Selbsterlebens versteht (Sass und Parnas 2003). In ihrem Zentrum steht eine Schwächung des präreflexiven Selbstempfindens und der Selbstpräsenz, die phänomenologisch auch als »Ipseität« (Selbstheit) bezeichnet wird. Damit einher geht ein Verlust des »Common Sense« und eine sogenannte »Hyperreflexivität« (Sass 2003; Fuchs 2011). Individuelle Veränderungen der Wahrnehmung, des Leiberlebens und des Kontakts mit anderen ergeben sich danach aus einer tiefgreifenden Veränderung der Erlebnisstrukturen. Auch die Symptome ersten Ranges in der akuten Psychose (Ich-Störungen, Wahn und Halluzinationen) sind demnach als vorübergehende Manifestation der zugrundeliegenden Selbststörungen anzusehen. Dieses Modell speist sich aus Konzepten phänomenologischer Philosophen wie Maurice Merleau-Ponty und Michel Henry sowie Psychiatern wie Eugène Minkowski und Wolfgang Blankenburg.
Um die Störungen des basalen Selbsterlebens zu erfassen, entwickelte die Arbeitsgruppe um Parnas die »Examination of Anomalous Self Experience – EASE« (Parnas et al. 2005). Das semistrukturierte, qualitative Interview bildet in den fünf Domänen »Kognition und Bewusstseinsstrom«, »Selbstgewahrsein und Präsenz«, »Leiberleben«, »Demarkation und Transitivismus« sowie »Existenzielle Reorientierung« mit insgesamt 94 Items das veränderte Selbsterleben differenziert ab. Da das Leiden von Menschen mit Schizophrenie bis heute nicht in befriedigendem Maße gelindert werden kann – es gibt beispielsweise kaum Therapieverfahren, die belastende Negativsymptome nachhaltig verringern (Martin et al. 2016b) – , lohnt es sich, mithilfe der EASE die Störung des basalen Selbst als möglichen pathogenetischen Kern der Schizophrenie zu untersuchen. Dadurch können Symptomzusammenhänge erkennbar werden, die für die weitere Aufklärung der Pathogenese, für eine verbesserte Früherkennung und nicht zuletzt für die Entwicklung innovativer, z. B. körper- und kreativtherapeutischer Interventionen bedeutsam sind. 2017 veröffentlichte eine weitere Arbeitsgruppe um Louis Sass die »Examination of Anomalous World Experience – EAWE1« (Sass et al. 2017), die sich mit insgesamt 75 Items den fünf weiteren Domänen »Raum und Objekte«, »Zeit und Ereignisse«, »Sprache«, »Atmosphäre« und »Existenzielle Orientierung« widmet. Damit werden die EASE-Kategorien bedeutsam ergänzt und erweitert.
Das vorliegende Buch beinhaltet die bislang unveröffentlichten deutschsprachigen Versionen der EASE und der EAWE. Die Übersetzung der EASE wurde im Rahmen einer Fall-Kontroll-Studie am Universitätsklinikum Heidelberg erstmals an einer Stichprobe von 33 Menschen mit einer Ersterkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis sowie an 24 Kontrollprobanden angewandt, inhaltlich analysiert sowie klinisch validiert (Ludwig 2013). Die Validierung geschah unter Einbezug bereits etablierter Instrumente wie der PANSS (Positive and Negative Symptom Scale; Kay et al. 1987), der CDS (Cambridge Depersonalisation Scale; Michal et al. 2004) und dem M.I.N.I. (Mini-International Neuropsychiatric Interview; Sheehan et al. 1998). Eine Validierung der deutschsprachigen EAWE steht noch aus.
Das Buch bettet die beiden Interviews in einen historischen und psychopathologischen Kontext ein. Die EASE wird zudem durch einen ausführlichen Interviewleitfaden ergänzt, der zum Einsatz im Klinikalltag sowie für die Forschung genutzt werden kann, ferner durch eine mehrstufige Auswertungsskala zur quantitativen Be- und Auswertung der EASE-Items. Selbstverständlich können und sollen die Inhalte des Interviews aber auch mithilfe qualitativer Methodik ausgewertet werden.
1.2 Das basale Selbst
Die phänomenologische und ontologische Natur des Selbsterlebens wird in verschiedenen Wissenschaften kontrovers diskutiert (Berrios und Marková 2003; Fuchs 2020). Es besteht kein Konsens darüber, ob so etwas wie »das Selbst« real erfahrbar ist oder eher eine theoretische Konzeption der Philosophie darstellt. Viele verstehen das Selbstempfinden als einen integralen Bestandteil des Bewusstseins (Damasio 1999; Zahavi 1999), der z. B. bei der Suche nach neuronalen Korrelaten von bewusstem Erleben zu berücksichtigen sei. Andere dagegen behaupten, dass es weder notwendig noch logisch sei, die Existenz eines Selbst anzunehmen (Metzinger 2003). Darüber hinaus bestehen divergierende Vorstellungen davon, aus welchen Komponenten sich das menschliche Selbsterleben konstituiert: James (1890/1950) unterscheidet zwischen einem materiellen, sozialen und geistigen Selbst; Neisser (1988) definiert ein ökologisches, ein interpersonelles, ein erweitertes, ein privates und ein konzeptuelles Selbst. Daneben gibt es Ausführungen zum ›autobiografischen, ›relationalen‹, ›fiktionalen‹ und ›neuronalen‹ Selbst ebenso wie zu einem ›Kernselbst‹, einem ›verkörperten‹, ›minimalen‹ oder ›basalen‹ Selbst (z. B. Damasio 1999; Strawson 1999; Zahavi 1999). Das Disparate der Konzepte ist sowohl problematisch als auch produktiv: Es erzeugt einen Reichtum an methodologischen Zugängen – sie reichen von der Introspektion und phänomenologischen Analyse über Gedankenexperimente, linguistische Analysen, empirische Experimente bis hin zu Studien von pathologischen Zuständen –, verhindert jedoch eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse und Befunde sowie die Entwicklung einer einheitlichen Theorie.
Kircher und David (2003, S. 2) definieren das Selbst als »die allgemein geteilte Erfahrung, dass wir wissen, dass wir über die Zeit hinweg die gleiche Person sind, dass wir der Autor unserer Gedanken/Handlungen sind, und dass wir uns von der Umwelt unterscheiden«. Dies umfasst das sehr grundlegende, unmittelbare und implizite Empfinden, als Person eine Ganzheit zu bilden, verschieden von anderen zu sein und über die Zeit hinweg ein kontinuierliches Zentrum der eigenen Erfahrungen darzustellen. Bezug nehmend auf neuere phänomenologische, entwicklungspsychologische und neurowissenschaftliche Konzepte wollen wir im Folgenden zwei grundlegende Formen dieses Selbsterlebens unterscheiden: (1) das basale, präreflexive oder leibliche Selbst und (2) das erweiterte, reflexive oder personale Selbst (Damasio 1999; Gallagher 2005; Rochat 2004; Zahavi 1999).
1. Das basale Selbst ist ein inhärenter Bestandteil aller Bewusstseinsprozesse. Es ist charakterisiert durch ein implizites, präreflexives (dh. unbewusstest) und verkörpertes Selbstgewahrsein (›Ich bin ich und ich selbst mache diese Erfahrung‹), das in jeder Erfahrung mitgegeben ist, ohne dass dafür eine explizite Introspektion oder Reflexion erforderlich wäre. Einen Baum zu sehen oder zu berühren, schließt immer auch das implizite Bewusstsein des eigenen Sehens oder Spürens und des eigenen Leibes im Hintergrund ein. Darin besteht die ›Erste-Person-Perspektive‹ oder ›Ipseität‹ (Klawonn 1991; Henry 1963). In der Literatur wird auch von einem »minimalen Selbst« (minimal self) oder »Kernselbst« (core self) gesprochen (Zahavi 2011; Cermolacce et al. 2007), da das basale Selbst das Minimum an Selbstsein beschreibt, das für ein subjektives Erleben erforderlich ist. Das basale Selbsterleben lässt sich nach Fuchs (2012) weiter in das ›primäre leibliche‹, das ›ökologische‹ (auf die Umwelt bezogene) und das ›soziale‹ (auf die anderen bezogene) Selbst differenzieren.
2. Das erweiterte, personale oder reflexive Selbst ist durch eine Reihe von eng miteinander verknüpften Fähigkeiten charakterisiert: (a) durch ein höherstufiges Bewusstsein der eigenen Zustände und Erlebnisse (introspektives oder reflexives Selbstbewusstsein), (b) durch die Fähigkeit, andere als intentionale Wesen zu verstehen und ihre Perspektive nachzuvollziehen (Perspektivenübernahme) (Tomasello 2002; Fuchs 2013); (c) durch die Fähigkeit, die eigenen Erfahrungen zu kohärenten Geschichten zu verknüpfen (narrative Identität) (Carr 1986; Schechtman 1996); (d) durch ein begriffliches und biografisches Wissen von sich selbst (Selbstkonzept).
Eine Großzahl neuerer theoretischer und empirischer Forschungsarbeiten beschreibt eine Störung des basalen Selbsterlebens als charakteristisch für die schizophrene Erkrankung (Ardizzi et al. 2015; Benson et al. 2019; Fuchs 2005; Møller und Husby 2000; Parnas und Handest 2003; Parnas und Sass 2011; Thakkar et al. 2011). Vielfach werden die Veränderungen des Selbsterlebens der Betroffenen auch unter dem Begriff der Entkörperung (disembodiment) zusammengefasst und als psychopathologischer Kern oder Grundstörung der Erkrankung verstanden (Laing 1960; Fuchs 2001, 2005; Stanghellini 2004; Fuchs und Röhricht 2017). Störungen der Reflexivität oder der Perspektivenübernahme (»Theory of Mind«)sind nach dieser Konzeption eher als sekundäre Folgen der basalen Selbststörung zu verstehen. Dieser Grundstörung wollen wir im Folgenden anhand der historischen Entwicklung des Schizophreniekonzepts sowie aktueller psychopathologischer Erklärungsansätze nachgehen.
1.3 Schizophrenie als Selbststörung – ein historischer Rückblick
Frühe Beschreibungen von Selbstentfremdung oder Depersonalisation in der Psychopathologie waren nicht auf die heute im Schizophreniespektrum versammelten Erkrankungen beschränkt: Ein Sich-selbst-Fremdwerden im weiteren Sinne zeigte sich als so charakteristisch für psychische Erkrankungen, dass bereits der Psychiater Wilhelm Griesinger (1861) die Entfremdung als ihr Grundmerkmal ansah und die französische Psychiatrie sie generell mit dem Begriff aliénation (Entfremdung) bezeichnete.
1.3.1 Emil Kraepelin und Eugen Bleuler – Dementia Praecox und Schizophrenie
Die Frage nach der Grundstörung in der Schizophrenie beginnt mit deren erstmaliger Konzeption bei Emil Kraepelin. Er unterteilte die endogenen Psychosen 1896 in zwei Gruppen: einerseits die phasisch verlaufenden Psychosen mit vorherrschender affektiver Symptomatik, die er als »manisch-depressives Irresein« bezeichnete (Kraepelin 1899, S. 160); andererseits die Psychosen mit paranoid-halluzinatorischen, katatonen oder desorganisierten Syndromen und progressiv-chronischem Verlauf, für die er den Begriff »Dementia praecox« wählte2. Neben der psychotischen Symptomatik beschrieb Kraepelin verschiedene prodromale Anzeichen, die der Produktivsymptomatik vorausgingen:
»Oft gehen schon lange Zeit Erscheinungen von ›Nervenschwäche‹ voraus. Die Kranken werden still, gedrückt, teilnahmslos, ängstlich, dabei reizbar und widerspenstig, klagen über […] Erschwerung des Denkens, Mattigkeit, verlieren Schlaf und Esslust, ziehen sich von ihrer Umgebung zurück, wollen ins Kloster gehen, hören auf zu arbeiten, bleiben viel im Bett liegen. Dieser Zustand der unbestimmten Vorboten kann kürzere oder längere Zeit andauern« (Kraepelin 1899, S. 160).
Die eigentliche Psychose verstand er als eine Manifestation psychischer Funktionsstörungen, der »Grundstörungen der seelischen und geistigen Leistungen«. Sie führten zu einem Verlust der »inneren Einheitlichkeit von Verstandes-, Gemüts- und Willensleistungen«. Eine Abschwächung des Wollens und eine »Zersplitterung des Bewußtseins« sei die Folge, sodass das psychische Leben einem »Orchester ohne Dirigenten« gleiche (Kraepelin 1913, S. 668–747). Kraepelin hob darüber hinaus immer wieder die »Schädigung des Gemütslebens« hervor und sprach von einer gemütlichen Stumpfheit und Gleichgültigkeit, grundlosem Lachen, einem Verlust des Mitleids, Schwinden des Feingefühls und paradoxen Gefühlen (Kraepelin 1913, S. 668). Zusammengefasst äußerte sich die »Dementia praecox« für Kraepelin in kognitiv-dynamischen Beeinträchtigungen nach Art eines persistierenden Grundsyndroms (Kraepelin 1913, S. 177). Paranoid-halluzinatorische, katatone und hebephrene Symptome stellten nur vorübergehende Überlagerungen dieses Grundsyndroms dar. Kraepelin blieb in der Ausdifferenzierung dieser Grundstörung jedoch sehr unbestimmt. Darüber hinaus fand der Frühverlauf der Dementia praecox trotz seiner eindeutigen Erwähnung insgesamt wenig Beachtung.
In Abgrenzung zu Kraepelin prägte der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler 1911 den Begriff der ...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Herausgeber- und Autorenverzeichnis
- Vorwort
- Vorwort zur deutschen Übersetzung des EASE-Interviews
- 1 Schizophrenie – eine Störung des basalen Selbsterlebens
- 2 Entkörperung und Entfremdung in der Schizophrenie – eine phänomenologische Analyse zweier Fallstudien
- 3 EASE – Examination of Anomalous Self Experience
- 4 EASE Interviewleitfaden mit Beispielfragen
- 5 EAWE: Examination of Anomalous World Experience
- Stichwortverzeichnis