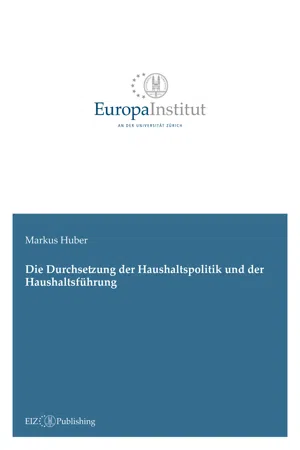
- 352 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die Durchsetzung der Haushaltspolitik und der Haushaltsführung
Über dieses Buch
Mit der Einsetzung der Schuldenbremse als oberste Finanzregel des Schweizer Bundeshaushalts fand eine lange Phase der Verrechtlichung von Haushaltsführung ihren vorläufigen Abschluss. Die Schuldenbremse bindet die Finanzpolitik an eine übergeordnete Fiskalregel. Sie soll eine stabile, passiv-antizyklische Haushaltspolitik garantieren und dabei in Ausnahmesituationen Massnahmen ermöglichen, die den jeweiligen Erfordernissen angepasst sind. Darüber hinaus diente die schweizerische Schuldenbremse als Vorbild für die bundesdeutsche Schuldenbremse und besteht gleichzeitig neben den vielfältigen Fiskalregeln der Kantone.
Die Dissertation zeigt anhand von Vergleichen, insbesondere mit den weit stärker justiziabel ausgestalteten Mechanismen in Deutschland, unterschiedliche finanzrechtliche Herangehensweisen. Eine Durchsetzung der Schuldenbremse im schweizerischen Bundeshaushalt ist nur indirekt und sehr beschränkt möglich – wenn aus rechtlicher Sicht überhaupt von einer solchen gesprochen werden kann. Institutionelle Schranken alleine reichen nicht aus, einen Haushalt ins Lot zu bringen und den Schuldenstand zu stabilisieren. Deshalb sollen weitere Steuerungsinstrumente und bestehende Organe den finanzpolitischen Zielen ebenfalls zum Durchbruch verhelfen.
Gleichwohl gilt, dass bei verstärkter Durchsetzung von rechtlichen Regeln eine effektive und effiziente Führung des öffentlichen Haushalts nicht vereitelt werden darf. Ist unter diesen Gesichtspunkten ein Ausbau überhaupt sinnvoll und welche Möglichkeiten der Erweiterung gibt es? Die vorliegende Arbeit gibt, eingebettet in den Kontext von Haushalts- und Finanzpolitik, darüber Aufschluss.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Durchsetzung der Haushaltspolitik und der Haushaltsführung von Markus Huber im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Law & Criminal Law. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
I
Teil A:
Instrumente der Haushaltspolitik und der Haushaltsführung
Die Schuldenbremse
I
Bedeutung der Schuldenbremse für eine regelgebundene Haushaltsführung
Die Schuldenbremse als Teil der Finanzverfassung
Die rechtswissenschaftliche Lehre fasst den Begriff „Finanzverfassung“ unterschiedlich weit. In der schweizerischen Literatur gilt der Begriff zudem als noch nicht lange eingeführt, unter anderem deshalb, weil die aBV keinen eigenen finanzrechtlichen Abschnitt besass. In der Schweiz wurde und wird mitunter auch von der Finanzordnung gesprochen, wenn die bundesstaatliche Seite der Finanzverfassung gemeint ist.[1] Einige Autoren plädieren für einen weit verstandenen Begriff. Unter Finanzverfassung sollen alle grundlegenden Normen verstanden werden, die sich auf die Umsetzung der staatlichen Finanzpolitik beziehen. Dazu gehören sowohl die Regelung der Finanzhoheit, der Beschaffung öffentlicher Mittel und der Haushaltsführung als auch die Bereiche des Geld-, Kredit- und Währungswesens.[2]
Ein anderer Teil der Lehre hält einen konzentrierten Begriff für geeigneter. Er vertritt die Ansicht, dass als Finanzverfassung die „Gesamtheit der grundlegenden Normen und Prinzipien, welche die Beschaffung, Verwaltung und Verwendung öffentlicher Mittel regeln“ verstanden werden soll.[3] Diese Ansicht steht in der Tradition der deutschen Finanzrechtslehre, welche sich auf eine engere Fassung des Begriffs „Finanzverfassung“ beruft.[4]
In tatsächlicher Hinsicht verwirklicht sich eine strikte Trennung von Finanz- und Geldpolitik nur ausnahmsweise. Somit kommen auch ihre rechtlichen Hintergründe und die differenzierten Rechtskonzeptionen selten in ungetrübter Klarheit zum Vorschein. Aus diesem Grund scheint allerdings auch das Argument gültig, dass aus wissenschaftlicher Sicht einer Vermischung nicht weiter Vorschub zu leisten ist.[5]
Die schweizerische Finanzverfassung ist hauptsächlich im 3. Kapitel der BV unter dem Titel „Finanzordnung“ festgehalten.[6] In diesem Kapitel ist unter anderem der zentrale Artikel zur Haushaltsteuerung des Bundes beheimatet: Die Verfassungsgeber normierten in Art. 126 BV den Auftrag zum Haushaltsausgleich und die sog. Schuldenbremse. Die Schuldenbremse steht am Anfang der Bestimmungen zur Finanzordnung. Der prominente Stellplatz unterstreicht die zentrale Funktion und die Bedeutung, die dem Ausgleichsauftrag und der Schuldenbegrenzung von politischer, rechtlicher und finanzwirtschaftlicher Seite zugemessen wird.
Zusammen mit einer Handvoll weiterer Normen auf Verfassungs- und Gesetzesstufe bildet Art. 126 BV den Dreh- und Angelpunkt der Finanzverfassung hinsichtlich der Haushaltsführung. Einerseits ergänzen die Bestimmungen zur sog. Ausgabenbremse von Art. 159 Abs. 3 Bst. b und Abs. 4 BV die Bestrebungen zur Eindämmung von ausgabenwirksamen Beschlüssen des Bundesparlaments. In verfahrenstechnischer Hinsicht legt derselbe Artikel in Abs. 3 Bst. c die qualifizierten Zustimmungserfordernisse fest, welche für eine Erhöhung der zulässigen Ausgaben bei ausserordentlichem Zahlungsbedarf gelten.[7] Andererseits vervollständigt die Ausführungsgesetzgebung, insbesondere Art. 13–18 FHG, den materiellen Gesetzesrahmen, welcher von der Schuldenbremse auf Verfassungsstufe vorgefasst wird.
Vermag die Schuldenbremse dem Anspruch zu genügen, Teil der Finanzverfassung zu sein? Ulsenheimer fasst Finanzverfassungsnormen als „tragende Strukturprinzipien“ für die Wirtschaftstätigkeit eines Staats auf.[8] Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich in der BV verdankt zwei Umständen, dass sie nicht mehr nur Teil einer politisch-programmatischen Zielnorm ist. Einerseits besitzt sie gegenüber ihrer Vorgängernorm eine höhere Regelungsdichte und enthält konkrete Vorgaben. Andererseits zeigt der Gesetzgeber damit, dass er parallel zur Verfassungsnorm entsprechende Ausführungsbestimmungen im FHG 1989 erliess, seinen verbindlicheren Gestaltungs- und Umsetzungswillen.[9] Die Finanzverfassung ist Spiegelbild der Staatsverfassung.[10] Die Schuldenbremse als ihr wesentlicher Teilgehalt spiegelt ein charakteristisches Merkmal schweizerischer Staatsauffassung: die traditionelle Skepsis und Zurückhaltung gegenüber weiter entfernten und unüberschaubareren Gebietskörperschaften, insbesondere deren finanziellem Gebaren.[11] Der Staatsbürger entwickelt für das kleinteiligere Gemeinwesen eine schärfere Beobachtungsgabe und kann Verflechtungen darin und finanzielle Auswirkungen daraus besser überblicken.[12] Davon zeugt auch das Vertrauen, welches die Stimmbevölkerung mit zustimmenden Mehrheiten zu Steuer- und Abgabenerhöhungen auf kommunaler und kantonaler Ebene den verantwortlichen Regierungs- und Verwaltungsbehörden schenkt.[13] Insofern erfüllt die Schuldenbremse das Merkmal, Teil der Finanzverfassung mit der ihr immanenten verfassungstypischen Geltungskraft zu sein.[14]
Vorläufiger Abschluss der Verrechtlichung der Haushaltsführung
Einige Marksteine im Verfassungs- und Gesetzesrecht erhellen die Rechtsentwicklung des Bundesfinanzrechts seit dem Zweiten Weltkrieg. Die hier interessierende Schuldenbremse findet ihre Vorläuferin in Art. 42bis aBV. Die darin enthaltene Verpflichtung zum Abbau des Bilanzfehlbetrages wurde 1959 mit der Bundesfinanzordnung statuiert. Das 1968 erlassene FHG 1968 kodifizierte erstmals in der Geschichte der Eidgenossenschaft die bis dahin zerstreut angelegten Budgetregeln zu einem einheitlichen Gesetz. Das FHG 1968 nahm das Gebot zur ausgeglichenen Rechnung auf, zusammen mit der erwähnten Verpflichtung zum Abbau des Bilanzfehlbetrags.[15]
Die erwähnten Gebote und (Selbst‑)Verpflichtungen waren in der finanzpolitischen Realität weitgehend unbeachtet geblieben und hatten ihrer Verwirklichung sowie einer effektiven Instrumentierung geharrt. Die sich drastisch verschlechternde Haushaltslage in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre allerdings führte zu einem Wiederaufflammen der Auseinandersetzungen mit finanzrechtlichen Grundsätzen auf dem politischen Parkett. Mit dem „Haushaltziel 2001“ wurde zunächst eine Übergangsbestimmung in die Verfassung aufgenommen, bevor die Annahme der Schuldenbremse von Volk und Ständen Ende des Jahres 2001 diese ablöste. Die Bundesversammlung beriet und beschloss parallel zu den letztgenannten Entwicklungsschritten mit den Verfassungsbestimmungen konvergierende Ausführungsnormen im FHG 1989.[16]
Die an dieser Stelle kurz umrissene Entwicklung führte zur geltenden materiellrechtlichen Grundlage für eine regelgebundene Haushaltsführung.[17] Diese wiederum dient der Verwirklichung einer regelgebundenen Finanzpolitik. Für eine regelgebundene Finanzpolitik sind institutionalisierte Entscheidungsabläufe vorzusehen. Diese sollen einer inkonstanten Finanzpolitik vorbeugen. Kommt es in einer Volkswirtschaft zu einer Störung des Wirtschaftsablaufs (insbesondere konjunkturelle Einbrüche oder Überhitzungen), entsteht zwischen dem Auftreten der Störung und deren Korrektur ein Zeitraum, in dem die Störung ihre Wirkungen – allenfalls unter zeitlicher Beschleunigung – entfalten kann. Diese Zeiträume, sog. Lags, sollen mit gegenläufigen finanzpolitischen Massnahmen verkürzt und die Verunsicherung der Investoren und Konsumenten aufgefangen werden. Zur rechtzeitigen Ergreifung dieser Massnahmen bedarf es bestimmter Indikatorenwerte, welche die institutionalisierten Mechanismen auslösen und steuern.[18]
Die Schuldenbremse wurde – unter Zugrundelegung der Finanzierungsrechnung – zum eigentlichen Steuerungsinstrument für den Bundeshaushalt.[19] Ihre Bestimmungen geben den finanziellen Spielraum für die Ausgaben des Bundes vor; die Einnahmen und die Konjunktur legen diesen konkret fest.[20] Die Schuldenbremse bildet in materieller Hinsicht den vorläufigen Abschluss der Verrechtlichungsbestrebungen in der Haushaltsführung.[21] Wie dargelegt, erfolgte die eigentliche Anwendung der seit mehreren Jahrzehnten bestehenden Schuldenbegrenzungsregel erst um die Jahrtausendwende. Kernpunkt der Verrechtlichung war die Konkretisierung der politisch-programmatischen Vorgaben a...
Inhaltsverzeichnis
- Umschlag
- Titelseite
- Copyright
- Widmung
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Materialien- und Dokumentenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einführung
- Teil A: Instrumente der Haushaltspolitik und der Haushaltsführung
- Teil B: Durchsetzung von Haushaltsinstrumenten und Fiskalregeln in der Praxis
- Teil C: Zusätzliche Durchsetzungsmechanismen
- Zusammenfassung
- Abstract
- Curriculum Vitae