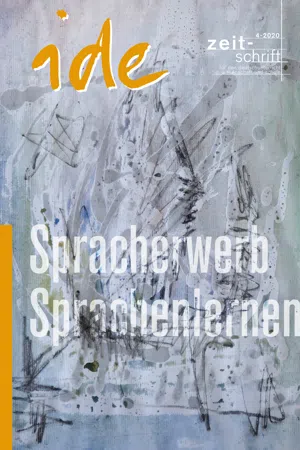
Spracherwerb und Sprachenlernen
- 150 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Spracherwerb und Sprachenlernen
Über dieses Buch
Mehrsprachigkeit begegnet uns im Klassenzimmer in unterschiedlichen Formen und wer heute selbst eine Sprache neu erlernt oder Lernende beim Sprachenlernen begleitet, kann beobachten, wie sehr ungesteuerter und gesteuerter Spracherwerb ineinandergreifen. Aus dem Vergleich der beiden Zugänge lassen sich wichtige Folgerungen für die institutionelle Sprachvermittlung ziehen, wobei auch der Blick in mehrsprachige Regionen Aufschlüsse über Erwerbs- und Aneignungsprozesse liefert.Wissen über die unterschiedlichen Aneignungsprozesse sowie über die Entwicklung lingua-kultureller Kompetenzen von Lernenden in gesteuerten und ungesteuerten Kontexten kann Lehrpersonen in ihrem Unterrichtshandeln unterstützen. Dabei sollen auch Erkenntnisse aus Neurolinguistik, Kognitionswissenschaften, Soziolinguistik und Lernersprachenanalyse berücksichtigt sowie in einem weiteren Schritt die didaktischen und curricularen Folgerungen in der institutionellen Vermittlung dargestellt werden.INHALTEDITORIALUrsula Esterl, Annemarie Saxalber: Zum Zusammenhang von ungesteuertem und gesteuertem Spracherwerb im UnterrichtSERVICEAnna Kriegl: Spracherwerb und Sprachenlernen heute. Bibliographische NotizenMAGAZINKommentar: Dagmar Unterköfler-Klatzer: Sommerschule 2020ide empfiehlt: Peter Ernst: Rudolf de Cillia, Jutta Ransmayr (2019): Österreichisches Deutsch macht SchuleNeu im RegalGESTEUERTER UND UNGESTEUERTER SPRACHERWERB IN ZWEIT- UND FREMDSPRACHEDietmar Rösler: Das Verhältnis von gesteuertem und ungesteuertem Zweit- und FremdsprachenlernenAnja Wildemann: Spracherwerb und Sprachenlernen. Implizite Lerngelegenheiten und explizite LernangeboteSPRACHERWERB UND SPRACHENLERNEN: DIDAKTISCHE IMPLIKATIONENKlaus-Börge Boeckmann, Stephan Schicker: Spracherwerb und Sprachenlernen in der Sekundarstufe I. Theoretische Zugänge, curriculare Vorgaben und didaktische SchlussfolgerungenTabea Becker, Tina Otten: Vorstellungen und Bewusstsein von sprachlichen Normen bei ein- und mehrsprachigen SekundarstufenschülerInnenKevin Rudolf Perner: Die "Abwendung von Missverständnissen" und das Dialekt-Standard-KontinuumVON DER SPRACHDIAGNOSE ZUR SPRACHFÖRDERUNGManuela Glaboniat: MIKA-D. Eine Betrachtung aus testtheoretischer PerspektiveMarion Döll, Sabine Guldenschuh: Nutzung sprachdiagnostischer Daten zum Deutschen als Zweitsprache in der Sprachbildungsplanung. Ergebnisse einer qualitativen PilotstudieJana Gamper, Dorotheé Steinbock: Wer ist bereit für die Regelklasse? Diagnostische Potenziale und Grenzen des Deutschen Sprachdiploms (DSD I) am Übergang von der Vorbereitungs- in die RegelklasseDAS ZUSAMMENSPIEL VON SPRACHERWERB UND SPRACHENLERNEN IM KLASSENZIMMERLuca Melchior: Translanguaging-Zugänge für das sprachliche und kulturelle Lernen im Unterricht. Ein VorschlagBarbara Hoch: Mehrsprachigkeit, sprachliche Normen und die interaktive Verhandlung sozialer Positionierungen. Unterricht als sprachlicher MarktSabine Schmölzer-Eibinger, Muhammed Akbulut, Christopher Ebner: Sind wir allein im Universum? Förderung wissenschaftlicher Textkompetenz anhand von Kontroversenreferaten zu naturwissenschaftlichen Themen im fächerübergreifenden Unterricht in mehrsprachigen KlassenGabriele Ribis: Besser gemeinsam lesen lernen. Ein integratives Konzept der Sprachförderung
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Manuela Glaboniat
MIKA-D
Eine Betrachtung aus testtheoretischer Perspektive
1. Testtheorie
1.1 WOZU soll getestet werden?
1.2 WAS soll getestet werden?
1.3 WIE wird getestet?
2. Güte- und Qualitätskriterien
2.1 Validität

Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Inhalt
- Ursula Esterl, Annemarie Saxalber: Zum Zusammenhang von ungesteuertem und gesteuertem Spracherwerb im Unterricht . . . . .
- Dietmar Rösler: Das Verhältnis von gesteuertem und ungesteuertem Zweit- und Fremdsprachenlernen
- Anja Wildemann: Spracherwerb und Sprachenlernen. Implizite Lerngelegenheiten und explizite Lernangebote
- Klaus-Börge Boeckmann, Stephan Schicker: Spracherwerb und Sprachenlernen in der Sekundarstufe I. Theoretische Zugänge, curriculare Vorgaben und didaktische Schlussfolgerungen
- Tabea Becker, Tina Otten: Vorstellungen und Bewusstsein von sprachlichen Normen bei ein- und mehrsprachigen SekundarstufenschülerInnen
- Kevin Rudolf Perner: Die »Abwendung von Missverständnissen« und das Dialekt-Standard-Kontinuum
- Manuela Glaboniat: Mika-D. Eine Betrachtung aus testtheoretischer Perspektive
- Marion Döll, Sabine Guldenschuh: Nutzung sprachdiagnostischer Daten zum Deutschen als Zweitsprache in der Sprachbildungsplanung. Ergebnisse einer qualitativen Pilotstudie
- Jana Gamper, Dorotheé Steinbock: Wer ist bereit für die Regelklasse? Diagnostische Potenziale und Grenzen des Deutschen Sprachdiploms (DSD I) am Übergang von der Vorbereitungs- in die Regelklasse
- Luca Melchior: Translanguaging-Zugänge für das sprachliche und kulturelle Lernen im Unterricht. Ein Vorschlag
- Barbara Hoch: Mehrsprachigkeit, sprachliche Normen und die interaktive Verhandlung sozialer Positionierungen. Unterricht als sprachlicher Markt
- Sabine Schmölzer-Eibinger, Muhammed Akbulut, Christopher Ebner: Sind wir allein im Universum? Förderung wissenschaftlicher Textkompetenz anhand von Kontroversenreferaten zu naturwissenschaftlichen Themen im fächerübergreifenden Unterricht in mehrsprachigen Klassen
- Gabriele Ribis: Besser gemeinsam lesen lernen. Ein integratives Konzept der Sprachförderung
- Anna Kriegl: Spracherwerb und Sprachenlernen heute. Bibliographische Notizen
- Kommentar Dagmar Unterköfler-Klatzer: Sommerschule 2020
- ide empfiehlt Peter Ernst: Rudolf de Cillia, Jutta Ransmayr (2019): Österreichisches Deutsch macht Schule
- Neu im Regal
- Impressum