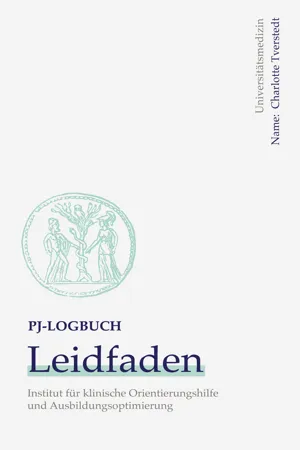![]()
KAPITEL 1
Der schreckliche Anfang
Tag 0
Ich beginne mein Praktisches Jahr an einem trüben Montagmorgen im November. Das Klinikum meiner Wahl liegt am Rande einer deutschen Kleinstadt und streitet sich mit dem Himmel darüber, wer denn nun die intensivere graue Farbe und Trostlosigkeit ausstrahlen kann. Es handelt sich um ein winziges, universitäres Lehrkrankenhaus, für das ich mich aufgrund der Nähe zu meiner Heimatstadt und der vom Haus gewährleisteten Aufwandsentschädigung entschieden habe.
Ich bin aufgeregt, habe wie immer vor einem neuen Abschnitt viel zu wenig geschlafen und habe keine Ahnung, was mich erwartet. Der heutige Tag soll für uns frisch examinierte PJ- Beginner*innen als Einführungsveranstaltung dienen. Nun geht es also endlich los mit dem Ausbildungsteil, den sich die meisten Medizinstudent*innen während der verschulten Kliniksemester sehnlichst herbeiwünschen. Die Bücher werden gegen Kittel und Stethoskop eingetauscht, das theoretische Ballastwissen über Bord geworfen. Das klinische Arbeiten beginnt.
Mit einem Stapel von Einführungsunterlagen mache mich auf den Weg durch das Kliniklabyrinth zu einem Konferenzraum, in dem bereits eine Handvoll zukünftiger Mitstreiter*innen wartet. Zögerlich suche ich mir einen Platz und blicke mich um: Keiner rührt den bereitstehenden Kaffee an, niemand sagt etwas. Ich erkenne einige Gesichter wieder, man nickt sich zu. Wirklich kennen tue ich allerdings niemanden, denn ich habe während des Studiums mehrere Semester mit meiner Doktorarbeit sowie mit einem Auslandssemester verbracht. Daher befinden sich die meisten meiner Uni-Freund*innen nicht mehr am gleichen Ausbildungspunkt wie ich. Ich habe mich zwar längst daran gewöhnt, auf mich allein gestellt zu sein, aber in diesem Moment hätte ich nichts dagegen, den kommenden Studienabschnitt mit ein paar guten Freund*innen zusammen anzutreten. Trotz großer Vorfreude habe ich immensen Respekt vor dem mir bevorstehenden Jahr. Was wird in den nächsten Wochen auf mich zukommen? Nach Monaten des Lernens für das zweite Staatsexamen habe ich das Gefühl, alle meine praktischen Fertigkeiten verloren zu haben.
Um Punkt halb neun ist Anpfiff und mein Praktisches Jahr beginnt - *Trommelwirbel* - mit einer Hygienebelehrung. Wir erhalten einen Zettelstapel, der das, was uns im Folgenden erklärt wird, offenbar zusammenfasst und dessen schiere Höhe mir jegliche Lust nimmt, mich weiter damit auseinanderzusetzen.
In der nächsten Stunde beobachte ich mit mildem Interesse, wie sich eine engagierte Hygienefachbeauftragte mit einer Engelsgeduld Schutzkittel, -masken und Handschuhe an- und auszieht, sich die Hände desinfiziert und dabei umfangreiche Erklärungen von sich gibt.
Ich bin etwas irritiert, denn Schutzkittel und Handschuhe ziehen wir uns alle spätestens seit dem ersten klinischen Semester jeden zweiten Tag an und aus, und bisher ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, zu erklären, wie das geht. Generell ist mir bei allen praktischen Aufenthalten selten ärztliches Personal begegnet, das Zeit für Anleitungen gehabt hätte; vielmehr ist grundsätzlich davon ausgegangen worden, dass ich mir sämtliche praktischen Fertigkeiten im bisherigen Studium bereits selbst angeeignet hätte.
Ich erinnere mich beispielsweise noch gut an meine erste periphere Venenverweilkanüle (VVK), die ich in meiner ersten Famulatur morgens um 8 Uhr als Antrittshandlung legen sollte. Eine Einweisung in den Ablauf, die in diesem Klinikum genutzten Materialien oder die zu versorgende Patientin hatte ich vorher nicht erhalten. Erst auf mehrmalige Nachfrage erklärte sich die zuständige Stationsärztin bereit, mir in Ruhe einmal alles zu zeigen. Vorher hatte ich nur ein einziges Mal in einem Untersuchungskurs eine VVK bei einem Kommilitonen mit unverfehlbaren Ofenrohr-Venen gelegt - damals hatte ich ein Blutbad veranstaltet, weil ich bei noch am Arm festgezurrten Stauschlauch die Nadel rausgezogen hatte, ohne vorher einen passenden Verschluss für den Zugang bereit gelegt zu haben. Ein entsprechend mulmiges Gefühl beschlich mich in jener ersten Famulatur also bei der Vorstellung, das gleiche Unterfangen auf mich alleingestellt an einer „echten" Patientin auszuüben. Nach der auf mein Drängen jedoch tatsächlich erfolgten Einweisung funktionierte das Legen der Viggo zwar erstaunlich gut; da es für die Patientin aber nur einen Flurstuhl gab, lief versehentlich Blut auf ihre sündhafte teure Handtasche, sodass mein Erfolgserlebnis in ihrem lautstarken Gezeter unterging. Natürlich fühlte sich für vollgeblutete Taschen niemand zuständig, und so versuchte ich hilflos, die aufgebrachte Patientin zu beruhigen.
Also komme ich mir am Tag der PJ-Einführung vier Jahre später, als mir im 11. Fachsemester jemand erklären möchte, wie man Schutzkittel anlegt, grenzwertig veralbert vor.
Der interaktive Part, ergo Kittel und Handschuhe an- und ausziehen, fällt weg, da Material gespart werden muss - wir dürfen uns als Entschädigung dafür aber alle einmal die Hände desinfizieren.
Die Hygienedame wird durch den abgehetzt wirkenden PJ-Beauftragten abgelöst, dessen offizielle Begrüßung eigentlich zu Beginn der Veranstaltung hätte stattfinden sollen. Uns wird mehrfach versichert, dass wir uns bei Problemen, Wünschen und Verbesserungsvorschlägen gerne jederzeit bei ihm persönlich melden könnten. Es folgt eine Vorstellungsrunde und langsam erschließt sich uns allen, mit wem wir in Zukunft in welcher Abteilung zusammenarbeiten werden. Zu spät fällt mir auf, dass auf die Frage, in welche Richtung es später einmal gehen soll, die Antwort „ich überlege, bei meiner Doktormutter an einem anderen Klinikum als Assistenzärztin anzufangen" zwar die ehrlichste, aber nicht unbedingt die diplomatischste gewesen ist, wenn man seinen Vorgesetzten einen Anlass für eine umfassende Ausbildung geben möchte. Das ist mir dann aber auch schnell wieder egal, denn wir werden nun endlich darauf hingewiesen, dass wir den bereitstehenden Kaffee auch wirklich trinken dürfen.
Bevor wir allerdings großartig miteinander ins Gespräch kommen können, betritt die klinikinterne IT-Spezialistin den Raum. Erneut schweigend beobachten wir sie mehrere Minuten lang dabei, wie sie verzweifelt versucht, den Laptop des Konferenzraumes und danach die Kliniksoftware in Gang zu setzen. Als sie es endlich geschafft hat, folgt eine einstündige, zusammenhangslose Informationsüberflutung über die Eigenschaften und Funktionen der Patientenverwaltungssoftware, während derer sich das System regelmäßig aufhängt und die arme IT-Dame händeringend versucht uns zu versichern, dass dies auf gar keinen Fall die Regel ist. Ich fühle mich nach fünf Minuten so wie meine Mutter sich fühlen muss, wenn ich ihr ungeduldig im Schnelldurchlauf die Funktionsweisen ihres Laptops zu erklären versuche, und schalte ab. Aus meinem Halbschlaf werde ich im Folgenden nur durch die mitleidsvollen Lacher meiner Kommiliton*innen gerissen, weil unsere Dozentin in regelmäßigen Abständen flachste Witze der Kategorie mummy-jokes reißt, die sie ganz offensichtlich seit Jahren bei jeder Veranstaltung dieser Art an den immer gleichen Stellen einbringt. Mir tut mein mangelnder Enthusiasmus ein wenig leid, denn sie gibt sich wirklich Mühe.
Während wir uns an das Kantinen-Essen gewöhnen, habe ich endlich Zeit, die anderen PJler*innen kennenzulernen. Sie studieren alle an anderen deutschen Universitäten. Wir verstehen uns auf Anhieb gut und ich bin froh, dass ich die kommenden Mittagsmahlzeiten mit lieben Menschen zusammen verbringen werde.
Im Laufe des Gesprächs stellt sich heraus, dass die anderen genauso wenig wie ich darüber wissen, was auf uns zukommen wird. Zugegebenermaßen beruhigt mich das etwas, denn zwischenzeitlich hat mich die Befürchtung ergriffen, dass ich die Einzige sein könnte, die sich für die kommenden Wochen nicht richtig gewappnet fühlt. Natürlich hätte ich mich in gewisser Weise besser „vorbereiten" können: Ich hätte mehr Erfahrungsberichte als nur eine Handvoll Klinik-Bewertungen bei PJ-Ranking lesen können, ich hätte mehr mit befreundeten PJler*innen sprechen können, ich hätte Lernstoff und Untersuchungstechniken wiederholen können. Stattdessen habe ich halbherzig ein paar „PJ"-Kapitel bei AMBOSS überflogen, bevor ich die Motivation verloren habe; wusste ich doch nicht genau, was man an meinem neuen Arbeitsplatz von mir erwarten würde. Warum sollte ich also meine dringend benötigte, vierwöchige Freizeit zwischen Examen und PJ-Start mit möglicherweise völlig unnötigem Lernen verschwenden? Ich schaltete den Computer aus und beschloss, das Praktische Jahr ohne konkrete Vorstellungen und Erwartungen unvoreingenommen auf mich zukommen zu lassen - ob es mir nun Angst machte, so subjektiv „unvorbereitet" in dieses neue, letzte Studien-Abenteuer zu starten, oder nicht.
Pro-Tipp N° 1: Nutzt die Zeit nach dem schriftlichen Staatsexamen, um euch zu erholen. Ihr werdet im PJ genügend Zeit haben, euch mit allem auseinanderzusetzen, was ihr nicht ausreichend gut zu können glaubt. Wartet erst einmal ab, was überhaupt von euch erwartet wird, und ergänzt diese Erwartungen dann um eure persönlichen Lernansprüche. Nicht selten laufen Dinge in der Praxis ohnehin ganz anders als im Lehrbuch ab. Das PJ ist zum Lernen da. Ihr müsst nicht im Vorfeld schon perfekt sein, und sollte es Kolleg*innen geben, die das von euch erwarten, dann können sie euch mit einem freundlichen Hinweis auf die Bedeutung des Begriffs work-life-balance den Buckel herunterrutschen.
In Gedanken versunken stelle ich irgendwann erschrocken fest, dass ich längst beim Betriebsarzt hätte sein sollen. Ich brauche geschlagene fünf Minuten, um mit dem uralten Klinikfahrstuhl aus dem achten Stock ins Erdgeschoss zu gelangen, denn natürlich hält der knarrende, graue Blechkasten auf jeder Etage einmal an. Dann lege ich einen Sprint über das Klinikgelände hin, während ich versuche, mich im strömenden, eiskalten Regen zu orientieren. Architekt für Krankenhäuser darf man anscheinend nur werden, wenn man gewährleisten kann, dass sich nach Fertigstellen der Räumlichkeiten auf dem Klinikgelände niemand mehr zurechtfindet. Zielloses Rumgehetze verträgt sich auf jeden Fall nicht mit dem Kantinen-Essen, wird mir bewusst. Dies soll im Nachhinein auch der einzige nachhaltige Lerneffekt des Einführungstages bleiben.
Endlich beim Betriebsarzt angekommen, erhalte ich denselben vorschriftsmäßigen Gesundheitscheck, den ich auch schon vor Antritt des PJs im Rahmen einer Eignungsuntersuchung von meiner Heimatuniklinik erhalten habe. Die Untersuchung ist in meinen Augen überflüssig, zumal ich auch noch einen entsprechenden Nachweis des universitären Betriebsarztes vorlege. Naja, Hauptsache, ich habe mich abgehetzt und bin klitschnass geworden.
- Warum berichte ich so ausführlich von diesem absolut unspektakulären Einführungstag? Weil es sich mir durch mein gesamtes PJ hindurch nicht erschließt, warum bei jeder einzelnen Tertial-Einführungsveranstaltung ausschließlich organisatorische Aspekte abgehandelt werden. Natürlich ist es wichtig, diese formellen Rahmenbedingungen zu thematisieren. Aber wären jene erstmaligen Zusammentreffen nicht eigentlich auch die perfekte Gelegenheit zu besprechen, wie die universitär vorgegebenen Tertial-Ziele aussehen, was die Studierenden von ihrem klinischen Praktikum erwarten und inwiefern diese beiden Aspekte miteinander vereinbar sind? Wäre es nicht sinnvoll, im Zuge dieser Tage klar zu definieren, welche Aufgaben man als PJler*in hat und wie groß die jeweiligen Anteile von „Lehrzeit" und „Arbeitszeit" ausfallen sollen? Wäre es nicht ebenfalls eine Maßnahme, an Einführungstagen praxisrelevantes Wissen zu vermitteln, wie zum Beispiel die Befundung von verschiedenen Röntgen-Aufnahmen, Grundlagen der Abdomen-Sonographie oder wie man sich im OP korrekt verhält? Warum „verschwendet" man die Zeit mit umfangreichsten Hygiene- und Software-Einweisungen, von denen in diesem Ausmaß niemand einen Mehrwert hat, anstatt uns auf die Anforderungen des Tertials vorzubereiten?
Pro-Tipp No 2: Ihr nehmt von den stundenlangen Einführungsveranstaltungen kaum etwas mit und stellt nach ein paar Wochen in der Praxis fest, dass ihr von dem am Einführungstag Gelernten nichts gebrauchen könnt?
Dann macht es anders als ich: Schluckt euren Unmut nicht einfach herunter (oder lasst euch später in einem Buch darüber aus), sondern nehmt die Dinge selbst in die Hand und führt ein Gespräch mit den PJ-Beauftragten. Gebt ihnen ehrliche Rückmeldung darüber, was euch gefehlt hat und was euren Nachfolger*innen helfen würde.
Tag 1: „Willkommen im Klinikalltag, Newby!"
An meinem ersten offiziellen Arbeitstag am Folgetag fahre ich viel zu früh los. Natürlich regnet es immer noch und das Klinikum hätte an diesem grauen Dienstagmorgen um 07:15 Uhr nicht trostloser aussehen können. Ich bin mir sicher, dass das ganze Gebäude grau ist, und stelle zu meiner großen Überraschung erst Wochen später fest, dass es sich um rote Backsteine handelt.
Freue ich mich auf die neue Herausforderung? Bin ich aufgeregt? Oder möchte ich einfach nur zurück in mein warmes Bett? In der Nacht vor jenem ersten Arbeitstag habe ich noch weniger geschlafen als in der Nacht zuvor. Obwohl ich mir nicht bewusst das Hirn darüber zermartert habe, was auf mich zukommen könnte, bin ich angesichts der mir bevorstehenden Ungewissheit unterbewusst wohl doch angespannter, als ich glaube.
Ich treffe meine Mitstreiter*innen vor dem Klinikeingang. Zusammen klopfen wir bei der zuständigen Sekretärin, welche sich als Urlaubsvertretung der eigentlichen Sekretärin entpuppt und entsprechend wenig mit uns anzufangen weiß. Nachdem wir der in ihrer Überforderung ganz hektisch werdenden Dame erklärt haben, was wir vermutlich bei ihr abholen sollen, erhalten wir alle ein kleines Telefon und einen Dienstschlüssel. Zwischendurch platzt die Chefin der Inneren Medizin auf dem Weg zu ihrem Büro hinein. Sie stellt sich kurz vor und fragt nach unseren Namen, dann ist sie auch schon wieder verschwunden. Da die Sekretärin in der Zwischenzeit telefonisch niemanden erreicht zu haben scheint, der sich für uns vier neue PJler*innen der Inneren Medizin zuständig fühlt, stehen wir nach unserem erfolgreichen Beutezug erst einmal wieder auf dem Flur herum. Durch die Tür hören wir, wie die Chefin sich erkundigt, „wer denn die Leute dort vor der Tür seien".
Offenbar hat niemand so richtig auf dem Zettel gehabt, dass wir kommen, und niemand weiß so richtig etwas mit uns anzufangen. Komisch, bislang bin ich immer davon ausgegangen, dass es solche organisatorischen Probleme im PJ nicht mehr geben würde. Doch weit gefehlt: Alles ist, wie ich es von so gut wie jedem bisherigen klinischen Praktikumsbeginn kenne.
Nach einiger Zeit erscheint dann doch eine motivierte Assistenzärztin, die sich als PJ-Beauftragte vorstellt und uns im Schnelldurchlauf das Haus zeigt. Für unser Tertial in Innerer Medizin sind in erster Linie drei Stationen relevant: Eine internistische Normalstation, welche auch als periphere Station bezeichnet wird, eine internistisch geführte Intensivstation sowie eine Zentrale Notaufnahme. Auf jeder dieser Stationen werden wir für insgesamt vier Wochen eingesetzt.
Die Besichtigung ist in dem kleinen Klinikum schneller vorbei, als sie begonnen hat und auf einmal finde ich mich im Stationszimmer der Peripherstation wieder.
Darin sitzen ein etwas älterer Assistenzarzt und eine sehr jung aussehende, andere PJlerin. Sie heißt Marianne und scheint ihr Praktisches Jahr in der Kohorte vor mir gestartet zu sein. Die beiden stellen sich vor und heißen mich Willkommen.
Sobald ich mich umgezogen habe, schnappt sich der Arzt eine Liste der auf dieser Station einliegenden Patient*innen und erklärt mir in knappen Sätzen, warum diese stationär behandelt werden müssen. Während ich mir Notizen mache, merke ich, wie ich langsam aufgeregt werde: Jetzt geht es also endlich los. Ich werde lernen, wie es in der „echten" Praxis zugeht, ich werde nicht mehr nur die kleine Famul...