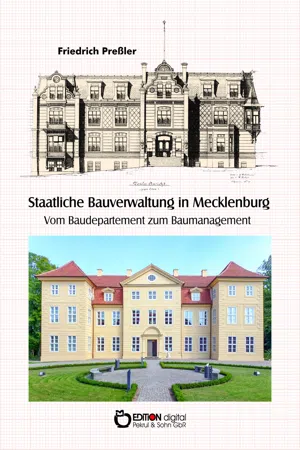Historischer Abriss
Die Staatshochbauverwaltung in Mecklenburg entwickelte sich ähnlich wie im Nachbarland Preußen, nur später und zögerlicher. Am 17. April 1770 unterzeichnete König Friedrich II. von Preußen (reg. 1740−1786) eine ausführliche Instruktion für ein Ober-Baudepartement für sämtliche Provinzen im Lande: Einen Summarischen Plan, wie das denen sämtlichen Provintzien negligierte Bauwesen auf einen beßem Fuß zu setzen sei […] zur Abstellung der beim Bauwesen bishero eingeschlichen gewesenen Mängel und Unordnungen. In der Dienstanweisung wird weiterfolgend erklärt, dass […] die bisherige Erfahrung gelehrt hat, dass das ganze Bauwesen teils durch die Unwissenheit und Nachlässigkeit des größten Teils der zeitigen Baubedienten, teils aus Bequemlichkeit, Vorurteilen und mancherlei unlauteren Ursachen und dem hinzukommenen Mangel einer hinreichenden und gewissenhaften Aufsicht bei den Kriegs- und Domänenkammern […] in großen Verfall geraten […] war. (Reinhart Strecke: Anfänge und Innovation der preußischen Bauverwaltung. Von David Gilly zu Karl Friedrich Schinkel. Köln/Weimar 2000; Vom Schönen und Nützlichen. David Gilly (1748‒1808), Ausstellungskatalog, hrg. von der Fachschule Potsdam und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 1998, S. 20‒23)
Abb. 1: Kabinettsdekret Friedrichs II. von Preußen vom 17. April 1770
In Preußen war erstmalig mit Kabinettsorder vom 1. Juni 1770 die Preußische Staatsbauverwaltung gegründet und damit eine fachliche Oberaufsicht über das gesamte Bauwesen im Staate ins Leben gerufen worden. Am 8. Juni 1770 nahm das neu eingerichtete Oberbau-Departement als erste zentrale Baubehörde die Arbeit auf, 1809 in Technische Oberbaudeputation mit strafferer Organisation umgewandelt, die 1799 gegründete Bauakademie verselbstständigt weitergeführt. Es waren ausschlaggebend wirtschaftliche Aspekte, die diesem Ansinnen (bei den ewig knappen Staats- und Hofkassen) nahe kamen, Erbauendes kostengünstig zu errichten und beständig zu erhalten durch hierfür baubefähigte, examinierte und bestallte Architekten (später ebenso Baumeister, Techniker und Ingenieure eingebunden). Auch in anderen deutschen Ländern entstanden kurz danach Bauverwaltungen parallel zur Entwicklung allgemeiner Verwaltungsgrundsätze.
Von einem staatlich organisierten Bauen in Mecklenburg kann um 1800 noch nicht die Rede sein. Es gab keine einheitliche, staatliche Baubehörde und noch kein geregeltes Baustudium. Ein unstrukturiertes Bauwesen war noch vor 1800 zu verzeichnen. (Geschichte der Staatsverwaltung in Mecklenburg, in: Verwaltungsgeschichte des Staates, Lehrbrief 5 (Lehrbriefe für das Fachschulfernstudium für Archivare), Fachschule für Archivwesen Potsdam (Hrg.), Potsdam o. J. [1958], ab S. 41 ff. Als Manuskript gedruckt, 191 S. (Kopie als Vorlage))
Architekten, Wasserbauexperten oder Landschaftsgestalter wurden bei Bedarf ins Land geholt und vertraglich gebunden. Ein durch Herzog Friedrich (reg. 1756‒1785) in der entstehenden Residenzstadt Ludwigslust 1776 errichtetes Hof-Bauamt (dem dortigen Hofkabinett unterstellt) hatte neben den angeordneten Bauvorhaben (Entwurf, Planung und Bau) gleichfalls Gutachten auf Anforderung des Hofes und des Geheimen Staatsministeriums (Das in Schwerin verbliebene Geheime Staatsministerium hatte den Landesherren in Grundsätzen zu beraten. Die Fachbereiche lagen dagegen in den Kammern und waren dem Kollegium nachgeordnet. Ihre Arbeitsweise war im Wesentlichen bis 1850 in Perioden kameralistisch festgesetzt.), die Verdingung von Bau- und Handwerksleistungen, Anfragen zur Baukasse, eine Überprüfung von Kostenanschlägen für staatliche und geistliche Bauten sowie ästhetische Studien für die vielfältigsten Ideen und Hoffeste im Auftrag des Fürstenhauses mit zu erledigen.
Zuvor, 1750, war der französische Bau- und Gartenarchitekt Jean Laurent Legeay eingestellt worden (Näher erläutert in Norbert Credè: „Eine besondere […] unter unserer Protection neu-angebaute Stadt“. Die Gründung der Schweriner Neustadt (Schelfstadt) vor 300 Jahren, in: Mecklenburgische Jahrbücher 120 (2005), S. 79 (Bezug Jean Legeays).) und als Hofbaudirektor bis zu seinem Weggang 1756 nach Berlin in dem Filialdorf Kleinow (auch Klenow genannt), dem späteren Ludwigslust, tätig. In der entstehenden Residenzstadt Ludwigslust war Johann Joachim Busch (1720‒1802) (Ausführlich bei Horst Ende: Ein Architekt zwischen Barock und Klassizismus. Johann Joachim Busch zum 200. Todestag, in: Denkmalschutz und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Hrg. Landesamt für Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Heft 10, Schwerin 2003, S. 1‒13; Übersichtlich in Horst Ende: Busch, Johann Joachim, in: Andreas Röpcke (Hrg.): Biographisches Lexikon für Mecklenburg (Veröffentlichung der Historischen Kommission für Mecklenburg Reihe A, Band 8), Schwerin 2016.), eigentlich ein Architektur-Autodidakt mit künstlerischer Neigung, seit 1758 Hofbaumeister und seit Gründung bis Ende 1795 Leiter dieses neu errichteten herrschaftlichen Bauamtes.
Busch war als sehr guter Zeichner und Bildhauer (Skulpteur) bereits 1748 vom herzoglichen Hof übernommen worden. Die Regierung verblieb weiterhin in der alten Residenzstadt Schwerin. Buschs Mitarbeiter waren der Bauführer Langbeen, der Bauschreiber Grantzow, danach Bauschreiber Michaelis sowie zeitweise Bauinspektor Christian Behrens (Er war einer der wenigen, der auch als Autor hervortrat, Christian Ernst August Behrens (Hrg.): Die Mecklenburgische Land-Baukunst oder Sammlung von Originalzeichnungen wornach gebauet worden ist, und noch gebauet wird zum Gebrauch für Guts=besizzer, Beamten, Forst- und Oekonomie-Bedienten und Pächtern: mit Bau=Anschlägen und 35 Kupfer=Tafeln, Schwerin/Wismar: Bödner 1796. (enthalten sind weiterhin Materiallisten und Kostenanschläge für unterschiedliche Zweckgebäude und Wohnbauten sowie eine Anzahl von Baubeschlägen und mögliche Bau-Verbindungsmittel); Ergänzend hierzu Grete Grewolls: Damit Bauer und Pächter ihre Bequemlichkeit haben, in: Mecklenburg Magazin 1995 Nr. 3, S. 12.) aus Hagenow. Oberbaurat Busch wirkte maßgeblich mit am Aufbau der spätbarocken Residenzstadt, plante die Hofkirche mit nahem Friedhof (heute Evang.-Luth. Stadtkirche zu Ludwigslust) und die neue Schlossanlage (Abb. 2 Plan 1). Sein Wirken war nicht nur allein auf Kleinow/Ludwigslust bezogen. Busch hatte gleichfalls Aufträge im Lande auszuführen. Er zeichnet auch für den Entwurf des ersten katholischen Kirchenbaus nach der Reformation in Mecklenburg verantwortlich: die Propsteikirche St. Anna in Schwerin (1795). Mit dem Säulengebäude (Neues Gebäude, 1785) am Alten Markt wertete Busch das gesamte Ensemble vor dem Schweriner Dom auf. Sein Bemühen nach einfachen, funktional bestimmten Architekturformen ist an seinen Arbeiten ablesbar.
Abb. 2 Plan 1: Ludwigslust um 1780, Nachzeichnung von Walter Ohle nach dem Plan von (Ernst Christian August) Behrens
Als Nachfolger im Hofbauamt in Ludwigslust wurde Artillerie-Hauptmann und nun Hofbaumeister Johann Christoph Heinrich von Seydewitz (1748‒1824) berufen. Als Baukondukteur war von Seydewitz zuvor bei Landbaumeister Karl Bentschneider im Kammerkollegium des Geheimen Staatsministeriums in Schwerin tätig. Von Seydewitz plante unter anderem Um- und Erweiterungsbauten für die Universität Rostock (1792) und für das erste deutsche Seebad Heiligendamm (Doberan) das Haus Mecklenburg (1795/96) sowie in Doberan das Amtshaus (1793) und das Logierhaus (1796), heute Hotel. Von Seydewitz war an der Spitze des Hofbauamtes nicht die Persönlichkeit von allzu großer, ideenreicher Schaffenskraft und städtebaulicher Tätigkeit, gemessen an seinem Vorgänger Busch, obgleich er den Klassizismus der Berliner Schule in der Planung vertrat, gern aber zurückgriff auf die traditionellen Formen des bürgerlichen Fachwerkbaus.
Anfang 1809 stellte Herzog Friedrich Franz I. (reg. 1785‒1837) Hofbaudirektor von Seydewitz zur Disposition und übertrug Johann Georg Barca, gleichzeitig mit der Errichtung von Baudistrikten im Lande, die Hof- und Landbaumeisterstelle. (Johannes-Paul Dobert: Bauten und Baumeister in Ludwigslust. Ein Beitrag zur Geschichte des Klassizismus. Magdeburg o. J. [1920], S. 31 ff.) Die für die neue Residenz benötigte Postroute Schwerin‒Ludwigslust über Ortkrug und Wöbbelin hatte eine Entfernung von vier ¾ Meilen (ab Postmeilenstein (Obelisk) Ludwigslust ca. 35 km, etwa die heutige B 106). Die Pferde der Express- bzw. „Hofcourse“ wurden mehrmals gewechselt, zumindest aber auf halber Strecke in Ortkrug am Marstall-Gebäude mit dem herzoglichen Rasthaus.
Regierungsseitig leitete der bereits genannte Karl Friederich Bentschneider (+ 1814) im Kammerkollegium des Geheimen Staatsministeriums in Schwerin seit 1784 das Ressort des Landbauwesens zur Unterstützung der Ämter für das gesamte Domanium. Ihm standen anfänglich ein Assessor (Baukondukteur) und ein Aktuar zur Verfügung. Das mecklenburgische Domanium war der staatsrechtlichen Definition nach jener Flächenanteil des Landes, in welchem das echte Eigentum dem Landesherrn zustand, neben den ritterschaftlichen (adliger und bürgerlicher Gutsbesitz) und den städtischen Gebieten sowie dem kirchlichen Grundbesitz. Das Domanium entsprach dem landesherrlichen Staatsbesitz, worauf der Großherzog bis 1918 direkten Einfluss nahm. Die Verwaltung dieser fürstlichen Ländereien oblag der Domänenkammer. Zentralbehörden waren vor 1850 die großherzogliche Regierung, das Kollegium, mit den Kammern. In seiner Autorität behielt sich der Großherzog alle Entscheidungen vor. Der Geschäftsvorgang verlief kollegial, es wurde abgestimmt. Nur bei der Behandlung von Fachfragen (hier im Hoch-, Wasser- und Straßenbau) verfügten Technische Mitglieder aus dem Landesverwaltungskollegium über ein Stimmrecht. Für Kollegialbeschlüsse galt der Grundsatz der Verantwortung: zuerst der Referent, der den Vorgang bearbeitete, dann der Koreferent, schließlich das Kollegium. Das Kammer- und Forstkollegium verwaltete das Domanium. Und doch fehlte es einigen Vertretern der hohen Beamtenschaft in der Regierung an einem entsprechenden Bildungsstand, um den Sprung vom Kollegial- zum Bürosystem zu rechtfertigen. Es überwog ein konservatives Verhalten. Die Defizite in zentral zu regelnden Bauangelegenheiten und ein Fehl an kompetenten, zukünftigen Landbaumeistern wurden noch lange Zeit ignoriert. Die Regierung regelte die allgemeinen landesherrlichen Verwaltungsaufgaben nach innen und außen, wesentlich auch in Abstimmung mit Mecklenburg-Strelitz. (Ausführlich unter Hochbauverwaltung in Anmerkung 8 (Staatsverwaltung Mecklenburg [1958]), Kopie als Vorlage
Die Zentralverwaltung in Mecklenburg-Strelitz entsprach auf dem Papier dem Schweriner Vorbild, war aber in Wirklichkeit weit bescheidener. Das Kammer- und Forstkollegium verwaltete auch dort das Domanium. Nach dem Erlass vom 15. Dezember 1824 wurde hier erstmalig ein Hofbauamt eingerichtet und im Dezember 1848 zu einem Baudepartment umbenannt und erweitert. Diese Behörde war im vorgenannten Kollegium angesiedelt. Baudistrikte, wie seit 1809 in Mecklenburg-Schwerin, gab es aufgrund der Landesgröße nicht. Diese neuen Verwaltungsstrukturen Baudistrikt und Baudepartement werden nachfolgend noch näher erläutert. Das Staatsministerium nahm die Regierungsgeschäfte wahr. Seit ihrer Neuorganisation im Jahre 1909 (nach der Verordnung vom 16. Dezember 1908) bestand in Mecklenburg-Strelitz das Staatsministerium mit einem Staatsminister aus drei Ministerialabteilungen: erstens für die Justiz, die geistlichen, die Unterrichts- und die Medizinalangelegenheiten, zweitens für die Finanzen mit der Unterabteilung für Domänen, Forsten und Bauen und drittens für das Innere. Anstelle des Baudepartements war die Staatsbauverwaltung in Neustrelitz jetzt in dieser Unterabteilung integriert und wurde auch nach 1900 von Oberbaurat Eugen Müschen weiterhin geleitet. Verwaltungsmäßig wurde keine behördliche Trennung zwischen dem Profan- und Sakralbau vorgenommen. Der Staatsminister übernahm mit einem eigenen Geschäftsbereich auch die großherzoglichen Hausangelegenheiten mit den Hofdienststellen (bis 1918). Öffentliche Bauangelegenheiten im zugehörigen Fürstentum Ratzeburg hatte das Amt Schönberg zu regeln. Mit dem Hamburger Vergleich von 1701, nach dem Aussterben der Güstrower Linie, wurde das Fürstentum Ratzeburg Teil des Herzogtums Mecklenburg-Strelitz.
In Mecklenburg-Schwerin gab es um 1800 44 Ämter mit 33 Amtssitzen. 24 der Amtshäuser sind in einem Häuserzyklus als „Ämtergalerie“ in der heutigen Staatskanzlei (ehemals Kollegiengebäude), im jetzigen Kabinettsaal der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, zu betrachten. Diese fast ein Meter hohen Wandbilder schuf 1867 der Architekturmaler Friedrich Jentzen (1815‒1901). Da in zahlreichen Ämtern auch die zuständigen Amtsgeri...