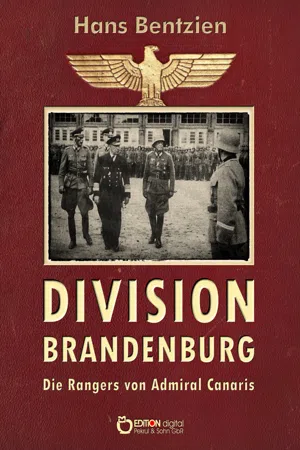Operation „Barbarossa“
Es war den „Brandenburgern“ klar geworden, dass nach ein paar Urlaubstagen der harte Schliff, der wieder begann, seine besonderen Gründe hatte. Die abenteuerlichsten Gerüchte schwirrten durch die Reihen. Viele glaubten, dass nunmehr, nach dem Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion die große Fahrt nach dem Nahen Osten begann, durch die russischen Weiten, über den Kaukasus, durch Persien und von dort nach Afghanistan und in den Irak. Das sei überhaupt der Sinn des Paktes mit Moskau gewesen. Was war der Führer doch für ein Genie, der große Feldherr. Das Wort Barbarossa kannten sie noch nicht als Tarnbezeichnung für das größte Kriegsunternehmen aller Zeiten, und doch war es bereits in den Akten des OKW. Während noch an den Plänen für die Eroberung Gibraltars und den Feldzug gegen Griechenland gearbeitet wurde, ordnete Hitler an, die anfänglich „Operation Fritz“ genannten Eroberungspläne gegen die Sowjetunion, seit 18. Dezember 1940 nun auf seinen Befehl hin „Operation Barbarossa“, auszuarbeiten. Seit dem Sommer 1940 war sein Entschluss bereits dem Oberbefehlshaber des Heeres, Brauchitsch, und seinem Generalstabschef Haider bekannt.
Hitler rechnete mit drei bis fünf Monaten, um die Wolga zu erreichen. Ziel des Feldzuges sei es, den ideologischen Gegner zu zerschlagen, den Lebensraum im Osten zu erweitern und sich die reichen Rohstoffvorkommen anzueignen. Der große Staat, ein Siebentel der Erde, sei in Teilstaaten zu zergliedern und die politische Landkarte vollkommen zu verändern. Über diese Absicht spricht er mit dem neu ernannten japanischen Botschafter Oshima Ende November auf dem Berghof bei dessen Antrittsbesuch. In der Nacht erfährt es Richard Sorge in Tokio und teilt diese Nachricht Moskau mit, ohne dort Glauben zu finden. Zur gleichen Zeit leitet Generalleutnant Paulus ein Planspiel im OKH, um die Strategie des Überfalls und des danach erfolgenden Blitzkrieges zu testen. Dabei wird sehr stark die Nordfront bearbeitet. Es soll die Küste mit den Ostseehäfen und Leningrad mit Kronstadt noch vor Moskau genommen werden. Ein Grund dafür, dass die „Brandenburger“ in ihren drei Standorten dafür besonders vorbereitet werden.
Im nüchternen Text des Kriegstagebuches vom 18. Dezember 1940 heißt es über „Mitte der Gesamtfront“: „Den südlichen dieser beiden Heeresgruppen fällt die Aufgabe zu, mit besonders starken Pz.- und mot. Verbänden aus dem Raum um und nördlich Warschau vorbrechend die feindlichen Kräfte in Weißrussland zu zersprengen. Dadurch muss die Voraussetzung geschaffen werden für das Eindrehen von starken Teilen der schnellen Truppen nach Norden, um im Zusammenwirken mit der aus Ostpreußen in allgemeiner Richtung Leningrad operierenden nördlichen Heeresgruppe die im Baltikum kämpfenden feindlichen Kräfte zu vernichten. Erst nach Erledigung dieser vordringlichsten Aufgabe, welcher die Besetzung von Leningrad und Kronstadt folgen muss, sind die Angriffsoperationen zur Besitznahme des wichtigsten Verkehrs- und Rüstungszentrums Moskau fortzuführen. Nur ein überraschend schnell eintretender Zusammenbruch der russischen Widerstandskraft könnte es rechtfertigen, beide Ziele gleichzeitig anzustreben.“
Mit einer Formel kann dieser Plan auf die Kernaussage gebracht werden: erst Leningrad, dann Moskau besetzen. Und: Es muss rasend schnell gehen, sonst ist ein Blitzkrieg unmöglich. Die Siegesparade auf dem Roten Platz war für den 7. November, den Tag der Oktoberrevolution, angesetzt. An einen Winterkampf war nicht gedacht, daher wurden auch keine geeigneten Uniformteile produziert. Die Führung der Wehrmacht ging davon aus, dass es gelingen müsse, „die im westlichen Russland aufmarschierten Streitkräfte des Gegners unter Vortreiben starker Panzerkeile einzukesseln und zu vernichten, um schließlich eine Abwehrlinie zu erreichen, aus der die sowjetische Luftwaffe dem deutschen Reichsgebiet nicht mehr gefährlich werden kann“.
Dieser Taktik des starken Vortreibens der Panzerkeile und der danach erfolgenden Einkesselung großer sowjetischer Einheiten dienen die Einsätze der „Brandenburger“ vor allem im Norden der Ostfront.
Nach der Festlegung vom 18. Dezember waren alle Teile der Wehrmacht dabei, ihre Vorbereitungen zu treffen. Canaris reagierte sofort mit der Einrichtung von drei Frontaufklärungs-Leitstellen, welche die Tarnbezeichnungen „Walli“ erhielten. Die Stelle „Walli I“ arbeitete von der polnischen Stadt Sulijewsk aus, also im südlichen Angriffsbereich, „Walli II“ bezog in Suwalki, im Memelgebiet, Station für den Norden, und „Walli III“ richtete sich in Breslau ein, wenn auch nur vorübergehend. Während die Abwehr die Pläne für die Sabotage, Spionage und die Kampfeinsätze ausarbeitete, beschäftigte sich die Abteilung Fremde Heere Ost beim OKH mit der Analyse der „Kriegswehrmacht der Sowjetunion“. Die Verzahnung der beiden Zentralen sollte in gegenseitiger Absprache erfolgen, wobei für die Abwehr die Breslauer Stelle federführend war, aber es hat anscheinend nicht funktioniert, wie überhaupt die Spitzengliederung in der Wehrmacht sehr unzulänglich war, später sogar chaotisch wurde, als Hitler auch den Oberbefehl über das Heer übernahm.
Jedenfalls sprach Keitel ein Machtwort und übertrug seinem Abwehrchef Canaris die notwendigen Vollmachten, indem er ihn zum „Koordinator aller geheimdienstlichen und militärischen Aktionen zur Verschleierung des deutschen Aufmarsches gegen Russland“ ernannte. Dieser wiederum machte seinen Abteilungsleiter für Gegenspionage zum Vertreter der Abwehr in Zossen beim Heeres-Generalstab. Für seine komplizierte Tätigkeit bekam er als Direktive, an der Lähmung der sowjetischen Nachrichtenstellen mitzuwirken, die ausländischen Nachrichtendienste durch Meldungen eigener Agenten irrezuführen, indem Meldungen über positive Beziehungen zwischen der Wehrmacht und der Roten Armee gestreut wurden, sogar Gerüchte über gemeinsame Pläne mit der Sowjetunion gegen England wurden kolportiert. Das schwierigste Problem bestand aber in der Tarnung der geheimen Truppentransporte nach Osten. Der sowjetische Nachrichtendienst hatte bereits erfahren, dass genaue Berichte über die Durchlassfähigkeit der Bahnstrecken vom OKW angefordert worden waren.
Auch die erste Kompanie der „Brandenburger“ machte sich Anfang Februar auf den Weg nach Osten. In der Nähe von Allenstein in Ostpreußen begann sie mit der Vorbereitung des Überfalls. In dieser Zeit kämpften die anderen Einheiten noch in Griechenland und im Angriff auf Belgrad, wo sie die Aufgabe hatten, den Generalstab zu besetzen und die geheimen Archive zu sichern und abzutransportieren. Besonders auf die Unterlagen der britisch-jugoslawischen Zusammenarbeit kam es der Abwehr an. Canaris erschien selbst am 18. April in Belgrad, um sich von der Effektivität der Abwehrstelle zu überzeugen und sich zu informieren, ob die Unmengen an Akten auch sicher über den Wasserweg nach Wien zur Auswertung gelangen würden. Auf ähnliche Weise wurden auch die Unterlagen des Marineministeriums in Athen gesichert, eine Gruppe von Gräzisten trat dort entschlossen auf, und der Minister übergab ihnen alle Papiere. Unglaublich, dass dort keinerlei Vorkehrungen zur Vernichtung getroffen wurden.
Doch nach dem Bericht Canaris’ bei Hitler, worüber nichts bekannt ist, denn sie sprachen unter vier Augen miteinander, geht der Abwehrchef entschlossen an die „Operation Barbarossa“. Hier ist all seine Schläue gefragt. Sein Ziel, das er persönlich ansteuerte, war die sowjetische Botschaft in Berlin. Natürlich kannte er den Militärattaché, und es kam ihm nun darauf an, diesen mit Fehlinformationen zu versorgen. Dabei stützte er sich auf einen umgedrehten sowjetischen Agenten, der als Mitarbeiter der Botschaft inzwischen für die Deutschen arbeitete. Dieser bestätigte seinem Botschafter, dass die Nachrichten über Truppenkonzentrationen im Osten nur Gerüchte seien, die von den Engländern gestreut würden, um die guten Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion zu stören.
Die Sowjets werden diese Tricks aus der Küche der Gegenspionage wohl durchschaut haben, denn auch sie hatten noch andere Quellen und bereiteten sich, wenn auch unzulänglich und zu spät, auf die Verteidigung vor. Sie verstärkten die Abwehrkräfte an ihrer Westgrenze, woraus später - und bis heute noch anzutreffen - die Behauptung entstand, die Sowjetunion hätte Deutschland angreifen wollen, Hitler wäre mit einem Präventivschlag zuvorgekommen. Die Tatsachen sprechen eine andere Sprache.
Die späteren Behauptungen, in der Abwehr sei ein Widerstand gegen die Ausdehnung des Krieges auf die Sowjetunion entstanden, finden keine Belege. Auch Canaris, der als graue Eminenz und Schirmherr der Widerständler von früheren Abwehrleuten als Aushängeschild verehrt wird, setzt alle seine Kräfte für den angesteuerten blitzartigen Überfall ein. Bereits Ende März wird die Vorbereitung getroffen, um ein umfassendes Agentennetz in den zu erobernden Gebieten aufzubauen. Die ersten Sabotagetrupps werden gebildet und eingewiesen. Alles konzentriert die Planung auf die Bewältigung der natürlichen und ausgebauten Hindernisse, die einen zügigen Vormarsch behindern könnten. Im Visier natürlich die Eisenbahnverbindungen, ihre Knotenpunkte und der Funk- und Telefonverkehr der Armee.
Die Zielstellung des Ostfeldzuges ist inzwischen von Hitler gebilligt und in einer Richtlinie formuliert worden, die am 3. März 1941 von Keitel bekannt gegeben wird. Sie lautet:
„Dieser kommende Feldzug ist mehr als nur ein Kampf der Waffen; er führt auch zur Auseinandersetzung zweier Weltanschauungen. Um diesen Krieg zu beenden, genügt es bei der Weite des Raumes nicht, die feindliche Wehrmacht zu schlagen. Das ganze Gebiet muss in Staaten aufgelöst werden mit eigenen Regierungen, mit denen wir Frieden schließen können.
Die Bildung dieser Regierungen erfordert sehr viel politisches Geschick und allgemeine wohlüberlegte Grundsätze.
Jede Revolution großen Ausmaßes schafft Tatsachen, die man nicht mehr wegwischen kann. Die sozialistische Idee ist aus dem heutigen Russland nicht mehr wegzudenken. Sie kann allein die innerpolitische Grundlage für die Bildung neuer Staaten und Regierungen sein. Die jüdisch-bolschewistische Intelligenz, als bisheriger Unterdrücken des Volkes, muss beseitigt werden. Die ehemalige bürgerlich-aristokratische Intelligenz, soweit sie vor allem in Emigranten noch vorhanden ist, scheidet ebenfalls aus. Sie wird vom russischen Volk abgelehnt und ist letzten Endes deutschfeindlich. Dies gilt auch in besonderem Maße für die ehemaligen baltischen Staaten.
Außerdem müssen wir unter allen Umständen vermeiden, anstelle des bolschewistischen nunmehr ein nationales Russland treten zu lassen, das, wie die Geschichte beweist, letzten Endes wieder deutschfeindlich sein wird.
Unsere Aufgabe ist es, sobald wie möglich mit einem Minimum an militärischen Kräften sozialistische Staatsgebilde aufzubauen, die von uns abhängen. Diese Aufgaben sind so schwierig, dass man sie nicht dem Heere zumuten kann.“
Die Sprache dieses wirren Gedankengebildes weist eindeutig auf Hitler hin. Der Sozialismusbegriff ist nach seiner Auslegung gebunden an einen Führerstaat nach deutschem Beispiel. Die Militärs ändern daraufhin ihre Richtlinie ab und geben ihr eine neue Fassung:
„Entsprechend dieser Richtlinie des Führers müsse die Weisung folgendermaßen umgeändert werden:
Das Heer brauche ein Operationsgebiet. Man müsse es aber der Tiefe nach so weit wie möglich beschränken. Dahinter sei keine militärische Verwaltung einzurichten. An ihre Stelle hätten vielmehr für bestimmte volkstummäßig abzugrenzende Großräume Reichskommissare zu treten, denen der schnelle politische Aufbau neuer Staatsgebilde obliegen würde. Ihnen zur Seite sollten >Wehrmacht-Befehlshaber< treten, die nur in rein militärischen Fragen, die mit der Fortführung der Operationen zusammenhingen, dem Ob.d.H., im übrigen aber dem OKW, unterstehen würden. In diese Stäbe seien auch alle Organisationen einzubauen, die ohnehin Sache der Wehrmacht seien (Wehrwirtschaft, Nachrichtenwesen, Abwehr usw.). Die Masse der Polizeikräfte werde zu den Reichskommissaren treten.
Die Grenzsperre könne sich nur auf das Operationsgebiet erstrecken. Ob es notwendig sei, auch dort schon Organe des Reichsführers SS neben der Geheimen Feldpolizei einzusetzen, müsse mit dem Reichsführer SS geprüft werden. Die Notwendigkeit, alle Bolschewistenhäuptlinge und Kommissare sofort unschädlich zu machen, spreche dafür. Militärgerichte müssten für alle diese Fragen ausgeschaltet werden, sie hätten sich nur mit den Gerichtssachen innerhalb der Truppe zu befassen.“
Der Entwurf wird nun überarbeitet und nach Hitlers nochmaligen Korrekturen zehn Tage später in Kraft gesetzt. In der umständlichen Darlegung ist folgender Plan versteckt:
Die eroberten Gebiete werden nicht militärisch durch Ortskommandanten verwaltet, mit Ausnahme des direkten Frontstreifens. Deutschland schickt Regierungskommissare, die diese Verwaltung übernehmen und mit sowjetfeindlichen Kräften eigene Staaten aufbauen sollen. Diese Nazi-Kommissare sind Parteifunktionäre. Diese Staaten besitzen keine Souveränität, sondern sind von deutschen Weisungen abhängig.
Genau nach diesen Richtlinien wird während der Besetzung hinter der Front gearbeitet. Die sowjetische Führungsschicht wird liquidiert. Gerichte gibt es nur für deutsche Angeklagte. Sonst gilt willkürliches Standrecht gegen Funktionäre des Staates und der Partei sowie gegen die Bevölkerung, wenn sie nicht schnell genug den Weisungen der Besatzungsmacht nachkommt. Hier ist das Terrorsystem vom Kern her angelegt. Jeder Soldat marschiert für diese Ziele des Hitlerreiches, ist also Unterdrücker anderer Völker. In diesem Dokument erscheint neben der allgemeinen Erwähnung der Abwehr auch der Begriff „Geheime Feldpolizei“. Sie ist ein exekutives militärisches Organ der Abwehr und untersteht dem Kommando von Canaris. Wir werden noch sehen, dass sie nicht nur neben den Polizeieinheiten (SD) arbeitet, sondern eng mit ihnen zusammen und in ihren Methoden keinen Unterschied erkennen lässt.
Die gewaltige militärische Maschinerie wird nun in Marsch gesetzt. Das OKW gibt in der Nacht vom 21./22. Juni 1941 das Stichwort „Dortmund“ durch. Damit ist der Angriffstermin nicht mehr zu verändern. Die „Brandenburger“ sind in Wartestellung, ein Teil, insbesondere die Frontaufklärungskommandos, sind bereits im feindlichen Gebiet angekommen, nachdem sie in den Tagen zuvor in die frontnahen Gebiete eingesickert waren. Am 22. Juni, zwischen 3.05 Uhr und 3.15 Uhr, treten die drei Heeresgruppen Nord, Mitte und Süd zum überraschenden Angriff auf die Sowjetunion an. Sie sollen in drei bis fünf Monaten an der Wolga stehen. Die „Brandenburger“ sind eine feste Größe in diesem Blitzkrieg. Sie sollen die Panzerspitzen führen und ihnen den Weg freimachen. Dazu kämpfen sie mit Täuschung und Tarnung. Sie wussten, dass sie damit gegen das Kriegsrecht verstießen.
Einer ihrer Männer schreibt in seinen Erinnerungen: „dass ein missglücktes Tarnunternehmen für den gesamten Einsatz den Tod bedeutete, war uns allen bewusst. Wir durften vonseiten des Feindes auf keinerlei Schonung hoffen. Wir hatten nicht einmal das Recht auf Kriegsgefangenschaft, denn wir standen außerhalb der geltenden Kriegsgesetze. Wir wussten alle, dass wir, sollten wir lebend in die Hände des Feindes fallen, nicht einmal das Recht auf Erschießung hatten. Man würde uns ohne Federlesens aufhängen.“ Sie wussten also, was sie taten.
Alle diese Fronteinsätze beruhten auf Tarnung und Täuschung. Da die neu gelieferten Uniformen leicht Argwohn erregen konnten, wurden sie abgelegt und durch die verschwitzten und verdreckten Uniformen ausgetauscht, welche man den Kriegsgefangenen auszog. Die deutschen Waffen wurden versteckt. Sprachkundige Soldaten saßen an den Lenkrädern oder auf dem Beifahrersitz, sie sprachen mit den Wachposten und fluchten wie die Landser überall fluchen und machten so die Wege frei. Zehn Kompanien der „Brandenburger“ wurden an die Ostfront verlegt, eine davon an den Südabschnitt. Sie wurden für ihre Aufgaben unterteilt in sogenannte Halbkompanien, das heißt in selbstständige Kampfverbände, die unter dem Befehl eines Offiziers standen. Ihre Aufgabe bestand darin, sämtliche Brücken, die für einen schnellen Vormarsch entscheidend waren, unversehrt in die Gewalt der Wehrmacht zu bringen. Alle Eventualitäten waren hundertmal geübt, mit Verlusten wurde gerechnet.
Bereits der erste Einsatz an einer Eisenbahnbrücke bei Augustowo zeigte die Schwierigkeiten dieser Unternehmen. Von der sowjetischen Seite war der hölzerne Bohlenbelag abmontiert worden. Also mussten eigene Bohlen herangeführt werden, um die Brücke passieren zu können. Um genauere Angaben zu erhalten, wurde ein Sprachkundiger, der Gefreite Rau, zur Aufklärung geschickt, ein Zeichen war vereinbart worden. Das Zeichen kam nicht, statt dessen glaubten die Wartenden, ein Röcheln gehört zu haben. Wie soll die See-Enge ohne genaue Kenntnis der Örtlichkeit überwunden werden? Die Straße ist vermint, die Straßenbrücke leicht einsehbar. Der Offizier, Leutnant König, zögert und wartet den für 3.05 Uhr vorgesehenen Feuerüberfall durch die Artillerie ab. Als er beginnt, schleicht und kriecht der Trupp mit seinen Bohlen vor. Er folgt den Brettern über den sumpfigen Bach, die Rau gelegt hatte. Doch er war durch einen sowjetischen Posten beobachtet worden. Dieser sprang ihn lautlos von hinten an und drückte ihm die Kehle zu. Daraus ergibt sich, dass auch die Sowjets mit Kundschaftern in ihrer eigenen Uniform gerechnet hatten. So leicht konnte man auch deren Frontaufklärer nicht täuschen. Anders war es mit den einfachen Truppen. In der Dämmerung schlich sich der Trupp in die Rückwärtsbewegung ein und überquerte die Brücke. Bei der Beseitigung der Sprengladungen wurden die Deutschen erkannt und erhielten starkes Feuer. Der Leutnant fiel.
Auch ein Dreimanntrupp, der eine Straßenbrücke in Richtung Grodno sichern sollte, wurde entdeckt und zwei Mann getötet. Eine weitere Brücke in der Nähe des Dorfes Cholynka wird zuerst besetzt, da die Wachen sich durch die sowjetischen Uniformen anfangs täuschen lassen. Dann aber, kurz vor Eintreffen der infanteristischen Vorausabteilungen, fliegt die Brücke in die Luft, die Fernzündung wurde ausgelöst. Bei einer weiteren Brücke wurde der Trupp durch sowjetische Posten gestoppt und nach der Parole gefragt. Eine falsche Losung wurde genannt, der Posten nahm die vermeintlichen Russen gefangen und brachte sie nach hinten, vergaß aber den Offizier nach Waffen abzusuchen. Bei einer Unaufmerksamkeit des Postens zog der Leutnant seine Pistole und erschoss beide Begleiter. Das weckte die ganze Front noch vor der Angriffszeit, Leuchtkugeln stiegen hoch, eine allgemeine Schießerei begann. Die „Brandenburger“ hatten sich im Gestrüpp versteckt, als die deutsche Infanterie nach einer guten halben Stunde ankam, erhoben sie sich - und wurden beschossen. Ein polnischer Führer fiel, ein Soldat wurde verwundet. Die Infanterie hatte nichts von einem Tarneinsatz gewusst und sie für Russen gehalten.
Die beiden unversehrt gebliebenen Männer gingen weiter auf ihr eigentliches Ziel, die Brücke bei Lipsk, zu, ließen sich von einem sowjetischen Posten den besten Weg dorthin beschreiben und reihten sich, trotz der mitgeführten deutschen Waffen, in die zurückflutenden sowjetischen Einheiten, die alle über die Brücke wollten, ein. Als sie auf der Brücke eine Kontrolle nach Sprengladungen vornahmen, hielt man sie für sowjetische Pioniere, die sprengen wollten. Aber die sowjetische Pioniermannschaft rückte gerade an. Als sie auf 70 Meter heran war, eröffneten die beiden Deutschen das Feuer, um Zeit zu schinden. Sie hofften auf baldige Ankunft der deutschen Vorausabteilung. Das gelang, aber sie wurden beide in diesem Kampf getötet.
In den Kämpfen dieser Tage wurde auch zum ersten Mal die Luftlandekompanie der „Brandenburger“ eingesetzt. Gegen den Widerstand der Luftwaffenführung war sie bei Bernau ausgebildet worden. Canaris hatte sich durchgesetzt. Er wollte speziell ausgebildete Männer, die selbstständig handeln konnten, auch wenn nicht alles nach Plan verlief. Und das war bei diesem ersten Einsatz der Fall. Als die drei Maschinen vom Typ Ju 52, die Fallschirme an Bord, endlich einflogen, wurde gerade mitgeteilt, dass die Objekte bereits von den Panzertruppen erreicht worden waren. Am nächsten Tag dann eine neue Aufgabe, die Verlegung auf einen anderen Feldflugplatz, dort wieder warten auf ein neues Ziel. Zwei weitere Tage später sollte ein Einsatz folgen, aber am späten Nachmittag, man hatte seit dem Sonnenaufgang in Bereitschaft gelegen, kam doch noch der Befehl zum Einsatz. Im Tiefflug, zuletzt nur 30 Meter über dem Boden, waren die drei Maschinen auf Heckenspringerart ein Plateau angeflogen, wo die Landung nach einer Schleife erfolgen sollte. Doch ein starkes Abwehrfeuer...