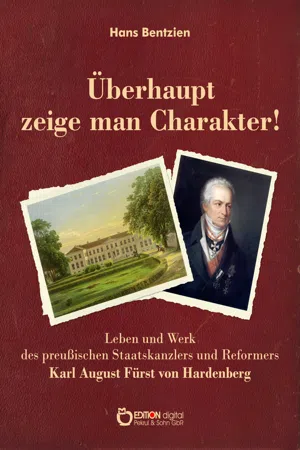Im System der Restauration
Sollte nun, nachdem der wahnwitzige Gedanke Napoleons an eine Weltherrschaft gescheitert war, eine neue Dreier-Macht über die Völker kommen? In der schwersten Zeit der Erniedrigung hatte in Berlin der Philosoph Johann Gottlieb Fichte, den seinerzeit Hardenberg nach Erlangen berufen hatte, seine aufrüttelnden „Reden an die deutsche Nation“ gehalten. Die Erneuerung müsse zuerst in nationalen Grenzen erfolgen. Für ihn war das Deutsche die eigentliche Offenbarung des Menschentums. Die Deutschen müssten schon aus ethischer Überzeugung einen Nationalstolz entwickeln. Damit würden sie wieder den Glauben an sich selbst finden. Wenn seine aus diesem Gedanken entwickelten Theorien auch überhöht klingen, so begann doch mit seinen Reden die Auseinandersetzung über die Rolle der Deutschen in der Welt. Ihm zur Seite stand der Theologe Friedrich Schleiermacher, jedoch waren seine Thesen gemilderter. Als Rektor der 1810 gegründeten Berliner Universität berief Fichte nationalbewusste Reformer auf die Lehrstühle. Hardenberg gehörte zu den Gründern der Universität und wurde einer ihrer ersten Ehrendoktoren.
Der nationale Gedanke fand ein tiefes Echo bei den Studenten, den „Turnern“, die sich damals gründeten. Diese Strömung griff Ernst Moritz Arndt 1820 mit der Frage auf: „Was ist des Deutschen Vaterland?“ Und er antwortete, dass es größer sein müsse, als die alten Stämme der Preußen, Bayern, Holsteiner, Rheinländer und der anderen: „Das ganze Deutschland muss es sein!“ Von dieser nationalen Woge, die sehr starke nationalistische Ausformungen hatte und auch antisemitisch und fremdenfeindlich gefärbt war, wurde der Befreiungskampf getragen.
Nun sollten die Versprechungen des Königs eingelöst werden, forderten die Heimkehrer aus den Kriegen. Doch die Realität sah anders aus. Während jeder noch die Losungen im Ohr hatte: „Nichtswürdig ist die Nation, die nicht alles setzt an ihre Ehre!“, warteten die zurückgekehrten, oftmals verwundeten Soldaten und die Witwen der Gefallenen auf eine versprochene Versorgungsregelung, auf Hilfen bei der Überwindung der Alltagsnot. Aber sie kam nicht. Statt der Bildung einer starken deutschen Nationalrepräsentation entstand nur der Deutsche Bund ohne rechte Kraft zur Veränderung. Statt einer Zentralgewalt im Bund trat wieder die Erhaltung der Kleinstaaten mit ihren Sonderinteressen und vielen Fürstenhäusern, die nichts bewegten außer ihren Steuerbeamten.
Lediglich die Reformpläne Hardenbergs in Preußen wirkten auf die Erfüllung der in Tilsit formulierten Forderungen, aber der König wollte immer weniger davon wissen. Er glaubte weiterhin an das Gottesgnadentum als die beste aller Weltregierungen. Um ihn scharte sich eine Hofpartei mit dem Kronprinzen als Sprecher, die den Reformbestrebungen immer mehr Widerstand entgegensetzten. Trotzdem machte der Kanzler, gestützt auf seine Position und die dafür in Kraft gesetzten Gesetze weiter, musste aber immer mehr Gegenwehr im Staatsrat spüren. Hier fanden die altständischen Interessen ihren Ausdruck. Jede Veränderung war ihnen verdächtig, musste bekämpft werden. Die Autorität und Popularität aus den Kriegsjahren, die der König damals überall genoss, schwand dahin - wer kannte schon die Interna. Dieser Negativtrend sollte gestoppt werden, aber die Kritik an ihm wuchs immer mehr, seine Verfassungsversprechen wurden eingeklagt.
War Hardenberg in der Lage, den vielfältigen reaktionären Tendenzen Einhalt zu gebieten? Er versuchte Kurs zu halten, wurde aber häufig zur Zielscheibe meistens bösartiger Kritik, die eigentlich dem König galt. So war er für die Patrioten ein Reaktionär, der nicht mehr Freiheit zuließ. Für die wirklichen Reaktionäre war er ein Jakobiner, der mit verdeckten Mitteln die vom König gar nicht mehr gewollte Verfassung anmahnte und durchsetzen wollte. Gemessen an seinem Alter von über 65 Jahren war sein Gesundheitszustand nicht unbedingt schlecht, wenn man auch nicht übersehen konnte, dass seine Bäderaufenthalte häufiger wurden. Kam er aber von diesen Kuren zurück, stürzte er sich mit neuer Kraft in die Arbeit.
Das Schlimme war, dass seine Mitstreiter ihn nicht mehr verstanden. Sie hielten ihn für zu angepasst, er versuche nicht mehr, auf den König positiven Einfluss zu nehmen. Vielleicht hätte er nach dem Wiener Kongress abtreten sollen, wie Varnhagen von Ense meinte. Er sei durch die Entwicklung, durch den Zeitgeist, überholt worden. Jetzt könne er nicht abtreten, da alles verwirrt sei. Er müsse einen Wendepunkt finden, der es ihm ermögliche, den notwendigen Schritt zu tun. Bis dahin müsse er dieser und jener Richtung nachgeben, wenn es auch gegen seine eigentliche Überzeugung sei. So nahm das tragische Dilemma seinen Lauf.
Der bewusste Wendepunkt konnte naturgemäß nur die Verfassung sein und gerade hier lagen die Dinge im Argen. Der Gang der Studenten auf die Wartburg zur 300-Jahrfeier der Reformation, wo der Jenaer Student Arminius Riemann die Fürsten an ihre Versprechungen erinnerte und seine Kommilitonen aufrief, in ihren späteren Funktionen für die Einheit des Vaterlands einzutreten, war der Punkt, der alles sichtbar machte. Am Abend der Feier wurden die Zeichen des Drills verbrannt, der preußische Perückenzopf, der Schnürleib und der Korporalstock, aber auch einige Bücher, darunter der „Code civil“. Die Polizei wurde in Alarmbereitschaft versetzt, zumal die Jenaer Professorenschaft die aufrührerischen Parolen der Studenten unterstützten und selbst für ihre Ziele publizierten.
Seitdem standen die Universitäten als Horte des Aufruhrs unter Verdacht bei den Herrschern, und Hardenberg wurde auf Konferenzen, so in Aachen, mit dem Vorwurf konfrontiert, er gehe nicht energisch genug dagegen vor. Außerdem stütze er sich auf seine „Kreaturen“, die ihn angeblich manipulierten, als ob er nicht mehr Herr seiner Entschlüsse wäre. Alles was er tat, wurde unter Kritik gestellt. Dabei verhielt er sich recht vorsichtig, wie der Fall des Lazare Carnot zeigt.
In jeder französischen Stadt gibt es eine Carnotstraße im Andenken an einen bedeutenden Mann, der als „Sieger der Revolution“ bezeichnet wird. Als junger begnadeter Naturwissenschaftler fällt er bereits dem Bruder des Alten Fritz, Prinz Heinrich, auf, als er einen Preis für eine Arbeit, ausgeschrieben von der französischen Akademie, bekommt. Heinrich bietet ihm an, sofort mit nach Preußen zu kommen, doch Carnot lehnt ab. Als er zum ersten Mal durch Ludwig XVI. verhaftet wird, bringt ihm die Jugend einen Fackelzug dar. In der Revolution wird der begabte Festungsbaumeister Mitglied der Regierung und des Großen Wohlfahrtsausschusses im Jahre II der Französischen Republik. In den Revolutionskriegen übernimmt er an führender Stelle Kommandofunktionen gegen die Armee der Alliierten und ist damit einer der entschiedenen Gegner der Preußen. Er schickt Napoleon nach Italien und wird später unter seiner Herrschaft Innen- und Kriegsminister.
Dieser Mann wird von den Bourbonen verjagt, er ist einer der „Königsmörder“, da er der Hinrichtung des Königs zugestimmt hat. Sein Genie ist in der Allianz bekannt, und so reist er auf der Flucht mit zwei Pässen über Belgien, München, Wien, Krakau nach Warschau, um in die Dienste des Zaren, der ihm einen Pass ausstellen ließ, zu treten. Aber die Phase, in der auch der Zar mit der Liberalität kokettierte, ist bereits vorbei. So nimmt er 1815 in Warschau über die preußische Gesandtschaft neue Verbindungen mit den Reformern auf, schließlich hatte der Geheimdienstchef Grüner ihm den zweiten Pass ausgestellt. Die Militärreformer wollen sich seiner Kenntnisse über den Festungsbau bedienen und für die Ausbildung der Ingenieur-Offiziere gewinnen. Es liegt auf der Hand, dass Hardenberg die Genehmigung erteilt hat, ihn nach Berlin zu holen.
Doch der Polizeiminister Wittgenstein hat längst wahrgenommen, dass sich der Wind gegen die Reformer dreht und beginnt beim König gegen den Plan zu intrigieren. Im Spätsommer ist Hardenberg zu einer Kur in Bad Doberan, und so wird Carnot von Wittgenstein nach Frankfurt/Oder verwiesen. Dort wartete er auf den Kanzler, doch dieser lässt sich nicht sehen. Er stellt ihn lediglich vor die Wahl, in Frankfurt zu bleiben oder nach Magdeburg umzusiedeln. So geht er nach Magdeburg, erhält Wohnung und Rente, darf seinen Titel General führen, aber Einfluss im Heer bekommt er nicht, wenn man von einer Beratungstätigkeit bei den Magdeburger Festungsoffizieren absieht.
An diesem Beispiel kann man erkennen, wie die Stellung zu den Reformen und den Reformern, selbst im siegesreichen Heer, inzwischen tatsächlich war. Die Angst vor der Revolution und vor einem, noch vor wenigen Monaten berühmten Mann, dominierte über alle rationalen Erwägungen. Dennoch kommt es zu einem späten Zusammentreffen (1822) auf einer Durchreise des Kanzlers nach Bad Pyrmont im Haus des Magdeburger Präfekten von Bülow nach einem Bankett zu Ehren des Kanzlers. Eine Änderung brachte es nicht. Carnot wurde nach seinem Tod, 1823, zuerst in Magdeburg beigesetzt, dann, zum 100. Jahrestag der Revolution 1889, mit Genehmigung des Kaisers und unter militärischen Ehren nach Paris überführt, wo er heute im Pantheon ruht. In Preußen hatte er seine Forschungen privat weitergeführt und mit einer Schrift über die bewegende Kraft des Feuers die Grundlage für die Thermodynamik gelegt.
Auch in anderer Hinsicht war Hardenberg angreifbar geworden. Seine Anhänger mussten mit Erstaunen vernehmen, dass er sich mit dem windigen Arzt Koreff umgab, von dem er sich eine Heilung seines Ohrenleidens durch Magnetismus versprach. Dieser Wunderheiler brachte ein junges Mädchen als sein Medium zu den Sitzungen, die unter geheimnisvollen Zeremonien abliefen. Der Einfluss des Koreff auf Hardenberg war so groß, dass er mit einer Professur belohnt werden sollte, aber die Fakultät in Berlin wehrte sich. Dann stellte er ihn im Staatskanzleramt als Vortragenden für wissenschaftliche und künstlerische Angelegenheiten ein. Das Medium, Friederike Hähnel, nahm er als Gesellschafterin seiner Frau in sein Haus. So wurde die ehrgeizige Abenteurerin seine Geliebte und zerstörte durch Intrigen und Bereicherungen an seinem Besitz die dritte Ehe. Später ging sie nach Rom, wo sie ihr bewegtes Leben beschloss.
Auch die Erhebung des Grafen Hermann Pückler-Muskau in den Fürstenstand galt als unangemessene Protegierung seines Schwiegersohns, der ganz gegen seinen Willen die einzige Tochter und geschiedene Reichsgräfin Lucie von Pappenheim geheiratet hatte. Er war ein Mann ohne Charakter, wie er selbst von sich sagte. Obwohl der leichtlebige Pückler keine nennenswerten Verdienste vorweisen konnte, erreichte Hardenberg beim König dessen Ernennung.
Die Umstände, die dazu führten, sind einigermaßen merkwürdig, wie ein Zeuge berichtet. Hardenberg sei am 6. Juni zu einem Vortrag beim König erschienen und habe geweint. Er fürchte, das Vertrauen seines Herrn nicht mehr zu besitzen, weil ihn die ständischen Angelegenheiten entzogen worden seien. Nach beruhigenden Worten des Königs habe der Staatskanzler weiter geschluchzt und auf eine diesbezügliche Frage des Königs, womit er ihn beruhigen könne, um die Erhebung des Grafen Pückler in den Fürstenstand gebeten. Um der Sache ein Ende zu bereiten, habe der König sie genehmigt. Der Kronprinz bezeichnete diesen Vorgang als „Pücklerische Schweinerei“.
Durch diese im Grunde sekundären Ausflüge verlor Hardenberg an Glaubwürdigkeit. Auf seinem eigentlichen Fachgebiet, den Finanzen, dem Steuersystem, dem Staatshaushalt, erzielte er noch einige wenige Erfolge. Zu ihnen gehörte das Zollgesetz von 1818, mit dem eine einheitliche Zollgrenze gezogen wurde. Das Gesetz gewährte Schutzzölle gegen die kleineren Staaten, stellte aber die Großstaaten in Konkurrenz zueinander, ein Schritt zum Freihandel und eine weitere Forderung aus der Rigaer Denkschrift.
Bei den Steuergesetzen für das Inland stieß er auf den Widerstand im Staatsrat und spürte, dass das Vertrauen in seine Politik schwand. „Es liegt in der Tat ein höchst ungerechter Tadel der Verwaltung darin, wenn man den Satz: keine Auflagen, Ersparen, mit den Einnahmen auskommen! im versammelten Staatsrat ohne gründliche Sachkenntnis ausspricht und Besorgnisse wegen entstehender Unzufriedenheit durch die neuen Lasten äußert. Am anderen Tag ist die Rede davon an allen Straßenecken. Man vertraue doch der Administration! Sie wird gewiss Ersparnisse eintreten lassen, wo sie irgend möglich sind.“ Man fühlt sich an heutige Diskussionen erinnert. Ist das Vertrauen beschädigt, helfen keine Appelle an die Vernunft mehr. Eine einheitliche Steuergesetzgebung kam danach nicht mehr zustande. Die Ungleichheit zwischen den gesellschaftlichen Schichten und Gebietsteilen wurde eher noch größer.
Das eigentliche Problem blieb aber die Furcht vor der Revolution. Hardenberg und der Polizeiminister Wittgenstein führten eine Aussprache mit dem Großherzog von Weimar, auf dessen Territorium die Wartburg stand. Die Kritik des Theologiestudenten und ehemaligen Lützower Jägers, Arminius Riemann, lautete: „Das deutsche Volk hat schöne Hoffnungen gefasst, sie sind alle vereitelt; alles ist anders gekommen, als wir erwartet haben. Viel Großes und Herrliches, was geschehen konnte, ist unterblieben, mit manchem heiligen und edlen Gefühl ist Spott und Hohn getrieben worden.“ Dieses Unbehagen im Volk wurde von der Intelligenz artikuliert. Die deutsche Bourgeoisie hatte ihren Beitrag dazu geleistet, Napoleon zu verjagen, aber um die Adelsherrschaft abzuschütteln, war sie nicht stark genug. Die Feudalordnung war im Gegenteil noch gestärkt worden. Tiefe Resignation in der Bevölkerung war die Folge, man wandte sich der privaten Sphäre, der Philosophie und der romantischen Literatur zu.
In den Rheinlanden, so konnte sich Hardenberg bei einer Besichtigungsreise überzeugen, wartete man auf eine Verfassung. Eine Delegation unter der Leitung des Koblenzer Professors Joseph Görres überreichte ihm eine „Koblenzer Adresse“, unterschrieben von 3 296 Personen, in der das Verfassungsversprechen von 1815 eingefordert wurde. Die Eingabe wurde widersprüchlich beurteilt.
In einem Brief an den König bezeichnete Hardenberg das Verhalten des Görres als untadelig. Ein Zeitzeuge aber schreibt, dass Görres sich mit einem wilden Knäuel verschiedener standesgebundener Forderungen zu Wort gemeldet habe und Hardenberg ihn immer habe zurechtweisen müssen: „Herr Professor, Ihre Forderungen sind nicht zu erfüllen.“ Die Petition wurde in Druck gegeben und erhielt zusätzliche Kommentierungen durch Görres mit scharfen Attacken gegen die innere Lage in Preußen. Besonders darüber gab es Empörung. Der König schrieb sogar: „Wer auf diese Weise das Volk von der Regierung abwendig macht und das Volk der Regierung und die Regierung dem Volke preisgibt, kann da nicht weiter geduldet werden.“ Görres wurde versetzt, und ein Jahr später befahl Hardenberg ihn zu verhaften, allerdings entkam er den Polizisten.
Die eigentliche Bedrohung aber sah man im Protestverhalten der Studenten an den Universitäten. Hardenberg bereitete eine Kabinettsorder vor, die auf 19 Seiten vom Ministerium verlangte, Maßnahmen zu ergreifen und Vorschläge zu machen, wie man den Geist der Unzufriedenheit begegnen könne: „Alles, was sonst nur Unfug junger Leute war, trägt jetzt das Gepräge der Sucht, in die Welthändel einzugreifen, nach sich.“ Es müsse ein Pressegesetz vorgelegt werden, ein einheitliches Vorgehen der Regierung sei erforderlich. Es wurde schließlich sogar verboten, Bittschriften, die eine neue Verfassung forderten, abzugeben. Die Studenten gaben nicht nach. Der österreichische Gesandte in Berlin schrieb an Metternich, dass fast tägliche „brandstiftende Flugblätter“ von Studenten in den Kaffeehäusern und an anderen öffentlichen Orten verteilt würden.
Ein erbitterter Gegner der studentischen Umtriebe war der Direktor im Ministerium der Polizei und Mitglied im Staatsrat, Karl Christoph von Kamptz, dessen „Kodex der Gendarmerie“ unter den auf der Wartburg verbrannten Büchern war. Er forderte, „durch öffentliche Missbilligung und Maßregelungen der Vergiftung der Jugend und dem uns drohenden Terrorismus“ entgegenzutreten. Die Burschen von der Wartburg bezeichnete er als einen „Haufen verwilderter Professoren und verführter Studenten.“ Nun wird klar, warum Hardenberg sich mit Wittgenstein an den Großherzog von Weimar wandte, dem auch die Universität Jena unterstand.
Als Antwort auf die Maßnahmen der Obrigkeit gründeten die Studenten im Oktober 1818 in Jena die „Allgemeine deutsche Burschenschaft“. Der § 1 der Satzung lautete: „Die allgemeine deutsche Burschenschaft ist die freie und natürliche Verbindung der gesamten auf den Hochschulen sich bildenden deutschen Jugend zu einem Ganzen, gegründet auf das Verhältnis der deutschen Jugend zur werdenden Einheit des deutschen Volkes.“ An der Verbindung beteiligte sich auch als Gründer Friedrich Ludwig Jahn, der Vater der deutschen Turnerschaft.
Nun bedurfte es nur noch eines herausgehobenen Anlasses, um einen Angriff auf die gesamte oppositionelle Bewegung zu eröffnen. Dieser fand sich im Frühjahr 1819, als der Theologiestudent Karl Sand den Schriftsteller August von Kotzebue erdolchte mit den Worten: „Hier, du Verräter des Vaterlandes!“ Kotzebue gab ein „Literarisches Wochenblatt“ heraus, in dem er liberale Ideen und die Ideale der Burschenschaften lächerlich machte, wahrscheinlich im Auftrag des Zaren, in dessen Diensten er als Informant stand. Wegen seiner öffentlich gewordenen Berichte galt er unter den Studenten als Zarenknecht, er war die personifizierte Gegenposition zu den Forderungen nach Einheit und Freiheit.
Der Jenaer Burschenschaftler ermordete ihn in Mannheim, und als die Badener Polizei ihn aufspürte, versuchte er sich selbst umzubringen, was ihm aber nicht gelang. Ein Jahr später wurde er in Mannheim öffentlich enthauptet. Nach dem Mord an Kotzebue begann die Polizei Listen mit Verdächtigen aufzustellen, die „Demagogenverfolgung“ begann. Sie bestand im Verbot der Burschenschaften und der Geheimbünde, deren Teilnehmer wurden nicht in den Staatsdienst übernommen. Landesherrliche Bevollmächtigte überwachten die Vorlesungen der Professoren, ahndeten Disziplinverstöße. Besondere Zensur wurde für Flugschriften eingeführt. In Mainz wurde eine Reichsbehörde gegründet, die „Zentraluntersuchungskommission zur weiteren Bekämpfung revolutionärer Umtriebe“, die allgemein nur „Schwarze Kommission“ genannt wurde.
Die Schwarze Kommission bestand neben den Gerichten. Sie war eine Behörde des Bundes mit weitreichenden Vollmachten. Sie durfte jede Akte von Behörden anfordern, Anordnungen treffen und Verhaftungen vornehmen. Sie verfolgte jedes Mitglied des Tugendbundes, der Männer- und Jünglingsvereine und der Burschenschaft. Diese löste sich 1819 zwar selbst auf, gründete sich aber als Geheimbund sofort wieder neu und radikalisierte sich damit. Arminius Riemann wurde verfolgt und lebte illegal bei seinem Bruder, einem Landpastor im Norden. Turnvater Jahn, Hardenberg erwähnt seine Verhaftung im Tagebuch, wurde wegen „hochverräterischer Äußerungen“ verhört und jahrelang unter Polizeiaufsicht gestellt. Die Turnplätze wurden geschlossen, Turnen überhaupt verboten. Ernst Moritz Arndt wurde ebenfalls verhört, es fehlte zwar an belastendem Material, aber er erhielt Vorlesungsverbot in Bonn, fast sein Leben lang. „Was ist des Deutschen Vaterland?“ Einen Tag nach der Verhaftung von Jahn erschien Kamptz zur Berichterstattung bei Hardenberg.
Nun war der Weg frei für gesetzliche Maßnahmen. Der Staatsrechtler, Karl Ludwig von Haller, hatte die theoretische Munition bereitgelegt. Schon 1816, in seinem Hauptwerk „Restauration der Staatswissenschaft“, begründete er bereits die kommenden Maßnahmen: Die Herrschaft der Stärkeren, des Adels und der Fürsten, sei ein durch Gott begründetes Prinzip und die Grundlage für jedes Staatswesen. Während die politische Inquisitionsbehörde, die „Schwarze Kommission“, in Mainz residierte, wurde das Kammergericht in Berlin zum Staatsgerichtshof für alle bedeutenden politischen Prozesse ausgebaut. Zuerst strenge Verhöre, dann hohe Freiheitsstrafen, das war das nun geltende Rezept zur Erhaltung des inneren Friedens.
Auf den Grundsätzen dieser bereits praktizierten Rechtsordnung waren Vertreter von zehn deutschen Bundesstaaten in Karlsbad versammelt und arbeiteten die Gesetzesentwürfe für die kommende Zeit aus. Den Vorsitz hatten Preußen und Österreich. Der Bundestag verabschiedete die Akte am 20. September 1819. Ihr Inhalt entsprach ganz den Forderungen Metternichs, des Zaren und des preußischen Königs: Verbot aller studentischen Verbindungen, Entlassung aller oppositionellen Professoren, strenge Überwachung der Universitäten. Vorzensur für alle Zeitungen, Zeitschriften und Flugblätter und Nachzensur für alle anderen Druckerzeugnisse. Einsetzung der Mainzer Behörde.
Die Karlsbader Beschlüsse wurden am 18. Oktober, dem Jahrestag der Völkerschlacht, in Preußen angenommen und zum Gesetz erklärt. Die Zensurbestimmungen gingen allerdings noch über die Karlsbader Entwürfe hinaus. Damit wurde jede politische Kritik als staatsfeindlich eingestuft. Die patriotische Bewegung war zwar eingedämmt, aber nicht e...