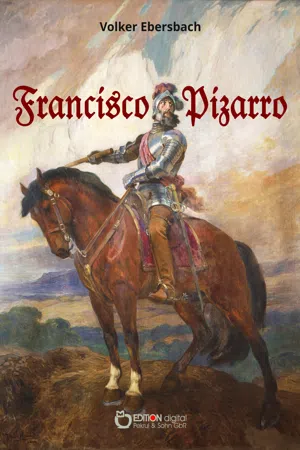XIX. Drachensaat und Ein Epilog
Zerstückelt aber lag das Land
von den eingefallenen Messern.
Pablo Neruda.
Der Große Gesang
Francisco Pizarro hat in Peru Drachenzähne gesät. Die Biografie eines solchen Mannes ist nicht zu Ende mit seinem gewaltsamen Tod. Wo immer die Conquista einen gewaltsam Getöteten unter die Erde brachte, war er eine Drachensaat. Die latente Revolte, mit der Pizarro der königlichen Kolonialbürokratie seinen Zug nach Peru abgetrotzt hatte, wurde unter seinen unbedenklicheren Erben zur offenen. Die Krankheit brach aus.
Die Hauptleute des jungen Diego de Almagro führten in Lima ein Terrorregime, dessen Schritte das schlechte Gewissen lenkte. Die lautstarken Bekundungen der Königstreue dienten nur dazu, an die königlichen Gelder heranzukommen. Aber die Lage der Rebellen war aussichtslos. Dem zarten, gebildeten Mestizen fehlten Kraft und Begabung, seine Sache selbst zu führen. Sein Name diente als Fetisch rivalisierender Ehrgeizlinge, die täglich einander in die Haare gerieten, mit den Klingen bedrohten und sich manchmal bei Tisch oder auf offener Straße abstachen. Da von Norden her als Mann der Ordnung Vaca de Castro nahte, wagte im Land keiner so recht, die almagristische Sache zu vertreten. Alonso de Alvarado erklärte sich mit seinen Soldaten dagegen. Auch der Hauptmann Holguin in Cuzco stand nicht zu den Mördern des Marqués. Nicht einmal die Stadt Arequipa, auf dem Gebiet des Marschalls gelegen, wollte mit dessen Sohn etwas zu tun haben. Dort landete gerade unter dem Kapitän Alonso de Camargo das erste spanische Schiff, das durch die Magellanstraße den Kurs direkt nach Peru genommen hatte.
Unterwegs waren zwar zwei Schiffe vor der stürmischen, zerklüfteten Küste Südchiles gescheitert. Aber es gab nun einen Seeweg zwischen Kolonie und Mutterland ohne die Unterbrechung des Isthmus von Panama.
Nur der unreife, fügsame Schein-Inka Paullu hielt zu den Empörern, die alle auf Pizarros Mörder Rada hörten. Versuche, mit Vaca de Castro Verbindung aufzunehmen, schlugen fehl. Er wurde in Quito, San Miguel und Trujillo jubelnd empfangen. Rada riet, Lima aufzugeben und nach Cuzco zu marschieren, damit Holguin und Alvarado sich nicht vereinigen könnten. Doch unterwegs erkrankte er und starb in wenigen Tagen. Damit verlor der junge Almagro seine Hauptstütze. Sein Brief an Vaca de Castro, er werde sich ergeben, wenn man ihn wenigstens als Statthalter von Neu-Toledo bestätige und ihm im Namen des Königs Verzeihung gewähre, blieb ohne Antwort. Unterdessen öffnete Holguin ihm Cuzco, setzte sich ab und zog ungehindert zu Alvarado.
Pedro de Candia, der Grieche aus Kreta, der im türkischen Kanonendonner groß geworden war, Artillerist und Feuerwerker Pizarros, hatte lange still seinen Dienst versehen und sich nirgends mehr sonderlich hervorgetan. Nun fand er sich unversehens im Dienst eines Verlorenen. Er goss für ihn in Cuzco Kanonen und mischte Pulver, schmiedete Harnische und Helme aus Kupfer und Silber, denn Eisen war knapp. Er blieb dabei freudlos und skeptisch. Vaca de Castro zog in Lima ein und marschierte nach Jauja. Überall strömten Freiwillige unter seine Fahnen, sogar eingefleischte Almagristen. Candia wusste nicht mehr, wohin er gehörte, und gab seine Dienste dem nächsten, der sie verlangte.
Am 16. September 1542 trafen im Tal von Chupas bei Guamanga, nicht weit von Cuzco, die Truppen Vaca de Castros und Diego de Almagros aufeinander. Der Gesandte des Königs befehligte um die siebenhundert Mann, aber vorwiegend behäbige Pikeniere. Nur dreiundsiebzig Mann waren beritten, nur hundertsiebzig Infanteristen bedienten Feuerwaffen, nur drei überalterte Geschütze konnte er auffahren. Aber von den fünfhundert Mann des jungen Almagro war die Hälfte beritten, und ein größerer Teil des Fußvolkes hatte Hakenbüchsen. Pedro de Candia befehligte neugegossene Feldschlangen. Die Schlacht begann erst am späten Nachmittag. Die königlichen Truppen rückten unerwartet schnell vor. Candias Artillerie schoss über sie hinweg, bis Almagro bei der Batterie erschien, dem Griechen Wankelmut und Verrat vorwarf, ihn eigenhändig niederstach und den Winkel der Geschütze veränderte. Doch die Verluste, die eine verspätete Kanonade Vaca de Castro noch zufügen konnte, brachte keine Wende. Bei Einbruch der Dunkelheit lösten die Reihen der Rebellen sich auf. Almagro zog sich mit den Getreusten nach Cuzco zurück. Das Cabildo der Stadt empfing den Verlierer feindselig. Der Fähnrich Rodrigo de Salazar trat vor und setzte ihn gefangen. So konnte die Stadt mit der Gnade des Siegers rechnen.
Etwa dreihundert Tote wurden in vier Massengräbern verscharrt. Nur adlige Gefallene hatten ein Recht, sich in Kirchen und auf Friedhöfen bestatten zu lassen. Die Schlacht bei Guamanga hatte bereits die Ausmaße europäischer Schlachten dieser Zeit. Die Zahlen der Beteiligten und der Verluste sind mit denen von Pavia vergleichbar, als der König von Frankreich Gefangener Karls V. wurde. Nur wenige konnten fliehen. Einige entkamen in die östlichen Wälder zu Manco. Sie sollen ihn beim Würfelspiel umgebracht und dann die Tat selbst mit dem Tod gebüßt haben. In Cuzco leitete Vaca de Castro einen Hochverratsprozess ein, bei dem den „Peruleros“, den spanischen Untertanen der Kolonie Peru, das Rebellieren vergehen sollte. Vierzig Todesurteile wurden vollstreckt, dreißig Männer verloren eine Hand oder ein Bein. Der enthauptete Leichnam des jungen Diego de Almagro wurde neben den Gebeinen seines Vaters beigesetzt.
Cristóbal Vaca de Castro versah sein Amt gewissenhaft, aber ohne ausdauernden Eifer und ohne Genie. Er spürte, dass er auf Sand baute. Wo er Gnade walten ließ, erntete er Spott, wo er durchgriff, sah er funkelnde Augen. Weisungsgemäß versuchte er die Indios gegen die Ausschreitungen der Siedler zu schützen. Denn auch in Peru begann man sie nun mit Bluthunden zu hetzen und mit Peitschen auf die Plantagen und in die Bergwerke zu treiben. Wo Pferde knapp waren, benutzte man sie als Reittiere. Die Peruleros gewöhnten sich daran, einen indianischen Harem zu halten. Wo Vaca de Castro dagegen einschritt, wurde gemurrt. Wo er Schulen bauen ließ und Mönchen gestattete, die Indiokinder das Lesen und Schreiben zu lehren, schüttelte man feindselig den Kopf. Niemand dankte es ihm, wenn er Paragrafen und Buchstaben der königlichen Verfügungen wenigstens dort durchsetzen wollte, wo er persönlich erschien. Nicht einmal die Krone sollte es ihm danken.
Eines Tages wurde bei ihm ein Mann vorstellig, den er lieber verschollen gemeldet hätte: Gonzalo Pizarro, der Halbbruder des Eroberers und ehemaligen Statthalters, einem früheren Vertrag zufolge rechtmäßiger Nachfolger des Marqués. Gonzalo hatte 1539 vom Marqués den Auftrag erhalten, in Quito eine Expedition in die Waldgebiete östlich der Anden auszurüsten. Dort sollte das Land Canelas liegen, die „Zimtwälder“. Vielleicht fanden die Spanier doch noch ihre Molukken. Auch die Sage von Eldorado lebte wieder auf. Die ausgeplünderten Indios, die begriffen hatten, dass die Weißen nichts suchten als Gold, faselten, wo man sie fragte, von einem See Parime und einer goldenen Stadt und einem Häuptling, der sich in Goldstaub wälze. „El dorado“ nannten ihn deshalb die Spanier, „der Vergoldete“. War es eine heimliche Hoffnung auf Vergeltung, eine Abwehrlüge, mit der die Indios die Plagegeister loszuwerden hofften? Es gehörte aber auch zum indianischen Gemüt, einen Frager nie ohne Auskunft zu lassen und im Zweifelsfall dessen Vermutungen aus Höflichkeit zu bestätigen. So blieb die Sage lange unausrottbar.
1540 zog Gonzalo Pizarro mit dreihundert Spaniern, viertausend indianischen Trägern, einer Lamakarawane und einer stattlichen Koppel grunzender Schweine von Quito aus ostwärts. Es war die größte Expedition, die sich bis dahin in der Neuen Welt in Marsch gesetzt hatte. Noch ehe sie die Niederungen erreichte, wurde sie in den Hangregionen durch Kälte und wochenlangen Regen dezimiert. Ein starkes Erdbeben verlegte mit einem Erdrutsch, der vor den Augen der Karawane ein ganzes Dorf verschlang, den Weg. Lamas und Pferde verendeten, die Schweine, als lebender Proviant gedacht, liefen davon. Nachts verdrückte sich von den Indios einer nach dem anderen. Als Gonzalo Pizarro den Rio Napo erreichte, ging in seinen Reihen schon wieder das Hungergespenst um. Wieder aß man Würmer, Baumrinde, Lederzeug, wieder starben Leute an giftigen Beeren, wieder surrten vergiftete Pfeile aus versteckten Blasrohren.
Als man bei den friedlicheren Omaguas Ruhe fand, sich an Dörrfisch und Fladen gesättigt hatte und für die Sage von Eldorado Bestätigung erhielt, ließ Gonzalo Pizarro unter der Aufsicht und nach Plänen seines Zimmerers Andreas Durante ein Schiff bauen. Das Dickicht wurde jetzt undurchdringlich. In sechs Stunden kam man zu Fuß nur zwanzig Schritt voran. Die Omaguas halfen beim Fällen und Zersägen der Bäume. Aus den Hufeisen, die Pizarro sorgsam den toten Pferden hatte abnehmen lassen, wurden Nägel und Klammern geschmiedet. Indianerinnen flochten aus harten Gräsern Segel. Nur das Pech zum Kalfatern fehlte. Aber die Indianer stellten aus dem milchartigen, eingedickten Harz bestimmter Bäume wasserdichte Decken her. Es war Rohkautschuk, und er eignete sich auch zum Abdichten des Schiffes. Als am 10. Dezember die „Victoria“ vom Stapel lief, war die erste technische Verwendung des Kautschuks durch Europäer Geschichte geworden.
Beim Gastmahl, das der Omaguahäuptling gab, lernten die Europäer auch eine Vorform der Zigarre kennen. Der Padre Gaspar de Carvajal, der ein Tagebuch dieser Expedition schrieb, berichtet: „Nach der Mahlzeit ging eine aus braunen Blättern verfertigte Rolle von einem zum anderen, die an einem Ende angezündet worden war und aus der man einen schmackhaften, aber betäubenden Rauch sog.“
Gonzalo Pizarro sandte den Trujillaner Francisco de Orellana mit einundfünfzig spanischen Soldaten und Offizieren und einigen Omaguas, die sich bereit erklärt hatten, das Schiff über Sandbänke und durch Stromschnellen zu lotsen, auf der „Victoria“ voraus. Der zuverlässige Landsmann und entfernte Verwandte sollte den großen Strom erkunden, in den der Napo angeblich mündete und an dem die Gegend liegen sollte, „die von Gewürzen überfloss“, und wo es, so Carvajal, „auch eine Stadt gab, die aus purem Gold war. Alles war dort aus Gold, die Straßen, die Häuser, die Götzentempel. Und diese Stadt lag am Ufer eines mächtigen Stromes, der so breit war, dass man von einem Ufer zum anderen nicht hinübersehen konnte. Fuhr man den Strom hinunter, gelangte man zu einer zweiten Stadt, in der die Ziegel und Mauern der Häuser mit Goldblech verkleidet und alle Gebrauchsgegenstände aus purem Gold hergestellt waren.“ Dort sollte „El dorado“ herrschen.
Orellana sah am 12. Februar 1542 wirklich diesen unabsehbaren Strom und rief bei seinem Anblick aus: „Que rio mar!“ – „Was für ein Flussmeer!“ Eldorado fand er nicht. Wegen der halsbrecherischen Stromschnellen des Napo, die das Schiff stromab nur mit knapper Not heil passiert hatte, schien ihm die Rückkehr zu Gonzalo Pizarro zu beschwerlich. Er baute ein zweites Schiff, die „San Pedro“, und fuhr weiter, immer stromabwärts gewiesen von den Eingeborenen. Carvajal schrieb: „Was wir zu sehen bekamen, waren einzig und allein überschwemmte Ufer, ein bleigrauer Himmel und auf den Bäumen umherturnende Affen, die uns mit ihrem Geschrei zu verhöhnen schienen.“ Sie überstanden Nebel und Regengüsse, trafen friedfertige und feindselige Eingeborene, darunter geschwänzte und wild bemalte, deren Mund von Dornen starrte, während in der Nase Muschelscherben steckten. Sie bestanden mit kriegerischen Weibervölkern, die nur in die Augen zielten, Gefechte und nannten den meerhaften Strom deshalb Amazonas. Als sie es satt hatten, immer wieder stromabwärts verwiesen zu werden, brannten sie Dörfer nieder, plünderten und vergewaltigten wie sonst immer, wenn als Kater vom Goldrausch Wut und Enttäuschung zurückblieben.
Orellana glaubte, in Amerika sei noch Platz für ein drittes Goldreich. Auch er hoffte durch Leistung seine Eigenmächtigkeit zu sühnen. Nicht nur die Krone glaubte ihm, als er von der Mündung des Amazonas her direkt nach Spanien kam und mit ihr den üblichen Conquistadorenvertrag schloss, sondern auch die armen Ehrenmänner und die Entrechteten, aus denen sich immer die Conquista rekrutierte. Auch Orellana musste zu seiner zweiten Fahrt nachts heimlich von San Lúcar absegeln, weil es ihm zu bunt wurde, dem Indienrat über jeden Nagel Rechenschaft zu geben. Aber seine Statthalterschaft Neu-Andalusien erwies sich als Windei. Orellana ist auf seiner zweiten Reise ins Amazonasgebiet verschollen. Die Sage von Eldorado aber blieb weiter lebendig wie ein bitterer Schabernack der Eingeborenen, die so alle Weißen in die grüne Hölle abschieben konnten. Noch 1685 verhießen Indios dem böhmischen Jesuitenpater Samuel Fritz, er werde im Gebiet des Maranon, wo er missionierte, eine Stadt finden, wo die Häuser aus Silber errichtet und die Straßen mit Silberplatten gepflastert seien. Da war das Amazonasgebiet bereits Jagdrevier portugiesischer Sklavenfänger. Die spanische Krone unternahm nichts, den von Spaniern entdeckten und gemäß dem Vertrag von Tordesillas Spanien gehörenden Strom zu verteidigen. Ein Vertreter der Kolonialbehörde, dem der geflohene Pater Fritz 1712 vorhielt, die Spanier hätten den Strom leichtfertig verspielt, antwortete: „Der Amazonas ist nicht wichtig. Der Amazonas führt kein Gold.“
Schon Gonzalo Pizarro gab ihn deshalb auf. Bis zur Mündung des Napo in den Amazonas fuhr er Orellana nach. Dort fand er den verwilderten, entstellten Sanchez de Vargas, der ihm die Desertion der „Victoria“ meldete. Orellana hatte ihn ausgesetzt, weil er als einziger nicht gegen Pizarros Befehle verstoßen wollte. Nun zählte für Gonzalo und die Reste seiner Truppe nur noch das Gold von Peru, das schon verteilt war. Um die zimtähnlichen Rinden, die man tatsächlich gefunden hatte und mit denen die Indianer ihren Seekuhbraten würzten, kümmerten sie sich nicht mehr. Im Juni 1542 erschienen vor Quito, wo sie niemand mehr erwartet hatte, achtzig abgezehrte, gespenstische Gestalten. Ihre Kleidung war im Regenwald zerfetzt und verfault. Sie trugen schiefe Jacken und lumpige Hosen aus Tierhäuten. Fast alle fieberten. Der Statthalter Sarmiento schickte ihnen neue Kleidung entgegen, aber nicht genug, und so gestattete Gonzalo Pizarro niemandem, sich neu einzukleiden. Er führte seinen abgerissenen Haufen durch die Menge der Gaffer geradewegs zur Kirche, um Gott zu danken.
Nun erst erfuhr er von der Ermordung des Marqués und der Mission Vaca de Castros, die seinen Anspruch auf die Nachfolge in der Statthalterschaft überging. Er war der Jüngste der Pizarros, die mit dem Eroberer ausgezogen waren, und wohl auch der letzte der unehelichen Söhne des Majoratsherrn von Trujillo. Gonzalos Mutter, Maria de Viedma, hatte dem Alten zu Pamplona den Haushalt geführt. Auch nach dem Tod des Marqués hatte der Name Pizarro in Peru noch einen magischen Klang. Er erinnerte an eine Zeit der Ordnung nach Conquistadorenart: leben und leben lassen, Beute machen und Beute machen lassen, ausbeuten und ausbeuten lassen. Viele, die den Kronbeamten Vaca de Castro naseweis und weltfremd fanden, die es verdross, dass er die Corregidores, die Steuereintreiber, anspitzte, ermunterten Gonzalo, auf seinen Ansprüchen zu bestehen.
So gelangte er nach Lima, und die Schmeicheleien der Siedler linderten seine Erbitterung. So marschierte er nach Cuzco und schwieg noch unentschlossen zu den Mahnungen seiner Freunde, Vaca de Castro gefangen zu nehmen. Ein gewisser Villalba hatte nichts Eiligeres zu tun, als diese Vorgänge zu melden, und es hätte Gonzalo Pizarro so ergehen können wie einst Balboa. Aber Vaca de Castro war nicht Pedrarias, und der Name Pizarro glich einem Pulverfass. Der Kronbeamte empfing den Helden der Zimtwälder huldvoll und riet ihm, sich von seinen Strapazen zu erholen. In wohlgemeinte Ratschläge wickelte er die gemessene Drohung, jede auffällige Ansammlung von Leuten um seine Person werde als Hochverrat geahndet. Gonzalo Pizarro beugte sich diesem Spruch, denn in Charcas erwarteten ihn Silberminen mit reicher Ausbeute. Gerade war der Silberberg von Potosi angeschnitten worden. Der jüngste Pizarro hielt still und verschloss sein Ohr gegen aufwiegelnde Einflüsterungen, solange die Krone ihn abfand. Aber Vaca de Castro übersah nicht das Glitzern in seinen Augen und musste an glimmende Lunten denken.
Was in Europa an Gräueln der Conquista und Ausschreitungen der Kolonisten ruchbar wurde, wuchs sich zu einem erheblichen Störfaktor in der universalistischen Politik Karls V. aus. Die Protestanten griffen eifrig jede Nachricht über die Grausamkeit auf, mit der Abgesandte Seiner Allerchristlichsten Majestät in der Neuen Welt vorgingen. Die wirtschaftlichen Konkurrenten Spaniens, Frankreich und England, stellten angesichts solcher Enthüllungen immer lauter und spitzer das spanische Monopol auf Entdeckungen jenseits des Ozeans in Frage. Die Audiencias hatten, solange die Kolonialgesetze Ferdinands, erlassen 1512 zu Burgos, galten, bei der Behandlung Eingeborener gern beide Augen zugedrückt. Aber die Encomenderos nutzten die Ferne des Mutterlandes und den schmierigen Schneckengang der Kolonialbürokratie weidlich aus. Sie schalteten und walteten in ihren Besitzungen wie Territorialfürsten, und wer früher nach dem Sturm auf ein Urwalddorf von der Beute das Königsfünftel unterschlug, der tat sich jetzt auch mit den Steuern schwer, die er für seine Pflanzung, sein Vieh, sein Bergwerk, seine Schnapsbrennerei, seine Webmanufaktur zu entrichten hatte. Prozesse wegen Steuerhinterziehung häuften sich. Die Kolonisten waren neue Feudalherren, denen die Steuerschraube der Krone unbequem wurde. Der Conquistador hatte die Widersprüche der spanischen Gesellschaft mit hinübergeschleppt. Aber in der Entfernung geriet alles bizarrer.
Das Wirken zweier Geistlicher, die den Interessen der Krone dienen und die Rechte der Eingeborenen schützen wollten, brachte die Krise zum Ausbruch: Es waren Bartolomé de Las Casas und Francisco de Vitoria. Las Casas, Sohn eines Edelmannes, der schon unter Kolumbus auf der „Santa Maria“ gedient hatte, 1484 geboren, kam 1502 nach Haiti und war, obwohl studierter Theologe und Rechtsgelehrter, für einige Jahre selbst einer der bedenkenlosesten Conquistadoren. Leute wie Cortés und Pizarro kannte er gut. Als gesuchter Dolmetscher, der rasch jede neue Indianersprache lernte und sich bald in zwölf verschiedenen Idiomen ausdrücken konnte, war er fast überall dabei gewesen, wo Spanier auf einen neuen Strand sprangen. Noch 1512 ließ er sich von Velásquez auf Kuba eine fette Encomienda zuschanzen. Doch 1514, während er sich auf eine Pfingstpredigt vorbereitete und sich die Mühe machte, die Heilige Schrift wieder einmal durchzublättern, begann er sich Sorgen zu machen um sein und seiner Landsleute Seelenheil. Auch war sein ökonomisch geschulter Blick, der die versklavte Urbevölkerung der Antillen zusammenschmelzen sah, gereift für die Wahrnehmung des ungeheuren Raubbaus, der den regellosen Kolonialismus dieser ersten Jahre kennzeichnete. Er begann, nachdem er auf alle seine Güter verzichtet hatte, um mit gutem Beispiel voranzugehen, Mäßigung und Umkehr, Menschenliebe auch im Umgang mit den Indios und christliche Gerechtigkeit zu predigen. Mit Bittschriften und Gnadengesuchen lief er den Kronbehörden die Türen ein. Er wurde nicht müde, Gutachten einzuholen, Eingaben zu verfassen, Beschwerden zu unterstützen, um das Los der Versklavten zu erleichtern. Schnell erkannte er, dass die theologische und juristische Basis seiner guten Absichten von der Bürokratie mühelos unterlaufen wurde, indem sie Briefe unterschlug, ihm Scheinerfolge bereitete, um sie ihm mit einer Advokatenfinte gleich wieder aus der Hand zu winden, Passschwierigkeiten erfand, um ihn mürbe zu machen.
Da entschloss sich Las Casas, den politischen Weg zu beschreiten. Vierzehnmal reiste er zwischen Spanien und den Kolonien über den Atlantik hin und her, um seine Mission zu erfüllen. 1515 wurde König Ferdinand kurz vor seinem Tod zum ersten Adressaten von Einwänden dieses Mönches gegen die Praktiken der Conquista. Er berief eine Kommission ein, die aber bei seinem Ableben ohne Ergebnis auseinanderging. Da Karl sich vorerst nicht in Spanien aufhielt, wandte Las Casas sich an den derzeitigen Großinquisitor Jiménez de Cisneros. Niemand wies ihn ab, aber es fand sich auch keiner, der seine Vorschläge ernstlich prüfte. Großzügig verlieh ihm die Krone den Titel „Defensor Universal de los Indios“, Universalverteidiger der Indios. Dann aber verschanzte sie sich hinter Gegenberichten, Gegengutachten, Zusatzgutachten, versuchte sogar heimlich, ihn zu bestechen.
In seinem erbitterten Eifer entschlüpfte Las Casas 1517 die Bemerkung, dass sich Afrikaner wegen ihres robusteren Naturells weit besser zur Arbeit auf den westindischen Plantagen eigneten als die zarten Indios. Das war der erste Hinweis, den die Behörden wirklich beherzigten. Im Alter äußerte Las Casas verschiedentlich seine Zerknirschung darüber, dass er, der „Vater der Indios“, durch einen leichtsinnigen Einwurf auch zum Vater der Negersklaverei geworden war. Die allgemeine Reserviertheit gegenüber seinen Bemühungen und der eine unbeabsichtigte Treffer geben Aufschluss darüber, was die Krone von einem brauchbaren Ratgeber erwartete: nicht Menschlichkeit, sondern bessere Vorwände für kaltblütige Ausbeutung. Las Casas hatte aus seiner Conquistadorenzeit noch genügend Weltverstand, um daraus einen nüchternen Schluss zu ziehen: Er konnte für seine Schützlinge nur Schonung erwirken, wenn er die Krone auf die Verluste hinwies, die ihr durch den Raubbau an menschlicher Arbeitskraft in den Kolonien entstanden. Die List brachte erste Erfolge. Aber sie zog diesen Erfolgen auch die engen Grenzen eines Kompromisses. 1520 fand Las Casas in einer Audienz beim Kaiser erstmals offene Ohren für seine Vorstellungen. Was Pizarro die Ermächtigung für seinen Zug nach Peru einbrachte, war auch Öl in dem Getriebe, das Las Casas in Bewegung setzte: die kaiserliche Geldnot. Wo er nachweisen konnte, dass Brutalität die Einkünfte der Krone schmälerte, schritt der Kaiser ein. Freilich nicht zu behände, und wo die kaiserliche Hand ölte, warteten genügend Hände mit Sand, bis er wegsah, was immer recht bald geschah. Die Mühlen einer neuen Indiengesetzgebung mahlten langsam und knirschend. Die Nutznießer der weitmaschigen Encomienda verwandten einen angemessenen Teil der Gewinne, die sie aus den Indios pressten, zur Sabotage der Reformen.
Las Casas selbst blieb ein lauterer Mann und ließ sich auch von Morddrohungen nicht beeindrucken. Ämter und Würden wie die Ernennung zum Hofkaplan des Kaisers nahm er nur an, um sie für sein Wirken in die Waagschale zu werfen. Er stand an der Spitze derer, die zuerst in den Trümmern der verwüsteten altamerikanischen Kulturen nachgruben, die indianischen Sprachen und Gebräuche studierten und das Zeitgeschehen in den Kolonien historiografisch aufbereiteten. Er reiste umher und hörte die Klagen, belauschte die Eroberer, wenn sie sich ihrer Untaten rühmten, und protokollierte alles genauestens. Über Peru, das er nicht selbst bereiste, informierte ihn sein Ordensbruder Marcos de Niza. 1539 gelang es ihm, durch eine Predigt die Soldaten einer Strafexpedition gegen Indios in Nicaragua zur Fahnenflucht zu bewegen. Der Hochverratsprozess, der danach vier Jahre lang in Spanien gegen ihn lief, wurde niedergeschlagen.
In dieser Zeit ste...