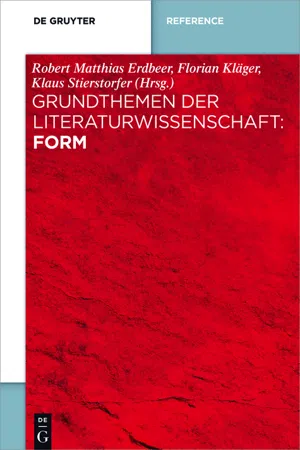1 Die Basismetaphoriken ästhetischer Formdiskurse
Burdorf, Dieter. Poetik der Form. Eine Begriffs- und Problemgeschichte. Stuttgart und Weimar 2001. Der Begriff ‚Form‘, dessen Verwendung ja keineswegs auf ästhetisch-poetologische Kontexte beschränkt ist, erscheint gerade in diesen als besonders proteisch und vieldeutig, bedingt sowohl durch die komplexe Bedeutungsgeschichte des philosophischen Form-Begriffs als auch durch die facettenreiche Geschichte poetologisch-literaturtheoretischer Reflexion über Formen und ihre jeweiligen Gegen- bzw. Komplementärkonzepte. Bereits seit der Antike diskutiert wird die (im Rahmen differenter Ästhetiken unterschiedlich beantwortete) Frage nach dem ontologischen Status der Form: Das mit dem dt. Wort ‚Form‘ übersetzte lat. ‚forma‘ korrespondiert einerseits dem griech. Begriff ‚eidos‘ (und damit der Bezeichnung für etwas den Sinnen Transzendentes), andererseits dem der ‚morphé‘ (und damit dem Namen für physisch Gestaltetes und sinnlich Wahrnehmbares). Der Ausdruck ‚Form‘ lässt sich entsprechend divergent interpretieren: als Äquivalent für „allgemeine Beschaffenheit, Wesensbestimmung“, aber auch für „sichtbare Gestalt, Umriß“ oder für „Gattung“ (Schildknecht 2007, Bd. 1, 613). Innerhalb der Philosophiegeschichte hat sich der Form-Begriff insgesamt so stark ausdifferenziert, dass das Historische Wörterbuch der Philosophie den Ausdruck gar nicht als einheitlichen Begriff präsentiert, sondern verschiedene Form-Begriffe in Einzelartikeln separat abhandelt: die „Form des Urteils“, die „innere Form“, die „logische Form“ sowie die Begriffsoppositionen „Form und Inhalt“ und „Form und Materie (Stoff)“. Neben dem ‚Inhalt‘ und der ‚Materie‘ kann (mit wiederum anderer Akzentuierung) auch das ‚Chaos‘ als Gegenbegriff zur ‚Form‘ fungieren. Für die Semantiken des Form-Begriffs prägend sind neben Diskursen der philosophischen Ontologie und Metaphysik nicht zuletzt auch Schöpfungsmythen verschiedener Provenienz, welche die Genese der Welt oder der Geschöpfe als einen Formungsprozess beschreiben, sowie Künstlermythen und -legenden, die von formender Arbeit berichten.
In Verbindung mit Gegenbegriffen wie ‚Inhalt‘, ‚Gehalt‘, ‚Materie‘ oder ‚Stoff‘ erscheint der Form-Begriff als metaphorisch grundiert. (Für seine griechischen Äquivalente ‚eidos‘ bzw. ‚morphé‘ gilt Entsprechendes.) Er gewinnt sein Profil insbesondere innerhalb sprachbildlich vermittelter Vorstellungen von Außen-Innen-Relationen, von Gefäßen sowie von Gebäuden, die den Raum organisieren und Wege durch ihr Inneres anbieten respektive vorschreiben. Die Unterscheidung von Form und Inhalt ist aus metaphorologischer Sicht ein wichtiges Beispiel für die Prägung des Denkens durch eine offenbar unhintergehbare Metaphorik. Als Inhalt bestimmt wird dabei entweder die (metaphorisch sogenannte) ‚stoffliche‘ Vorlage oder der gedankliche ‚Gehalt‘, etwa Ideen oder Empfindungen, welche sich an ‚Stoffliches‘ knüpfen. Gefäßmetaphorisch induziert ist u. a. die kritische Diagnose ‚leerer Formen‘.
Kontrovers beantworten Poetiker seit der Aufklärung die Frage, ob sich jeder Stoff mit jeder Form verbinden lasse. Damit verknüpft finden sich vielfach Erörterungen über den Status des Rhetorischen in der Dichtung, bei denen wiederum metaphorisch induzierte Vorstellungen ins Spiel kommen. Ist das Rhetorische ein bloßes Transportmittel? Ist es eine bloße Verpackung für einen die eigentliche poetische Substanz ausmachenden Inhalt? Ist es als Verpackung womöglich eine Verhüllung; macht es das Innere zunächst unsichtbar, bis dieses hermeneutisch freigelegt wird? Gibt es einerseits Formen, die Inneres verbergen, andererseits solche, die offenbarend wirken (vgl. Holz 1899, 49-50, wo vom Umgang mit Formen im Rekurs auf handwerklich-malerische Metaphern die Rede ist; vgl. Burdorf 2001, 381)? In der Avantgarde wird diese Offenbarungskraft geradezu als Qualität der ‚neuen‘ Form im Unterschied zur ‚alten‘ angesprochen, etwa im Rekurs auf handwerklich-malerische Metaphern bei Arno Holz: „Mit der alten Form konnte man noch verwischen und vertuschen, mit der neuen nicht mehr.“ (Holz 1899, 49-50).
Mit Einschätzungen der jeweils gewählten Form als einem Äußerlichen verbindet sich vielfach ihre Abwertung als ‚bloß rhetorisch‘ (und damit implizit eine Einschätzung der Rhetorik selbst). Im Sinn einer metaphorischen Grunddifferenzierung zwischen Innen und Außen charakterisiert noch 1959 Ingeborg Bachmann die öffentliche Rede des Dichter-Ichs als ein ‚formales‘ und insofern ‚rhetorisches‘ Unternehmen, bei dem das Mitzuteilende, das „Ich“ (gedacht als ‚Inneres‘), hinter dem ‚Äußeren‘ der Rede verschwinde: „Aber schon, wenn Sie hier allein heroben stehen und sagen zu vielen unten ‚Ich sage Ihnen‘, so verändert sich das Ich unversehens, es entgleitet dem Sprecher, es wird formal und rhetorisch.“ (Bachmann 1993 [1959/60], 217). Mit einem eigentümlichen Sprachbild, das eine metaphysisch semantisierte Lichtmetaphorik und konkrete Lichtbeobachtungspraktiken amalgamiert, äußert sich schon Goethe skeptisch gegenüber der Wahrheit von Formen: „Jede Form, auch die gefühlteste, hat etwas Unwahres; allein sie ist ein für allemal das Glas, wodurch wir die heiligen Strahlen der verbreiteten Natur an das Herz des Menschen zum Feuerblick sammeln.“ (Goethe 1977a [1775], 47).
Anlässlich der Frage nach Form und Gehalt bringen sich im Lauf der Ästhetikgeschichte insgesamt jedoch sehr unterschiedlich semantisierte Grundmetaphoriken des Äußeren und des Inneren zur Geltung. Da ist zum einen ein Ansatz, der physisch Äußeres als (letztlich kontingente) ‚Äußerlichkeit‘ auslegt und vom Inneren trennt; da ist zum anderen ein dem spätantiken Idealismus verpflichteter synthetischer Ansatz: Im Rekurs auf Plotinisches Denken gilt Inneres in ästhetisch-poetologischen Reflexionen oft auch als bedingend für die äußere Gestaltung ästhetischer Artefakte. Es sind zwar primär diese ‚inneren‘ Gehalte, denen das Interesse der idealistischen Ästhetik gilt; die äußere Form gilt dabei aber als genuine Entäußerung des Geistigen (s. u.). Dass unterschiedliche Varianten der Außen-Innen-Metaphorik gerade im Bereich der Form-Konzepte miteinander konkurrieren können, illustriert exemplarisch ein Gedicht Storms (vgl. Burdorf 2001), das zwei solche Varianten gegeneinander ausspielt (und zwar implizit wertend): die Gefäßmetapher und die Leibmetapher. Dem ‚gelehrten Dichter‘ mag die Form als „Gefäß“ für Inhalte erscheinen; anziehender erscheint ihre Analogisierung mit dem belebten Körper:
Poeta laureatus:
Es sei die Form ein Goldgefäß
In das man goldnen Inhalt gießt!
Ein Anderer:
Die Form ist nichts, als der Kontur,
Der den lebend’gen Leib beschließt.
(Storm 1987/88 [1885], Bd. 1, 93; vgl. Burdorf 2001, 219)
Werden Formen als Hüllen interpretiert, so kann die - ihrerseits metaphorische - Bestimmung des eingehüllten Inhalts als fester oder flüssiger ‚Stoff‘ aussagekräftige Anschlussmetaphern erzeugen. So etwa im Bild des Glockengusses, das Schillers Lied von der Glocke prägt: „Wenn die Glock soll auferstehen, / Muß die Form in Stücken gehen“, so heißt es hier, wobei zu bedenken ist, dass die nach dem Guß zerstörte „Form“ ja die Gestalt der Glocke geprägt hat (Schiller 81987 [1800], 439; vgl. Burdorf 2001, 21). ‚Masse‘ wiederum bezeichnet im achtzehnten Jahrhundert summarisch alles, was sich „auf die körperliche Fülle und Ausdehnung jenseits ihrer Formgebung“ bezieht (vgl. Benne 2015, 495).
Ästhetisch-kunsttheoretische Reflexionen über die Form sind von der Antike bis in die Gegenwart hinein im Übrigen vielfach einer (offenbar schwer hintergehbaren) ‚Material‘-Metaphorik verpflichtet. Leib-Seele-Metaphern sind dabei die vielleicht suggestivsten. Kritisch bemerkt der Ästhetiker Robert Zimmermann 1858:
Dass die moderne Aesthetik dasselbe [Wort „Form“] in engerem, meist nur im Gebiete der plastischen Kunst giltigen Sinne gebrauchte, hat sie in den Irrthum verwickelt, Inhalt und Form unter dem Bilde von Seele und Leib, Innerem und Aeusserem aufzufassen und so den Einklang zwischen beiden […] zum ausschliesslichen Bilde der Schönheit zu erheben. (Zimmermann 1870 [1862], 263; vgl. Burdorf 184)
Neben Stoff-Metaphern und Gefäßmetaphern wirken sich auch Derivate wie Bau- und Konstruktions-Metaphern, die bereits bei Plotin prominent entfaltet sind (vgl. Burdorf 2001, 61), bis in jüngere Zeiten prägend auf Beschreibungen ästhetischer Artefakte aus. Dies illustrieren exemplarisch Titel wie Bauformen des Erzählens (Lämmert 1955), aber auch Diskurse über das ‚Zerbrechen‘ oder ‚Auflösen‘ von Formen. Welche nachhaltige Bedeutung die metaphorisch grundierte Dichotomie von ‚Stoff‘ und ‚Form‘ als ‚Innerem‘ und ‚Äußerem‘ des Artefakts für Poetiken besitzt, wird nicht zuletzt deutlich an Versuchen der Konzeptualisierung einer abstrakten Dichtung (auch ‚konkrete Poesie‘ genannt), die im zwanzigsten Jahrhundert mit dem, was diese Opposition suggeriert, gerade zu brechen suchen (s. u.).
Formdiskurse prägen die Poetik qua Theorie dichterischer Werke und Intentionen unter werkästhetischer, unter produktionsästhetischer sowie auch (ansatzweise) unter rezeptionsästhetischer Akzentuierung. Die Vielzahl der metaphorisch grundierten oder doch durch Sprachbilder beeinflussten Bedeutungen von ‚Form‘ entfaltet sich in einem Spektrum zwischen deskriptiven und normativen Diskursen. Im Bereich der deskriptiven Verwendung des Terminus lässt sich unterscheiden zwischen der Gleichsetzung von ‚Form‘ mit ‚äußerer Gestalt‘ und ‚Form‘ als Bezeichnung der Relation von Ganzem und Teilen. Der normative Formbegriff ist stärker facettiert und bezieht sich auf Proportionen, Beziehungen zu einem Ideal etc. (vgl. Burdorf 2001, 23). Die Gegenbegriffe der ‚Unförmigkeit‘ oder ‚Formlosigkeit‘ haben ihre eigene Geschichte, wobei ihre Semantik sich ähnlich stark ausdifferenziert wie die der ‚Form‘. ‚Formlosigkeit‘ als ‚Gefahr‘ zu interpretieren, ist in kunstkritischen Diskursen auch der Moderne noch geläufig (vgl. Burdorf 2001, 3). Zur Charakteristik spezifischer Formdiskurse bei verschiedenen Autoren hilfreich erscheint die Differenzierung zwischen einem „emphatischen“ und einem „technischen Formverständnis“ (Burdorf 2001, 2).
2 Poetikgeschichtliche Variationen des ‚Form‘-Begriffs: Aspekte und Etappen im Überblick
Rhetorik und Poetik: Formkonzepte und Handwerksmetaphern
Die antike Rhetorik widmet sich im Zeichen der Basisdichotomie von Form und Inhalt der Frage nach den Relationen zwischen sprachlicher ‚Form‘ (verba) und ‚Inhalt‘ (res). Vor 1750 dominiert in der Poetik ein rhetorischer Formbegriff, demzufolge es gilt, die Wörter (verba) den Inhalten bzw. Gegenständen (res) anzupassen. Ein Zuordnungsprozess zwischen an sich verschiedenen Relaten findet statt und wird in entsprechenden Metaphern beschrieben. Eine Form wird einem Gegenstand ‚gegeben‘; die Form, in der er durch den Formgebungsprozess präsentiert wird, kann aber auch ‚verfehlt‘ werden bzw. ‚misslingen‘ (wobei der Gegenstand derselbe bleibt). Für einen Gegenstand die richtige Form zu wählen, ist aber ebenso erlernbar wie die praktische Umsetzung dieser Wahl; Dichtung erscheint unter diesem Vorzeichen als eine lehrbare Kunst (vgl. Burdorf 48-50). Handwerkergedichte können dort, wo sie Prozesse der Produktion und Bearbeitung von Stoff reflektieren, als poetologische Texte interpretiert werden - so etwa in einem Beispiel des Heinrich von Meißen (‚Frauenlob‘), wo es heißt: „ich forme, ich model, ich mizze“ (Frauenlob 1981 [um 1300], V. 13).
Bis heute geläufige Metaphern und Vergleiche aus dem Bereich der Handwerke und anderer gestaltender Praktiken korrespondieren mit diesem Konzept literarischer Gestaltungsarbeit: Metaphernspender sind das Herrichten von Objekten, das Zubereiten von Stoffen, das Zer- und Verteilen, das Durchdringen und Kneten, das Zusammenstellen (Komponieren) und Verfugen, das Feilen und Polieren. Dabei gilt im Allgemeinen die ‚gegebene‘ Form nicht als beliebig: Der Inhalt geht der Form voraus und entscheidet (im Zuge von inventio und dispositio) über Praktiken und Prinzipien formaler Gestaltung - so wie in Handwerken das zu bearbeitende Material die Auswahl der Instrumente und den Umgang mit diesen bestimmt. Erst im Zuge neuplatonistischer Neuansätze geht man dazu über, Form und Inhalt als Einheit zu denken (s. u.).
Außen-Innen-Metaphoriken und ihre Implikationen: Philosophisch-ästhetische Formreflexionen und das Konzept der ‚inneren Form‘
Es ist Aristoteles, der die Begriffsdichotomie von ‚Form‘ (forma, morphé) und ‚Materie‘ (hyle) in die Philosophie einführt. Er ordnet die Form der Materie über und bestimmt sie als das „Sosein eines jeden Dings und sein erstes Wesen“ (Metaphysik, 7,7, 1032 a-b). Künstlerische Produktion ist für ihn die Realisierung einer intendierten Form durch den Arbeitsprozess. Form und Inhalt bilden im Werk eine Einheit. In Abweichung davon konzipiert Plotin eine ‚innere Form‘ in der Seele des Produzenten, die der ‚äußeren Form‘ im realisierten Werk vorangeht und der platonischen ‚Idee‘ entspricht (vgl. Schildknecht 2007, Bd. 1, 613). Zu Recht spricht Klaus Städtke bezogen auf die antike Begriffsbildung von ‚Form‘ und ‚Materie‘ von einer zweifachen Relationierung: zum Stofflichen auf der einen Seite, zu Idee und Bedeutung auf der anderen:
Form steht in einer unaufhebbaren Relation zu ‚Materie‘, ‚Material‘, ‚Stoff‘, d. h. zu einem Nicht-Geformten (bzw. Formlosen), und andererseits zu ‚Zweck‘, ‚Inhalt‘, ‚Bedeutung‘, ‚Idee‘, d. h. zu einem geistigen, das die Formung verursacht, durch sie zur Existenz gebracht und durch die gestaltete (materialisierte) Form repräsentiert wird. So bedeutet attributivisch ‚formal‘ in diesen Relationen das bestimmende Moment, ‚material‘ hingegen das bestimmte Moment. (Städtke 2001, 463-464)
Die Differenzierung zwischen äußerer Erscheinung und Inhalt prägt in Nachwirkung antiker Ansätze die mittelalterliche Ästhetik ebenso wie die der Renaissance. In mittelalterlichen Form-Diskursen ist das Konzept der Proportion prägend, über das der Begriff des Schönen bestimmt wird. Entsprechend orientieren sich ästhetische Reflexionen vielfach an mathematischen und architektonischen Vorstellungen. Für die Poetikgeschichte des Form-Begriffs besonders folgenreich ist die Horaz’sche Forderung, das poetische Werk möge eine geschlossene Einheit bilden, ‚simplex et unum‘ sein. In der Aufklärung allerdings wird diese Forderung allmählich zurückgenommen, vor allem unter dem Einfluss der Ästhetik Alexander Gottlieb Baumgartens; Komplexität und ‚Mannigfaltigkeit‘ sind im Folgenden eher positiv konnotiert. Konzepte der Mischung, der Wechselwirkung, der Pluralität und der Vieldeutigkeit erscheinen sukzessiv als ästhetisch relevant - sei es, dass das ästhetische Artefakt in Analogie zum lebendigen Organismus gedacht wird, sei es, dass es als dessen betont artifizieller Gegenentwurf erscheint. Das Nachdenken über ästhetische Formen ist von der Neuaushandlung der Relationen zwischen Einheit und Vielheit, Einfachheit und Komplexität, Transparenz und Polysemie evidenterweise nachhaltig betroffen; die Formdiskurse sind durch entsprechende Sprachbilder, Vergleiche und Metaphern geprägt.
Autonomisierung der Ästhetik und Formbegriff: die ‚inneren Formen‘ und das Innere des Produzenten
Bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts kann von einem genuin ästhetischen Form-Begriff nicht gesprochen werden. Als die Ästhetik dann zum eigenständigen Diskurs wird, gewinnt der Form-Begriff erkennbar an Bedeutung (dazu Burdorf 2001, 46-47), ablesbar u. a. an Enzyklopädie-Artikeln und ähnlichen Quellen. Im Zusammenhang damit entsteht eine eigenständige Form-Ästhetik, die sich von der Funktion löst, nur eine technisch-‚richtige‘ Textgestaltung zu lehren. Das Begriffspaar „Form und Inhalt (Gestalt/Stoff, Gehalt)“ gewinnt tragende Bedeutung (Schwinger 1972, Sp. 975-977). Außen-Innen-Metaphoriken sind im Horizont eines Diskurses, der Subjektivität zunehmend nachdrücklicher als ‚Innerlichkeit‘ interpretiert, von besonders suggestiver Wirkung. Vor allem die Plotinische Ideenlehre bietet ihren neuzeitlichen Rezipienten ein Konzept der Beziehung zwischen äußerer Erscheinung und innerer Form, das die Überwindung des älteren Formbegriffs, demzufolge den vorgängigen Inhalten gemäß dem aptum eine Form zugeordnet wird, gestattet. Shaftesbury knüpft an Plotin an und spricht von einer inward form als einer Naturkraft, welche als forming power äußere Formen hervorbringe. Der Dichter respektive Künstler erscheint als formgebende Instanz, wobei sein Inneres - bei Shaftesbury und seinen Nachfolgern - als Fundus derjenigen Formen gilt, auf den dann bei der äußeren Gestaltung zurückgegriffen wird.
Seit sich im achtzehnten Jahrhundert ein genuin ästhetischer Formbegriff konstituiert (so lässt sich generalisierend feststellen), wird das, was die Form eines Werks ausmacht, nicht mehr als etwas betrachtet, das man aus einem gegebenen Bestand auswählt, um damit möglichst effizient seine Zwecke zu verfolgen. Metaphorisch grundierte Vorstellungen eines zweckmäßigen Vorgehens mittels bereitstehender Instrumente, eines Zurichtens vorgegebener Materie treten tendenziell (wenn auch nie ganz) zurück. Über das jeweilige Werk respektive Projekt selbst wird nun vielmehr reflektiert, indem über eben seine Form reflektiert wird - und in Zusammenhang damit über den Arbeitsprozess sowie über den Rezeptionsprozess (vgl. Burdorf 2001, 12, Kap. II, 2).
Die Shakespeare-Rezeption des achtzehnten Jahrhunderts steht u. a. im Zeichen kontroverser Einschätzungen klassizistischer und antiklassizistischer Ansätze und wirkt sich auch auf den Form-Diskurs prägend aus. An Positionen klassizistisch-französischer Ästhetik orientiert, distanziert s...