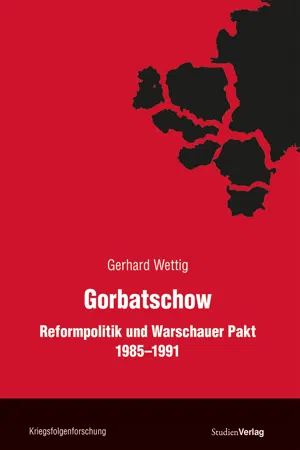![]()
Entwicklung der Politik Gorbatschows
Grundlegende Entscheidung für kooperative Sicherheit mit dem Gegner
Auf dem europäischen Schauplatz setzte eine für die UdSSR und den Warschauer Pakt negative militärische Entwicklung ein. Das konventionelle Kräfteverhältnis verschob sich zugunsten der NATO. Beeindruckende Fortschritte der westlichen Rüstungstechnik machten es wahrscheinlich, dass diese eine zunehmend überlegene Position erringen werde. Die Durchführbarkeit des – der Moskauer operativen Planung zugrunde gelegten – Konzepts einer sofortigen raumgreifenden Offensive wurde zweifelhaft, weil die großen Panzerverbände, von denen der Erfolg abhing, künftig von rascher Vernichtung bedroht sein würden. Man habe deswegen davon auszugehen, dass statt des östlichen Angreifers der westliche Verteidiger im Vorteil sein werde.58 Aus Informationen, die mittels Spionage gewonnen worden waren, ergab sich, dass die NATO künftig in der Lage sein würde, mit ihren qualitativ verbesserten konventionellen Kampfmitteln ebenso schlimm zuzuschlagen wie mit Nuklearwaffen. Das werde ihren Streitkräften zum Sieg verhelfen.59 Die Ratlosigkeit, die dieser Einschätzung folgte, förderte die Bereitschaft der sowjetischen Generalität, sich auf Änderungen der Strategie einzulassen und entsprechende Vorgaben der politischen Führung zu akzeptieren. Das war keineswegs selbstverständlich, denn die Militärs hatten stets darauf bestanden, dass derartige Fragen ihre ureigene Domäne seien, in die niemand von außen eindringen dürfe.
Gorbatschow wollte die bisherige außen- und sicherheitspolitische Orientierung zunächst beibehalten: Die sozialistischen Staaten müssten die Reihen schließen, um gegen den Feind im Westen Front zu machen.60 Ihm war aber von Anfang an klar, dass die offizielle These, der Westen sei sozioökonomisch und technologisch unterlegen und müsse wegen seines monolithischen und aggressiven Charakters als der böse Feind gelten, nicht der Realität entsprach. Mit den anderen Führungsmitgliedern teilte er von Anfang an die Überzeugung, es dürfe keinesfalls zu einer nuklearen Auseinandersetzung kommen.61 Nur dann konnte die Sowjetunion einen militärischen Konflikt mit dem Westen unbeschadet überstehen, weil die Zerstörungen – anders als im Zweiten Weltkrieg – wesentlich auf fremdem Gebiet stattfinden würden. Als er nach seinem Amtsantritt die Raketenabwehrstellungen um Moskau besuchte, wurde ihm klar, dass diese Sicherheit verloren gegangen war und sich auch durch neue Rüstungsanstrengungen nicht wiedergewinnen ließ. Die Befehlshaber erklärten ihm, im Kriegsfalle wäre die Hauptstadt den in der Bundesrepublik neu stationierten Pershing II schutzlos preisgegeben. Gegen diese könne man wegen ihrer extrem kurzen Flugzeit keine Verteidigungsmaßnahmen treffen.
Dem politischen und militärischen Zentrum der UdSSR, das bis vor Kurzem unangreifbar gewesen war, drohte demzufolge augenblickliche Vernichtung, denn der Gegner würde diese Raketen sofort abschießen, weil sie andernfalls aufgrund ihrer exponierten vorderen Position in den einsetzenden Kämpfen rasch ausgeschaltet wären. Daraus zog Gorbatschow den Schluss, die von der Pershing II ausgehende Gefahr lasse sich nur durch Verhandlungen und Vereinbarungen mit den USA über einen Verzicht auf dieses Waffensystem bannen.62
Mithin sollte an die Stelle der Rüstung gegen den westlichen Gegner ein Zusammenwirken mit ihm treten. Deshalb schlug Gorbatschow den Amerikanern am 7. April 1985 eine wechselseitige Reduzierung der Kernwaffen vor, die alle Pershing-II-Flugkörper einbeziehen sollte.63 Auch wenn er zunächst nur geringe Gegenleistungen anbot, war dies doch ein prinzipieller Richtungswechsel: Sicherheit sollte geschaffen werden nicht mehr durch Rüstung gegen den Widersacher, sondern durch Kooperation mit ihm. Dem Bemühen war kein rascher Erfolg beschieden. US-Präsident Ronald Reagan sah keinen Grund zum Verzicht auf eine wesentliche Komponente der Nachrüstung, solange die UdSSR an der SS 20 festhielt. Bei der ersten persönlichen Begegnung in Genf im November kam bloß eine gemeinsame Erklärung des Inhalts zustande, ein Nuklearkrieg lasse sich nicht gewinnen und dürfe daher keinesfalls geführt werden. Für Gorbatschow war wichtig, dass damit der Dialog auf Ost-West-Ebene begonnen worden war. Fortan setzte er sein Bemühen hartnäckig fort, die Abrüstung der Mittelstreckenraketen auf der Tagesordnung zu halten und auf längere Sicht eine Regelung zu erreichen, welche die von ihnen ausgehende Gefahr beseitige und seinem Land einen Rüstungswettlauf erspare, dem es nicht gewachsen wäre.64 Um die Öffentlichkeit vor allem in den USA zu mobilisieren, präsentierte er am 25. Februar 1986 auf dem XXVII. Parteitag der KPdSU einen Drei-Stufen-Plan zur Beseitigung der Kernwaffen bis zum Jahr 2000.65
Zur Begründung führte Gorbatschow aus, die bewaffnete Konfrontation zwischen beiden Lagern sei das prinzipielle Übel, von dem man sich befreien müsse. Kein Staat, wie mächtig er auch sei, könne Sicherheit nur durch eigene Anstrengungen und nur mit militärischen Mitteln erlangen, denn für Kriege und für eine Politik der Stärke sei die Welt zu klein geworden. Diese lasse sich nur retten und bewahren, wenn man mit den Denk- und Handlungsweisen breche, „die jahrhundertelang auf der Vertretbarkeit, auf der Zulässigkeit von Kriegen und bewaffneten Konflikten beruht haben“. Solange sich daran nichts ändere, habe „jede der Seiten gleiche Unsicherheit“. Gorbatschow zog weitreichende Schlüsse. Halte man am Wettrüsten weiter fest, werde die Gefahr immer mehr zunehmen. Dann könnte sogar die Parität aufhören, „ein Faktor der militärisch-politischen Zurückhaltung zu sein“. Nicht das Gleichgewicht der militärischen Fähigkeiten, sondern allein ein Ausgleich der politischen Interessen schaffe Frieden. Die Hauptgefahr seien die Kernwaffen, denn diese bedrohten die Menschheit insgesamt und müssten daher restlos beseitigt werden. Nicht nur die nukleare Kriegsführung, sondern auch deren Vorbereitung könne weder Sieg noch Gewinn bringen, denn auf Dauer lasse sich Sicherheit nicht aufbauen auf der „Angst vor Vergeltung, d. h. auf den [westlichen] Doktrinen der ‚Eindämmung‘ oder ‚Abschreckung‘“.66
Gorbatschow suchte weiter durch Verhandlungen die USA zum Verzicht auf ihre neuen Raketen in Europa zu bewegen. Wie er im Politbüro erklärte, war die Stationierung der SS 20 „ein schwerer Fehler“ gewesen, denn sie habe zu jener „ernsten Bedrohung“ durch die Pershing II geführt, die unbedingt beseitigt werden müsse. Das lasse sich nur auf der Basis „gleicher Absenkung des Rüstungsstandes“ erreichen, die der anderen Seite keine Nachteile zumute. Er erklärte sich prinzipiell bereit, einen beiderseitigen Verzicht auf Raketen mittlerer Reichweite in Europa zu akzeptieren. Damit würde die UdSSR zwar viel aufgeben, doch das könne sie sich leisten, denn sie wolle keinen Krieg führen.67 Zur konsequenten Verfolgung dieser Linie kam es jedoch lange Zeit nicht. Er hegte gegenüber der Führung in Washington Misstrauen und glaubte, sie betreibe eine antagonistisch ausgerichtete Politik. Daher war für ihn der Warschauer Pakt die „einzige Kraft“, die über die materiellen Möglichkeiten verfüge, „einen Kernwaffenkrieg zu verhindern“ und „den Lauf der Geschehnisse in die Richtung der Entspannung zu lenken“. Im Grunde lief das auf die hergebrachte Vorstellung hinaus, dass sich die Aggressivität des Gegners nur durch eine starke Militärmacht zügeln lasse.68 Gorbatschow war aber zu begrenzten Gegenleistungen bereit. Im September 1986 bot er an, wenn die amerikanischen Euroraketen, vor allem die Pershing II, beseitigt würden, wolle er in Europa auf 100 SS 20 heruntergehen und ihre Zahl in Asien einfrieren. Das hätte die Gefahr für Moskau beseitigt.
Die Bedrohung Westeuropas und Ostasiens wäre aber auch mit dem verringerten sowjetischen Arsenal bestehen geblieben. Die USA antworteten, die Mittelstreckenraketen müssten weltweit verschrottet werden. Gorbatschow ging, nachdem er und Reagan bei ihrer zweiten Begegnung in Reykjavík am 11./12. Oktober 1986 zueinander Vertrauen gefasst hatten, darauf ein. Er war bereit, die Ausschaltung vor allem der Pershing II mit dem Verzicht auf sämtliche SS 20 sowohl in Europa als auch in Asien zu honorieren. Das Abkommen scheiterte jedoch daran, dass seine Forderung nach einem Ende der amerikanischen „Strategischen Verteidigungsinitiative“ (SDI) auf Ablehnung stieß. Dieses Rüstungsprogramm erschien den Experten, auch solchen in der UdSSR, meist unrealistisch; die zugrunde gelegte Vorstellung, man könne alle angreifenden Kernwaffen vernichten, sei eine Illusion. Gorbatschow hatte jedoch die Sorge, dass die Forschungen und Entwicklungen, welche die USA im Blick darauf durchführten, erneut zu bedrohlichen technischen Innovationen führen würden, denen sein Land nichts Entsprechendes entgegenzusetzen habe. Reagan dagegen glaubte, dass sein Projekt, an dem er auch andere Staaten einschließlich der Sowjetunion zu beteiligen bereit war, zu einer Welt ohne nukleare Gefahr führen würde.69 Trotz der gescheiterten Übereinkunft sah Gorbatschow einen wesentlichen Verhandlungsfortschritt. Nachdem das Gespräch 1985 in eine Sackgasse geführt habe, sei es jetzt zum entscheidenden Durchbruch gekommen. Es habe sich gezeigt, dass eine Verständigung möglich sei. Man müsse nur noch etwas warten. Zwar hätten die USA den Anspruch auf militärische Überlegenheit noch nicht fallen lassen, doch kenne man jetzt ihre Haltung besser.70
Gorbatschow bemühte sich weiter um eine Regelung. Die Ausschaltung der Pershing II erschien ihm so wichtig, dass er bereit war, sich mit einem zehnjährigen SDI-Moratorium zufrieden zu geben. Das führte im Laufe des folgenden Jahres zur Übereinkunft.71 Am 8. Dezember 1987 setzten Reagan und Gorbatschow in Washington ihre Unterschriften unter den INF-Vertrag.72 Darin wurde die wechselseitige Verschrottung aller Raketen in Europa und Asien mit Reichweiten zwischen 500 und 5.500 km festgelegt.73 Die UdSSR verzichtete auf ungleich mehr Systeme und Sprengköpfe als die USA. Sie akzeptierte auch erstmals intensive Vor-Ort-Inspektionen zur Überprüfung der vereinbarten Abrüstungsmaßnahmen.74 Die Zugeständnisse zeigen, dass Gorbatschow die Pershing II unbedingt eliminieren wollte und seine Sicherheitspolitik generell auf die Zusammenarbeit mit Washington stützte. Die Kurzstreckenraketen blieben in vollem Umfang bestehen. Aus der Sicht des Kremls kam ihnen geringe Bedeutung zu, weil sie für den Einsatz im frontnahen Bereich bestimmt waren, mithin sowjetisches Territorium nicht bedrohten. Zudem war nicht zu befürchten, dass es zu einer Eskalationsfolge bis hinauf zur global-strategischen Ebene der beiden Führungsmächte kommen konnte.
Die UdSSR war damit nach menschlichem Ermessen auch im Kriegsfall vor einer nuklearen Zerstörung geschützt. Zugleich beseitigte das SDI-Moratorium für die Dauer eines Jahrzehnts – und, wie sich zeigen sollte, endgültig – die ...