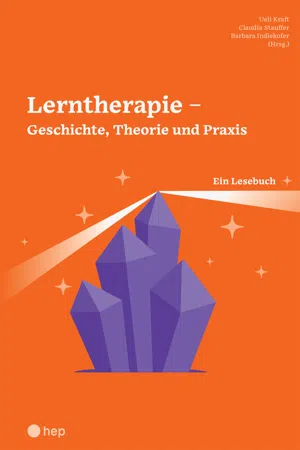
eBook - ePub
Lerntherapie – Geschichte, Theorie und Praxis (E-Book)
Ein Lesebuch
- 440 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Lerntherapie – Geschichte, Theorie und Praxis (E-Book)
Ein Lesebuch
Über dieses Buch
Dieses E-Book enthält komplexe Grafiken und Tabellen, welche nur auf E-Readern gut lesbar sind, auf denen sich Bilder vergrössern lassen.Zwanzig Expert*innen aus Bildungswissenschaften, der Psychologie, der Psychotherapie und der Lerntherapie geben Einblick in die Lerntherapie im deutschsprachigen Raum. Indem die Autor*innen die Lerntherapie jeweils aus ihrem theoretischen Blickwinkel heraus präsentieren, vermittelt das Buch erstmals und auf anschauliche Weise das interdisziplinäre Denken der Lerntherapie und macht dadurch deren Komplexität erfahrbar.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Lerntherapie – Geschichte, Theorie und Praxis (E-Book) von Ueli Kraft,Claudia Stauffer,Barbara Indlekofer im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Bildung & Bildung Allgemein. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Teil I:
Grundlegendes zur Lerntherapie
1 Fragmentarisches zur Geschichte der Lerntherapie – ‹avant la lettre› bis zu den eigentlichen Anfängen
Ueli Kraft
In diesem Kapitel werden die Anfänge der Lerntherapie, welche weiter zurückreichen, als man vermuten würde, aus historischer Perspektive erkundet. Der Beitrag befasst sich zunächst mit der Frühgeschichte, während der Pionierinnen und Pioniere lerntherapeutisch gearbeitet haben, lange bevor der Begriff geprägt worden ist. Wir finden diese im Umfeld der psychoanalytischen Pädagogik, welche die vor circa 100 Jahren entstandene Erziehungsberatung stark beeinflusste, in deren Rahmen Schul- und Lernprobleme sehr häufig den primären Beratungsanlass boten. Im Zusammenhang mit der in etwa halb so alten Geschichte der eigentlichen Lerntherapie werden die frühen und zum Teil voneinander abgeschotteten Konzeptionen der wichtigsten Exponenten nachgezeichnet und die Antwort auf die Frage gesucht, wer den Begriff der Lerntherapie ursprünglich geprägt hat. Die reiche Vielfalt lerntherapeutischer Zugänge wird in der Hoffnung skizziert, daraus – auch auf der Metaebene verschiedener lerntherapeutischer Schulen – Lust auf bereichernde Begegnungen zu wecken.
1.1 Zur Sache
Der Versuch, wenigstens Teile der Entstehungsgeschichte der Lerntherapie zu rekonstruieren, setzt aus Schweizer Perspektive zunächst bei Armin Metzger (1945–2019) an – und stösst auf unerwartete Schwierigkeiten: bevor er 2011 sein von ihm 1990 gegründetes Institut für Lerntherapie verkaufte, liess er das Institutsarchiv aus unbekannten Gründen entsorgen. Abgesehen von seinen beiden Buchpublikationen – «Lerntherapie. Wege aus der Lernblockade – Ein Konzept» (2001) und «Lerntherapie in Theorie und Praxis» (2008) – hat er vergleichsweise wenig publiziert. Er erwähnt eine unveröffentlichte Diplomarbeit in Heilpädagogik aus dem Jahr 1972 («Schach in der Hilfsschule»), welche «Wechselwirkungen zwischen Kognition und Emotion» fokussiert (2008, S. 137). Eine zweite – ebenfalls unzugängliche – Diplomarbeit in Erziehungs- und Schulberatung aus dem Jahr 1975 («Apropos Beobachtungsklasse») wird lediglich im Literaturverzeichnis angeführt (2008, S. 408). Seine zeitnah zur Institutsgründung eingereichte Dissertation («Begegnung und Beziehung als Auslöser von Entwicklung und Genesung – Zur Bedeutung der Psychotherapie für die Sonderpädagogik» (1990) beinhaltet zwar Ansätze einer theoretischen Grundlegung – das Thema «Lernen» wird aber nur ganz am Rande aufgegriffen und der Begriff «Lerntherapie» kommt gar nicht vor. Zu dem von einer ehemaligen Studentin des Instituts herausgegebenen Buch «Lerntherapie in der Praxis» steuert er ein kurzes Vorwort und eine Darstellung seines Vierstufenmodells bei (Suter, 2003, S. 14–20). Ein Tagungsbeitrag «Lerntherapie – Auf den Spuren der Persönlichkeit» wurde 2003 veröffentlicht, ein kurzer Handbuchartikel («Lerntherapie») 2014.
Verweise auf die in Deutschland seit den Achtzigerjahren bestehende Tradition der Lerntherapie sind bei Metzger äusserst spärlich. 2008 erwähnt er – ohne inhaltliche Bezüge – Betz und Breuninger, welche den Begriff der Lerntherapie bereits 1987 verwenden. In seinem Handbuchartikel findet sich lediglich ein Satz: «Weitere Ausdifferenzierungen der lerntherapeutischen Konzepte lassen sich derzeit im Ansatz der ‹strukturellen Lerntherapie› (vgl. Betz & Breuninger, 1987), in der ‹integrativen Lerntherapie› (vgl. Nolte, 2008) und in der ‹bewältigungsorientierten Lerntherapie› (vgl. Ruff, 2007) erkennen» (Metzger, 2014, S. 153). Aus historischer Perspektive helfen die erwähnten Autorinnen und der Autor auch nicht weiter, abgesehen vom Ergebnis einer bereits 1987 belegten Verwendung des Begriffs.
Wer dann mit gleichschwebender Aufmerksamkeit zu Expeditionen in die Tiefen des World Wide Web aufbricht, häuft zunächst ein kaum überblickbares Konvolut an überwiegend unbrauchbaren Texten an, macht aber auch unerwartete Entdeckungen. Die erstaunlichste sei vorweggenommen: Idee und Praxis dessen, was wir heute als Lerntherapie bezeichnen, haben offenbar eine wesentlich längere Vorgeschichte, als die aktuelle Fachliteratur suggeriert. Wer diese allerdings detailliert beschreiben wollte, würde einige Lebensjahre übrig haben und einen potenten Financier oder eine potenten Financière finden müssen. Wer beides nicht hat, kann sich – in der Sprache der Archäologie – immerhin darauf konzentrieren, Sondiergrabungen vorzunehmen, welche das Feld wenigstens in einigen Hinsichten strukturieren helfen.
1.2 Biografische Reminiszenzen
Nichthistorikerinnen und -historiker auf Spurensuche nach Vorläufern heutiger Lerntherapie tun dies mit eingeschränktem Handwerkszeug. Aber seit Lindqvist 1978 «Grabe, wo du stehst. Handbuch zur Erforschung der eigenen Geschichte» (deutsch 1989) veröffentlicht hat, können historische Laien mit gutem Gewissen dort ansetzen, wo Erinnerungen aus dem Bereich eigener Erfahrungen zugänglich sind:
Zu meinen Kindheitsschätzen gehört eine von Kinderhand modellierte und bemalte kleine Schildkröte. Entstanden ist sie im Rahmen von Therapiestunden in der damaligen kantonalen Erziehungsberatungsstelle in Schaffhausen. Nach einem 1959 erfolgten Umzug aus einer Kleinstadt in ein Bauerndorf war ich sozial überfordert und zeigte grosse Mühe, mich in die neue 2. Klasse zu integrieren. Vor der Lehrerin hatte ich Angst (sie reagierte auf Verstösse gegen – mir nicht bekannte – Regeln mit Schlägen), meine Noten sanken. Die permanenten Ermahnungen meiner ängstlichen Mutter, mir mehr Mühe zu geben, halfen auch nichts. Ich wurde zu einer psychologischen Abklärung gebracht, woraus sich eine Therapie bei einem lieben älteren Mann ergab, dessen Namen ich heute noch weiss. Diese dauerte sicher 20 Stunden und folgten – wahrscheinlich nach einer testpsychologischen Abklärung, an die ich mich nur sehr vage erinnere – einem einfachen Ablauf: Jede Stunde begann mit einem für mich unvertraut langen Gespräch, anschliessend durfte ich malen, modellieren und mit dem wunderbaren kleinen Sandkasten auf Rädern und den kleinen Menschen- und Tierfiguren spielen. Ich genoss die geduldige Aufmerksamkeit des Therapeuten und war traurig, als meine schulischen Leistungen stiegen und ich nicht mehr hindurfte.
Jahre später: als frisch ausgebildeter «Psychologe mit Fachrichtung Berufsberatung» (inklusive bereits drei Jahren Teilzeiterfahrung als Berufsberater in Schaffhausen) war ich vom testdiagnostisch dominierten Arbeitsalltag bereits ernüchtert und verzichtete auf eine angebotene Festanstellung. Zufällig ergab sich an der bereits genannten Erziehungsberatungsstelle 1976 eine Möglichkeit, das parallel begonnene Studium der Psychologie und der Sonderpädagogik an der Uni Zürich weiter finanzieren zu können. Als gut ausgebildeter und bereits etwas erfahrener Test- und Psychodiagnostiker hatte ich – in Teilzeit – Schulabklärungen und Begutachtungen zu machen, aber auch Beratungen von Eltern. Ab und an liess man mich vertiefter mit einzelnen Kindern arbeiten, was man damals gleichermassen grosszügig und ungefähr als Spieltherapie bezeichnete. Da war er wieder, der kleine Sandkasten mit den vielen Figuren (meine Akte von 1959 wurde zu Beginn der 70er-Jahre allerdings leider geschreddert). Erinnern kann ich mich durchaus auch an stattgefundene supervisierende Gespräche mit dem vor der Pensionierung stehenden Stellenleiter; ich glaube auch zu wissen, dass der spätere neue Leiter die Auflage erhielt, eine psychotherapeutische Ausbildung nachzuholen.
Im Zusammenhang mit unserem Anliegen war ich überrascht, dass mir dies in all den Jahren noch nie aufgefallen war: Was ich 1959 als Kind auf einer Erziehungsberatungsstelle erlebte, war nach heutigem Verständnis eine psychologisch-therapeutische Lerntherapie. Sie ging die Schwierigkeiten an, welche hinter dem Symptom gestörten Lernens lagen – und beseitigte damit auch die Lernprobleme nachhaltig.
Anzumerken ist weiter: In der Schweiz war die Bezeichnung «Erziehungsberatung» für Dienststellen, welche sich mit schulpsychologischen Fragestellungen befassten, damals die gebräuchlichste. Allerdings zeichnete sich in den 50er- und 60er-Jahren bereits ab, dass die schulpsychologischen Dienste eher nahe der Schule selbst und in Kooperation mit der Heilpädagogik operierten, während die Erziehungsberatungsstellen ihre Arbeit eher psychologisch-therapeutisch verstanden. Ich entnehme dies Käser (1993), welcher die Entstehungsgeschichte der Schulpsychologie in der Schweiz seit 1920 in Bern detailliert nachgezeichnet hat. Zu diesen Anfängen verweist er (2016, S. 16) auf eine UNESCO-Konferenz zur Schulpsychologie von 1954 in Hamburg, welche in ihrem Bericht Folgendes lobend unterstreicht: «Die Schweiz war dank den Bemühungen Claparèdes in Genf (1912) und Heggs in Bern (1920) eines der ersten Länder mit psychologischen Diensten überhaupt.» Er übernimmt dies nach Hegg, S. (1977, S. 105), welche weiter aus dem Bericht zitiert:
Die Erziehungsberatungsstelle der Stadt Bern, die 1920 von Dr. Hegg gegründet wurde, ist zum Beispiel eine selbstständige Einrichtung innerhalb des schulärztlichen Dienstes. Ihre wichtigsten Aufgaben sind die psychologische Beratung der Schulen, die Erfassung, Untersuchung und psychotherapeutische, heilpädagogische oder andere Behandlung von schwierigen oder zurückgebliebenen Kindern und die allgemeine psychologische Aufsicht über die Sonderklassen der Stadt. (A.a.O., S. 105)
In diesem Pflichtenheft könnte der Begriff der Lerntherapie ohne Probleme untergebracht werden. Grund genug, uns vertiefter mit dieser verblüffenden Frühgeschichte zu beschäftigen.
1.3 Zur Frühgeschichte dessen, was wir heute Lerntherapie nennen
Datiert vom 3. März 1910, erhält Paul Häberlin, der spätere Ordinarius für Philosophie, Pädagogik und Psychologie der Universität Bern, einen Brief von Sigmund Freud. Dieser hoffte, ihn in seinen Kreis aufnehmen zu können, und schreibt unter anderem die folgenden Zeilen: «Ich weiss, dass die Psychoanalyse in Beziehung zur Pädagogik treten muss, kann aber selber nichts da für thun. Ich weiss auch, dass sie zur Selbsterziehung mächtig anregt und dass man grosse innere Widerstände überwinden muss, ehe man sich ganz mit ihr befreunden kann …» (zit. nach Hegg, S., 1977, S. 77).
Bevor Häberlin 1914 in Bern Professor wurde, hatte er in Basel Theologie studiert und in Philosophie, Zoologie und Botanik promoviert. Seine Beziehung zu Freud hatte sich über seine Freundschaft mit den Psychiatern Robert und Ludwig Binswanger angebahnt und war für seine Theoriebildung von grosser Bedeutung – obwohl er sich mit der Lehre Freuds nie völlig hat befreunden können. «Trotz aller Hochschätzung der durch die Psychoanalyse gewonnenen psychologischen Einsichten musste er die Lehre in ihren Grundlagen ablehnen, da die Weltanschauung und die Anthropologie, welche dahinter standen, einseitig naturwissenschaftlich-biologisch orientiert waren» (a.a.O., S. 77). Häberlin selber schreibt:
Religiöser Glaube, ethische Norm, und was damit zusammenhing, durfte nicht zu Recht bestehen, musste ‹zeranalysiert› werden, bis nichts anderes übrig blieb als nackter Trieb. Die psychoanalytische Theorie war mehr als Psychologie, sie entsprang aus anti-autoritativer Einstellung und mündete wieder in eine Art von kulturellem Nihilismus oder Relativismus. (Dies gilt sicher nicht von der Persönlichkeit Freuds, wohl aber von seiner Theorie.) (1959, S. 55).
Diese Reserviertheit hinderte ihn allerdings nicht daran, Person und Werk hoch zu schätzen, den Diskurs mit Freud auch persönlich zu führen und von ihm «starke Anregungen» für eine «wirklich psychologische Psychologie» zu gewinnen, welche ihm vorschwebte (a.a.O., S. 52). Seine Studenten hatten sich mit der Psychoanalyse vertraut zu machen – so auch Hans Hegg, der nac...
Inhaltsverzeichnis
- [Cover]
- [Impressum]
- [Inhaltsverzeichnis]
- Vorwort
- Grundlegendes zur Lerntherapie
- Lerntherapie in theoretischer Vielfalt
- a) Lerntherapie aus der Perspektive verschiedener Theoriezugänge
- b) Lerntherapie aus der Perspektive verschiedener Beeinträchtigungen
- Die Praxis der Lerntherapie im Aufbruch
- Anhang
- Fußnoten