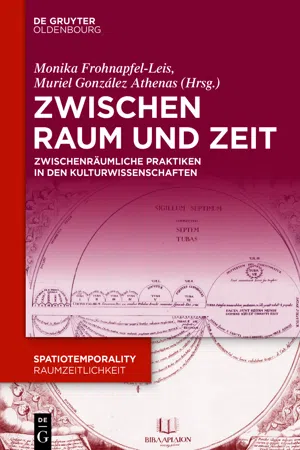Raum betrifft alle Bereiche des menschlichen Lebens, in historischen wie in gegenwärtigen Gesellschaften. Das Interesse an ihm hat in verschiedenen Forschungsdisziplinen in den letzten Jahren zugenommen, so etwa an der Frage nach räumlichen Strukturen als methodischem Zugang in den Geschichtswissenschaften. In Gesellschaft und Medien wird aktuell die Idee des geopolitisch und geographisch einheitlichen Raums Europas wieder viel diskutiert. Vorstellungen von den geschlossenen und klar verortbaren Grenzen sowohl nach „innen“ als auch nach „außen“ haben Konjunktur. In diese Vorstellungen betten sich geschlossene einheitliche Bilder von „Wir“ und den „Anderen“ ein, die wenig dazu beitragen, die Konflikte um Krieg, Flucht und Migration zu lösen, aber nachhaltig den Bewegungs- bzw. Fluchtraum stark einschränken und seine Grenzen mitunter tödlich machen. Dem zugrunde liegt eine als räumliche Einheit begriffene Geographie des Kontinents „Europa“, die selten hinterfragt wird.1 Eine Analyse, wie solche Raumvorstellungen entstanden sind, könnte hier zur Versachlichung von Debatten führen. Die Raumforschung bewegt sich in einem Spannungsfeld, das stark interdisziplinär und epochenübergreifend geprägt ist.
Eine Frage, die die geschichtswissenschaftliche Forschung immer wieder umtreibt, ist: Welchen Mehrwert können wir von Raumkonzepten für die Analyse von komplexen (historischen) Fragestellungen, Konstellationen und Bedingungen, von Entstehung und Zerfall, von Bruch, Wandel und Kontinuität, von Macht- und Geschlechterverhältnissen usw. erwarten? Eine der in der neueren Raumforschung viel diskutierten Analyseperspektiven ist die des „Zwischenraumes“, bisweilen auch als Leerstelle, „space in between“ oder transitorischer third space bezeichnet.2 Praktisch verortbare Zwischenräume sind uns vertraut aus den unterschiedlichsten Alltagskonstellationen wie Bahnsteige, Flure, Stadtarchitekturen, Grenzverläufe, etc. Kulturwissenschaftlich perspektiviert können diese auch als Gegenräume, Zwischenstadien, (literarische) Leerräume, Hybriditäten, Dritte Räume, Zeiträume, kartographische Imaginationen und auch Un-Räume konzeptualisiert werden. Deren präzise Definition ist häufig nicht möglich, jedoch kann sich diesen Zwischenräumen mit Hilfe von Raumkonzepten angenähert werden.3 Dabei hat sich in diesen neueren Forschungskonzepten der Raum von seiner territorialen respektive geographischen Konnotation weg bewegt zu anderen Perspektiven, die die Konstituierung von Raum durch Bewegung, Praktiken und Relationen untersuchen. In Folge dieser Sichtweise, die den Raum als „ein Geflecht von beweglichen Elementen“4, die sich in ihm entfalten, definiert, ist die Bewegung zwischen den Räumen und Orten in den Fokus geraten.
Zwischenräume können aber auch als Übergang, Schwelle oder im topologischen Sinne als Grenze, limites, frontiers und Nicht-Orte konzeptualisiert werden und damit deutlich machen, dass es mindestens zwei „andere“ Räume gibt. Zwischenräume folgen eigenen Logiken und Dynamiken. Sie weisen häufig stärker heterotope Strukturen im Sinne Michel Foucaults auf.5 Mit „Heterotopien“ meint Foucault „…gleichsam Orte, die außerhalb aller Orte liegen, obwohl sie sich durchaus lokalisieren lassen“.6 Obwohl sich beispielsweise Grenzen lokalisieren lassen, ist ihr Raum sehr viel heterogener und umfasst mehr nur als die zwei oder auch mehreren Räume, die sie umgeben. Diese so entstehenden anderen Räume, jenseits und über die Grenzen hinaus, können ihren Konstruktionscharakter nicht von sich weisen, ist doch die Grenze in der Regel nicht sichtbar, wohl aber in ihren u. a. rechtlichen Auswirkungen auf die Menschen wirkmächtig. Der Zwischenraum ist daher nicht nur heterogen, in Abgrenzung zum geschlossenen Anderen, sondern auch absichtlich hybrid und offen. Ob aber ein Raum ein Zwischenraum im Sinne der Heterotopie oder ein absichtsvoll widerständiger third space ist, kommt auf seine Beschaffenheit an.
Wenn hier von Strukturen die Rede ist, dann meinen sie das, was Aufbau, Zugang, Grenzen und Akteure räumlicher Phänomene ausmacht. Zwischenräumliche Strukturen können aber auch Handlungsspielräume eröffnen und das Trennende verbinden oder vermischen und neue Räume schaffen. Dies gilt auch und insbesondere für Begegnungen aller Art, wenn ein Zwischenraum entsteht, in dem kulturelle Differenzen und Machtasymmetrien thematisiert, aber auch gemeinsame Interessen ausgehandelt werden können.7
Dieses Konzept hybrider Räumlichkeit, das durch dichotome, binäre Denkstrukturen bestimmt ist, sie gleichzeitig jedoch zu überwinden versucht, eignet sich, um „Zwischenräume“ thematisierbar zu machen, insbesondere solche, die durch abweichendes Verhalten entstehen. Diese sich so manifestierenden devianten, also von dem, was als erlaubt normiert ist, abweichenden Räumen, zeigen sich durch die Akteur*innen, Möglichkeiten und Grenzen. Sie können Alternativen eröffnen, wo auf den ersten Blick keine erscheinen, und neuen Ordnungen einen Raum geben. Zwischenräumen begegnet man im materiellen, lokalisierbaren wie im nicht-materiellen, übertragenen Sinne, als Wissensraum mit Zulassungsbeschränkungen. Es lässt sich beobachten, dass durch abweichendes Verhalten deviante Räume geschaffen werden – auch hier wieder sowohl real verortbare und greifbare als auch metaphorische, nicht materiell greifbare Räume, eben Wissensräume. Als Beispiel für einen devianten Raum sei ein Netzwerk von Personen angeführt, das sich der von der Obrigkeit verbotenen und verfolgten Zauberei widmet und das Wissen darüber mündlich weitergibt, wie es etwa in Territorien praktiziert wurde, in welchen die Institution einer Inquisition existierte und das Leben der Menschen in unterschiedlich starkem Maße überwachte.
In dem Konzept des Zwischenraumes sind bereits Überlegungen zur zeitlichen Struktur angelegt wie beispielsweise bei Friedhöfen oder Mumien, die Zeit(spannen) überdauern und sie bis in die Ewigkeit verlängern sollen8 oder in Räumen, die darauf angelegt sind, Zeitstrukturen zu überwinden wie Museen, Bibliotheken und Archive. Räume werden aufgebrochen und neu wahrgenommen, wenn man auch ihre zeitlichen Aspekte berücksichtigt. Systematische Überlegungen zur „Zeit“ als eigene Analysekategorie erweitern das Zwischenraumkonzept. Die von dem Literaturwissenschaftler Michail Bachtin eingeführte Denkfigur der „RaumZeit“, des Chronotopos, ursprünglich dem epischen Ritterroman entlehnt, beschreibt den untrennbaren Zusammenhang von Zeit und Raum, deren Ganzheitlichkeit und Einheit, bei dem die Zeit zur vierten Dimension des Raumes wird. „RaumZeit“ schließt den zeitlichen Aspekt von Räumen explizit mit ein.9 Durch die Erweiterung des Chronotopos durch die Denkfigur des „anderen“, durch das Adjektiv „hetero“, werden hier erstmals neue Perspektiven auf aktuelle Forschungsfragen eröffnet, die so zur „anderen RaumZeit“, zum „Heterochronotopos“ als weiterer Analysekategorie werden können. Exemplarisch sei hier auf miteinander verschränkte Arten von Räumlichkeit (vertikal, horizontal, sich ausdehnend, etc.) und Zeitlichkeit (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Gleichzeitigkeit, etc.) verwiesen, so etwa auf geographischen Karten, im Umgang mit der Zeit in Leichenschauhäusern des 19. und 20. Jahrhunderts oder mit vermeintlichen Insellagen ganzer Gesellschaften in Romanen, die reale Zeiten abbilden, aber eben auch andere Narrationsmöglichkeiten eröffnen.
Bei der Erweiterung des Zwischenraumkonzeptes um heterochronotope Aspekte sollen jedoch auch die Körperlichkeit und Materialität von Zwischenräumen nicht außer Acht gelassen werden, die sich in Quellenstudien immer wieder andeuten. Nicht von ungefähr sind „Körper“, „Materialität“ und „Raum“ ebenfalls Schlagworte der kulturhistorischen Forschung, die seit dem spatial turn und dem material turn Impulse für neue Denkrichtungen und Fragestellungen gegeben haben. Hier haben sich beispielweise Fragen nach der Rolle von Körper und Materialität im „Nicht-Raum“, im Zwischenraum, aufgetan oder danach, wie etwas so Abstraktes wie ein heterotoper/heterochronotoper Zwischenraum Materialität bzw. einen Körper besitzen kann.
An Überlegungen von Theoretiker*innen wie Henri Lefebvre und Edward W. Soja anknüpfend, aber auch an die figurationssoziologischen Ansätze von Norbert Elias und Pierre Bordieu wird Raum hierbei als sozial konstruiert und durch Praktiken konstituiert und angeeignet verstanden. Die Kategorie Körper wird in der Feministischen Theorie und den Gender Studies ebenfalls als sozial konstruiert und normiert sowie performativ hervorgebracht begriffen. Bei dieser Konstruktion und Normierung von Körpern spielen die soziale Produktion von Raum, die Aneignung von oder Exklusion aus verschiedenen Räumen eine wichtige Rolle. Die Auseinandersetzung mit der Verschränkung und wechselseitigen Bedingtheit von Körper und Raum kann daher neue Perspektiven auf alte Fragestellungen eröffnen. So wurde nach Inklusions- oder Exklusionsmechanismen und den daraus potenziell resultierenden Konflikten ebenso gefragt wie nach möglichen Interdependenzen zwischen Körpern und weiteren Differenzkategorien wie Geschlecht, Religion, Materialität/Dinge. Die Beschäftigung mit dem Körper als (Verhandlungs‐)Raum sexueller Identität sowie als materiell verfasstes Artefakt oder Aktant räumlicher Praktiken stellt einen Schwerpunkt in diesem Band dar. Materialität soll im Folgenden verstanden werden „sowohl im Sinne von Materie und einer konkreten Stofflichkeit etwa von Stein, Holz, Eisen oder Leder […], als auch im Sinne eines Dachbegriffes wie dem der materiellen Kultur“.10
Der vorliegende Band spannt den Bogen von religiösen Zwischenräumen zu heterotopen Raum-Zeitlichkeiten als einer weiteren Spielart von Zwischenräumen bis hin zu zwischenräumlichen Materialitäten und Körperlichkeiten. Er zeichnet eine Entwicklung nach, die in den Erfurter Zwischenräume-Workshops der Jahre 2016 bis 2018 vollzogen wurde und die sich im Aufgreifen und Anwenden etablierter und der Entwicklung neuer Analysekategorien auszeichnet. Die Publikation möchte Zwischenräumen unterschiedlicher Art nachgehen, die sich im Religiösen, in RaumZeitlichkeit und in Materialität und Körperlichkeit zeigen.
Die Beiträge sind in verschiedene thematische Cluster gefasst, die jeweils die Perspektive der Aufsätze bezeichnen. Dabei werden die Spielarten der Zwischenraumkonzepte genutzt, um Geschichte zu schreiben, Geschichte zu visualisieren, sie zu revidieren oder sie wieder anderen Interpretationen zu öffnen. Dabei zeigt sich, dass Zwischenräume offenzulegen bedeutet, „mehr“ zu sehen und eine fruchtbare Anschlussfähigkeit an bereits erfolgte Forschungen herzustellen.
Im Cluster „Körper, Materialität und (Zwischen‐)Raum“ gehen Katja Weidner, Matthias Rekow und Nobert Finzsch der Frage nach, inwiefern durch die unterschiedlichen Raumkonzeptionen und den aus ihnen hergeleiteten Analysemethoden neue Perspektiven auf die historisch orientierten Kulturwissenschaften gewonnen werden können. Katja Weidner macht in ihrer Untersuchung der Erzählung der Sieben Schläfer von Ephesus deutlich, welchen Mehrgewinn eine raumzeitliche Analyseperspektive gegenüber den klassischen historiographischen Methoden haben kann. Durch die spezifische Kulturalität dieser Erzählung, die sich zeitlich in der Vergangenheit, Gegenwart (Erzählzeit) und Zukunft bewegt bzw. Körper durch diese bewegt, wählt sie das Konzept des Zwischenraumes, abgegrenzt gegenüber der foucaultschen Heterotopie und dem bachtinschen Chronotopos. Der Zwischenraum erfasst die Kulturalität und vereint die Betrachtungsmöglichkeiten dreier Zeitebenen. Ähnlich argumentiert Matthias Rekow in seiner Analyse von Bilderpolemiken zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges und der Restauration von katholischen Ordnungen über Flugblätter. Allerdings wählt er als Herangehensweise, Chronotopos und Heterotopien zu mischen, um die Restauration von Macht, Exklusion und Inklusion zu historisieren. Norbert Finzsch argumentiert in seinem Aufsatz, wie medizinische Diskurse der Neuzeit weibliche Körper in Zwischenräumen (hier als utopische Heterotopie verstanden) in die „Normalität“ einhegten. Einhegen bedeutet hier, eine Genitalverstümmelung an bestimmten Personen vorzunehmen, um so die vermeintliche Ordnung der Dinge wiederherzustellen. Finzsch macht dabei die Raumkonzeptualisierungen von Foucault, Heterotopie und Zwischenraum, fruchtbar, auch, um die genannte medizinische Körperpraktik im Zentrum Europas zu verorten und damit die zeitgenössische Narration der externalisierten und kolonisierenden Perspektive der Genitalverstümmelung zu dekolonisieren.
Das Kapitel „Zwischenräume, Religion und Geschlecht als topologische Faktoren“ widmet sich Manifestierungen von Religion und von Geschlecht in städtischen Räumen oder auch in Landschaften des Nahen Ostens und zeigt religiöse ebenso wie politische Akzentuierungen als strukturgebend auf. Anna-Katharina Rieger wendet Überlegungen zur RaumZeitlichkeit auf Sakralräume in der Palmyrene in römischer Zeit und ihr schriftliches und bildliches Fundmaterial an. In der antiken Magie sieht Meret Strothmann eine Kommunikationsform, die geeignet ist, für die jeweils „offizielle“ Religion Bezugspunkte herzustellen und als Zwischenraum...