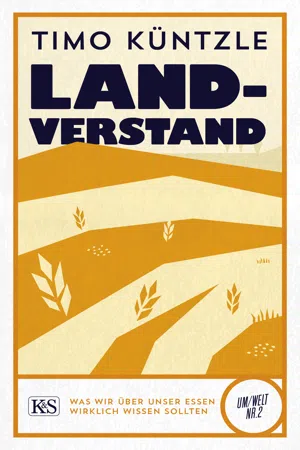![]()
1
DAS URPRINZIP DER „LAND-WIRTSCHAFT“ ODER: IM EINKLANG MIT DER NATUR VERHUNGERN WIR
![]()
Simpel betrachtet, umfasst die Landwirtschaft den Anbau von Kulturpflanzen und die Haltung von Nutztieren mit dem Ziel, landwirtschaftliche Rohstoffe wie Weizen, Kartoffeln oder Schweinefleisch zu „ernten“. Aber was bedeutet Landwirtschaft im tieferen Sinne?
Jeder, der über ein noch so winziges Stück Land verfügt, kann die Frage mithilfe eines kleinen Experiments selbst beantworten.
Angenommen, Sie haben einen Quadratmeter Boden, auf dem eine Wiese wächst. Ziel des Experiments ist es, dort Radieschen anzubauen, zu ernten und als frische Zutat eines selbst zubereiteten Frühlingssalats zu genießen. Wie kommen Sie diesem Ziel näher? Einfach Radieschen-Samen besorgen, auf die Wiese streuen und das Beste hoffen? Sie wissen intuitiv: Mit dieser Vorgehensweise wird das Experiment kläglich scheitern. Sie müssen das Stück Land mithilfe eines Spatens erst vorbereiten.
Was jetzt kommt, ist nichts Geringeres als die Fortführung einer viele tausende Jahre alten Tradition. Sie ist die Grundlage aller Zivilisationen, die jemals die Erde bevölkert haben. Sie sind jetzt im Begriff, Ackerbauer zu werden! Sie setzen also Ihren Spaten an und stemmen sich mit Ihrem ganzen Gewicht auf das Werkzeug, das nun hoffentlich einigermaßen senkrecht in den Boden gleitet. Anschließend heben Sie das Spatenblatt an, wenden es und lassen die Erdscholle mit dem Bewuchs nach unten dorthin zurückfallen, wo sie hergekommen ist. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gerade Landwirtschaft betrieben. Aber sind Sie sich bewusst, was Sie wirklich getan haben? Das Umgraben der Wiese bedeutet im Grunde nichts anderes, als der Natur die Herrschaft zu entreißen. Sie bestimmen, was wächst, und verwirklichen damit das Urprinzip der Landwirtschaft. Es bedeutet, das Land zu bewirtschaften. Und diese Bewirtschaftung vollzieht sich letztlich in einem andauernden Kampf gegen den „Willen“ der Natur. Das merken Sie auch im weiteren Verlauf Ihres Radieschen-Experiments. Rund eine Woche, nachdem Sie Ihr Stück Land umgegraben, die Erde eingeebnet und die Samenkörner in den Boden gelegt haben, strecken die Keimlinge allmählich ihre Köpfchen aus der Erde und beginnen sichtbar zu wachsen – vorausgesetzt, es ist nicht zu kalt, zu trocken oder Ähnliches.
Aber der Teufel schläft genauso wenig wie die Natur! Mit den Radieschen keimen auch neue Wildpflanzen. Die zahlreichen Vertreter dieser Kräuter, Gräser, Farne, Moose oder Gehölzarten werden traditionell als Unkraut bezeichnet, sobald sie unerwünscht auftauchen – obwohl diese Pflanzen nicht grundsätzlich schlecht sind und wichtige ökologische Funktionen als Futter, Behausung oder Brutstätte für Insekten und andere Tiere erfüllen. Die etwas differenzierter klingende Bezeichnung lautet daher Beikraut.
Schlussendlich ist die Bezeichnung egal. Für Radieschen sind andere Pflanzenarten ein Problem, weil sie ihnen Licht, Wasser, Nährstoffe und Platz rauben, zumal Wildpflanzen wesentlich durchsetzungsfähiger und robuster sind als Radieschen. Wildpflanzen sind von der Evolution auf eigenständiges Überleben und die Produktion von Nachkommen getrimmt. Radieschen wurden dagegen vom Menschen durch gezielte Züchtung so geformt, dass sie ihre Kraft in verdickte und wohlschmeckende Sprossknollen stecken. Ihre Robustheit haben sie dabei weitgehend eingebüßt, was sie gegenüber Wildpflanzen konkurrenzschwach macht. Ihr Überleben und ihre Gesundheit hängen von der Hilfe des Menschen ab.
Wenn Ihnen Ihre Salatzutat also am Herzen liegt, setzen Sie sich mit einer Hacke gegen die Natur zur Wehr oder zupfen das Unkraut direkt mit Ihren Händen. So helfen Sie Ihren Radieschen auf künstliche Weise zu gedeihen, wo sie von Natur aus chancenlos wären.
Allerdings ist das Problem mit den störenden Wildpflanzen ein längerfristiges. Samen können auf einem Quadratmeter zu Hunderttausenden und teils jahrzehntelang im Boden schlummern und werden ständig aus der Umgebung angeweht oder von Vögeln und anderen Tieren fallengelassen. Irgendetwas steht daher immer bereit zu wachsen.
Unkraut vergeht nicht, lautet ein altes Sprichwort. Schon immer mussten Ackerbauern mit der bitteren Erfahrung leben, dass die Unkrautbekämpfung stets nur kurzfristige Erfolge beschert. Daran hat auch die Erfindung von Glyphosat und anderen Unkrautvernichtern nichts geändert. Selbst wenn die Bodenoberfläche gerade vollständig befreit wurde, steht die nächste Unkraut-Generation schon in den Startlöchern. Wer sich nur zwei Wochen im Garten nicht blicken lässt, kann bei seiner Rückkehr eine böse Überraschung erleben: sprießendes Unkraut überall.
Es wird niemals dauerhaft verschwinden (wenn man von einzelnen, ganz bestimmten Arten einmal absieht). Seine Beseitigung verschafft Kulturpflanzen, in Ihrem Fall den Radieschen, für kurze Zeit gerade nur so viel Vorsprung gegenüber wild wuchernden Pflanzen, dass es Ihnen nach wenigen Wochen gelingen kann, eine Ernte einzufahren.
Mit der Anlage eines Radieschenbeets haben Sie also zwei Dinge getan, die regelmäßig heiß diskutiert werden: Sie haben Pflanzenschutz betrieben und damit einen aktiven Beitrag zur Verringerung der auf diesem Quadratmeter vorhandenen Artenvielfalt geleistet! Was den Pflanzenschutz angeht, muss man Sie loben: Das Mittel Ihrer Wahl war die ressourcenschonende Hand-Hacke. Im Fachjargon nennt sich der damit verbundene Vorgang mechanische Unkrautbekämpfung. Und die ist zumindest im Hausgarten, rein ökologisch betrachtet, der chemischen Unkrautbekämpfung vorzuziehen. Jedenfalls wenn sie muskelbetrieben funktioniert. Bezüglich der Ressource Rückengesundheit ist das Hacken von Hand bei größeren Feldern allerdings weniger schonend.
Beim Thema Artenvielfalt haben Sie schon mehr Schuld auf sich geladen. Falls Sie gewissenhaft gearbeitet haben, ist das Unkraut jetzt nämlich nicht weniger tot, als wenn Sie es mit einem Unkrautvernichtungsmittel (Herbizid) totgespritzt hätten. Sie haben all die kleinen Pflänzchen zerstückelt und vertrocknen lassen. Statt zu blühender Insektennahrung heranzuwachsen, zerfallen sie jetzt zu Humus. Sie mussten es tun, um Ihre Radieschenpflanzen vor Wildkräutern in Schutz zu nehmen. Sie haben Pflanzen-Schutz in Reinform betrieben, aber dadurch auch die Artenvielfalt auf Ihrem Quadratmeter drastisch schrumpfen lassen!
In dem zugrunde liegenden landwirtschaftlichen Urprinzip unterscheidet sich ein Urban Gardener in Wien nicht von einem Großfarmer in Argentinien, ein Biobauer nicht von einem konventionell wirtschaftenden Landwirt. Sie alle fördern Kulturpflanzen und drängen andere Arten zurück. Auch wenn es jeder mit unterschiedlichen Werkzeugen und ungleichen Wirkungsgraden verfolgt: Es bleibt dasselbe Prinzip.
DIE ERFINDUNG DER LANDWIRTSCHAFT
Die Idee des Ackerbaus und der Viehzucht hatten Menschen in mehreren Regionen der Erde unabhängig voneinander, zuerst im Nahen Osten vor rund 12.000 bis 14.000 Jahren.
Dabei muss ungefähr Folgendes passiert sein: Einige biologisch Interessierte begannen damit, von den dicksten Körnern wilder Gräser einige abzuzweigen. Sie verwerteten sie nicht direkt als Nahrung, wie bis dahin üblich, sondern um die Pflanzen kontrolliert zu vermehren.
Ließe sich herausfinden, wer genau diesen Schritt zu welchem Zeitpunkt erstmals vollzogen hat, man müsste diesem Menschen posthum eine Handvoll Nobelpreise verleihen, derart fundamental änderte sich dadurch das Schicksal der gesamten Menschheit. Fest steht nur: Irgendwann legte jemand zum allerersten Mal in der Geschichte ein Samenkorn ganz bewusst in den Boden. Vielleicht hatte sie oder er zuvor beobachtet, wie versehentlich verschüttete Körner hinter Nachbars Hütte auskeimten? Wie ich uns Menschen kenne, war die Grassäerei lange Zeit als Hobby für Spinner verschrien. Wozu Samen in den Boden legen, wenn die Natur ohnehin genug wachsen lässt?
Aber die Idee wurde nach und nach von immer mehr Menschen kopiert. Es stellte sich nämlich heraus, dass eine eigene kleine Ernte nicht schlecht war, wenn in der Natur phasenweise weniger Nahrung zu finden war. Klimatische Schwankungen führten dazu, dass der Eigenanbau weiter intensiviert wurde. Zwar bescherte er mehr Arbeit, aber es konnten auch mehr Menschen von derselben Fläche ernährt werden. So begaben sich die Menschen nach und nach in eine immer größer werdende Abhängigkeit von der „Spinnerei“ mit den Graskörnern. Die großen Körner wurden noch akribischer ausgewählt und ausgesät. Diese jungsteinzeitliche Form der „Genmanipulation“ durch Auslese brachte mit der Zeit die Vorläufer unserer heutigen Getreidearten hervor: Einkorn und Emmer als erste Weizenformen, außerdem Gerste, Erbsen, Linsen und Lein.
Wohl aus alter Gewohnheit, besser gesagt, solange sie verfügbar waren, jagten die ersten Ackerbauern zunächst weiter wilde Tiere, vor allem Gazellen. Als deren Populationen im Umfeld der frühen Siedlungen aber allmählich zusammenbrachen, begann auch die Domestikation, oder salopp: die „Verhäuslichung“ der ersten Tiere. Aus Bezoarziege, Wildschaf, Wildschwein und Auerochse wurden innerhalb langer Zeitspannen Haustiere. Die Idee von Sesshaftwerdung und Landwirtschaft erwies sich auf Dauer als unschlagbar.
Die aus dem Gebiet des sogenannten Fruchtbaren Halbmonds, der sich in einem Bogen ungefähr vom heutigen Israel bis in das Gebiet zwischen Euphrat und Tigris erstreckt, importierte bäuerliche Lebensweise samt ihrer Eigenheit, sich von bestimmten Pflanzen und Tieren zu ernähren, verbreitete sich über ganz Europa, wo sie die bis dato lebenden Jäger-und-Sammler-Gesellschaften nach und nach verdrängte. Dies führte langfristig zu einer wachsenden Bevölkerung mit einem stetig zunehmenden, wenn auch schwankenden, Bedarf an Nahrungsmitteln, Heiz- und Baumaterial, Platz für Äcker, Weiden, Gebäude, Straßen und vieles mehr. Im Laufe der Jahrtausende gestalteten die Menschen die Landschaften Europas so zu Kultur-Landschaften um und änderten deren Aussehen radikal.
Aber wie hatten diese Landschaften bis dahin ausgesehen? Waren sie völlig naturbelassen? Was ist eigentlich Natur ? Mit der Beantwortung dieser Frage lassen sich wahrscheinlich ganze Bücherregale füllen. Dabei ergeben sich spannende Detailfragen, wie: Ist der Mensch Teil der Natur? Und falls ja, wäre dann nicht auch alles von Menschen Hervorgebrachte natürlich ? Ich definiere Natur grob vereinfachend als einen Zustand, wie er ohne direkte Einwirkung des Menschen, „von Natur aus“ entsteht.
Allerdings dürfte der Mensch seine Umwelt schon sehr viel länger einschneidend verändern, als man glauben möchte. Es gibt wissenschaftliche Hinweise1 darauf, dass auch schon die Jäger und Sammler am Höhepunkt der jüngsten Kaltzeit vor rund 20.000 Jahren Teile der ohnehin spärlich wachsenden Wälder niedergebrannt haben, um die Jagd und das Sammeln zu erleichtern.
Ein Blick auf eine Karte mit der potenziellen natürlichen Vegetation Europas im dann wärmeren Klima nach der jüngsten Kaltzeit vor grob 10.000 Jahren zeigt: Ohne wesentliche Eingriffe des Menschen war der überwiegende Teil Europas mit Laubmischwald bedeckt. Dort, wo die zahlreicher werdenden Menschen neue Behausungen errichten, Getreide anbauen und Vieh halten wollten, musste dieser Wald erstmal weg. Die Rodung von Wäldern war ein zentrales Element der Entwicklung Mitteleuropas. Nicht nur um Platz zu schaffen, sondern auch weil Holz als Brenn- und Baumaterial, etwa bei der Salzgewinnung und im Bergbau, massenhaft gebraucht wurde. Das gilt ganz besonders für eine langanhaltende Ausbau- und Blütezeit im Hochmittelalter, also für das 12. und 13. Jahrhundert.
In anderen Phasen der Geschichte schrumpfte die Bevölkerung, etwa während der großen Pestepidemie zwischen 1346 und 1353. Zu jener Zeit starben innerhalb weniger Jahre geschätzte 25 Millionen Menschen und damit ein Drittel der europäischen Bevölkerung. Tausende in den Jahrhunderten zuvor gegründete Dörfer und Siedlungen verfielen wieder, sodass sich die ehemaligen Äcker und Weiden innerhalb weniger Jahre erneut in Wald verwandelten. Ähnlich wirkte sich auch der Dreißigjährige Krieg (1618 – 1648) aus, im Zuge dessen manche Landstriche mehr als die Hälfte ihrer Bewohner verloren.
Die Spuren solcher sogenannter Wüstungen sind heut...