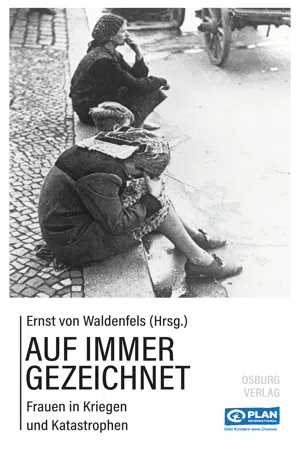![]() II. Der Kalte Krieg
II. Der Kalte Krieg![]()
Korea
Der Koreakrieg dauerte von 1950–1953 und war der erste Großkonflikt des Kalten Krieges. Auf der einen Seite stand das von China und der Sowjetunion unterstützte kommunistische Nordkorea und auf der anderen Seite eine von den USA und dem Westen gestützte Militärdiktatur. Durch Massaker beider Seiten an der Zivilbevölkerung, durch Bombardements und Kriegshandlungen starben ca. 4 Millionen Koreaner, d. h. 10 Prozent der Bevölkerung.
Hier folgen Ausschnitte über Kriegerwitwen in Südkorea aus dem Buch »Frauen erstanden aus dem Krieg« von Im-ha Lee.
»Die noch nicht gestorbene Ehefrau«
Im-ha Lee
Gewöhnlich nennt man in Korea Frauen, die ihre Männer verloren haben, »Koabu« oder »Mimangin«. Der erste Ausdruck bedeutet »alleinerziehende Mutter«, der zweite »noch nicht gestorbene Frau, die mit ihrem Mann hätte eigentlich sterben müssen«. Diese beiden Bezeichnungen zeigen in aller Deutlichkeit, dass die Frau als soziales Wesen nicht durch sich selbst, sondern durch die Beziehung zu einem anderen, nämlich als Mutter und Ehefrau definiert wird. Die Bezeichnung »Mimangin« insbesondere definiert die lebende Frau durch den verstorbenen Mann, was sowohl eine moralische – eine Frau, die ihre ethische Pflicht, dem Mann in den Tod zu folgen, nicht erfüllt hat – als auch eine existenzielle Komponente beinhaltet, dass nämlich die Frau nicht als ein selbstständiges Individuum anerkannt, vom Mann beschützt und durch ihn definiert wird. – Auch die Bezeichnung Kriegerwitwe, auf koreanisch »Jeonjaeng-Mimangin«, wurde mit dieser Konnotation verwendet.
Dass die Witwen zu einem schwerwiegenden Gesellschaftsproblem wurden, liegt daran, dass die meisten von ihnen in äußerster Armut lebten und keine Möglichkeit besaßen, weder besondere Fertigkeiten noch Fachwissen oder Berufserfahrung, um aus dieser Lage herauszukommen.
Nach der Statistik des Ministeriums für Gesundheit und Soziales von 1957 waren 252 356 Witwen, das sind 49,9 Prozent der Gesamtzahl, ohne feste Arbeit. Wenn sie Arbeit hatten, waren sie trotzdem auf Sozialhilfe angewiesen, da sie nicht in der Lage waren, mit den Einkünften sich selbst und die Familie zu unterhalten. Das Problem des dürftigen Lebensunterhalts betraf nicht nur die Witwen, sondern auch die Familien, die sie zu versorgen hatten, insbesondere die Kinder. 1955 mussten 461 307 Witwen für den Unterhalt von insgesamt 1 353 294 Kindern und 37 924 Eltern aufkommen. Der Anteil jener Witwen, die mehr als 2 Kinder zu versorgen hatten, betrug 72,7 Prozent; durchschnittlich waren sie unterhaltspflichtig für mehr als 3 Kinder.
Am leichtesten konnte man im Korea der 50er-Jahre als Dienstmädchen Arbeit finden: »Nicht nur die Reichen, sondern auch Haushalte, die in Einzimmerwohnungen und Baracken wohnten, wetteiferten darin, Dienstmädchen einzustellen.«
Zu den wohlhabenden Haushalten in Seoul oder auch in anderen Städten gehörten ein oder zwei Dienstmädchen.
Seoul zählt zurzeit 1,5 Millionen Einwohner, das heißt, es gibt 300 000 fünfköpfige Haushalte. Geht man von drei Dienstmädchen in zehn Haushalten aus, dann kommt man bereits auf 90 000. Die Zahl würde in die Höhe schnellen, zählte man diejenigen in den Restaurants, Gasthäusern und Cafés noch dazu.1
Mittellose Witwen auf dem Lande ließen häufig ihre kleinen Kinder als Küchenhilfen bei den reichen Familien im Dorf arbeiten und zogen dann in die Stadt, um dort eine Arbeit zu finden.
Welche Haustür sich auch vor einem öffnet, man wird von einem kleinen Mädchen begrüßt, das ein Kind auf dem Rücken trägt, oder von einer Frau mittleren Alters, die eine Schürze umgebunden hat. Die über Zwanzigjährigen sind verheiratet, während die unter zwanzig fast alle noch ledig sind.2
Angesichts der Schwerstarbeit, die zu leisten war, blieben nur sehr wenige Dienstmädchen länger als fünf oder sechs Monate bei einer Familie, die meisten kündigten schon nach zwei oder drei Monaten. Ihre Arbeit von 5 Uhr morgens bis Mitternacht wurde mit 1000 bis 6000 Hoan entlohnt, und einige Kriegswaisen bekamen sogar keinen einzigen Pfennig.
Doch mehr als der Niedriglohn und die lange Arbeitszeit machten körperliche Gewalt, Beschuldigungen wegen angeblichen Diebstahls, sexuelle Belästigungen bis hin zu Vergewaltigungen das Leben der Dienstmädchen schwer.
Wie unzählige andere Kinder verlor auch ich im Koreakrieg meine Eltern, bekam das Leid zu spüren und versank in Einsamkeit. […] Als ich mich am nächsten Tag von ihnen verabschiedete und zur Haustür ging, sagten sie, »Mach’s gut, doch zuvor möchten wir deine Sachen sehen«, was sie auch taten. Ich war sprachlos. Sogar meine Tränen waren versiegt. Ich fand es unmöglich, dass sie mir nicht nur den Monatslohn von 4000 Hoan vorenthielten, sondern auch meine Sachen durchsuchten. Ich erhielt nur 2000 Hoan und dafür sollte ich sogar dankbar sein, meinten sie. »Wer würde dich sonst schon aufnehmen und dir sogar Geld geben?« Ich wusste nicht, wohin ich mich damit wenden sollte.3
Alle Dienstmädchen mussten beim Auszug ihre Sachen den Hausherren vorzeigen. Der Vorwurf des Diebstahls führte in Einzelfällen dazu, dass diese Mädchen sogar eingesperrt und gefoltert wurden, ab und an kam es sogar zum Selbstmord der Betroffenen.
In Dongllae (Busan) wurde ein Dienstmädchen des Diebstahls beschuldigt und 20 Stunden lang unrechtmäßig eingesperrt und brutal geschlagen. Gi-Hwa Kim (26) wurde von Yong-Po Hong (42), dem Hausherrn, über den Verbleib der 50 000 Hoan rüde befragt. Am 11. Juli ließ er sie abends gegen 20.30 Uhr von einem gewissen Lee, der sich als Kommissar ausgab, in einem nahe gelegenen Haus einsperren und mit einer Eisenstange und einem Riemen foltern. Die ganze Prozedur dauerte volle 12 Stunden bis 8 Uhr morgens. Dabei wurden dem Mädchen die Kleider vom Leib gerissen und sogar der Kopf kahl geschoren. Der Hausherr wartete, bis die Frau wieder zu sich kam, und brachte sie dann mit seinem Schwager zu seinem Haus zurück. Bis 18 Uhr hinterließen sie mit einer Schaufel und einem Riemen unzählige Wunden an ihrem ganzen Körper, bis die junge Frau schließlich das Bewusstsein verlor […].4
Da es für die Dienstmädchen keine solidarischen Hilfsorganisationen gab, und sie wegen der Art ihrer Arbeit auf sich allein gestellt waren, waren sie mehr als andere weibliche Erwerbstätige der Selbstjustiz ausgesetzt. Gewalt und Diskriminierung, die diese Mädchen und Frauen am eigenen Leib erfahren mussten, spiegeln eigentlich nichts anderes als die Gewalttätigkeit und den rückständigen Geist der Gesellschaft wider. Fälle von sexuellem Missbrauch sind zwar wenig bekannt, doch für die betroffenen Frauen war es eine traumatische Erfahrung, welche zuweilen mit Selbstmord oder Mord der Kinder des Täters endete. Im folgenden Fall geht es um eine junge Frau, die vergewaltigt und gekündigt wurde. Aus Rachegefühl lockte sie die drei Kinder des Täters aus dem Haus und ließ sie im Stausee ertrinken.
Bei der Vernehmung gestand die Angeklagte, Sun-Dol Lee (18), ihre Tat. Sie sagte: »Ich wollte mich auf Leben und Tod rächen. Der Mann meiner Cousine versprach mir, alles für meine Hautkrankheit zu tun. Doch anstatt mir Medikamente zu besorgen, hat er sich, während meine Cousine nicht zu Hause war, dreimal an mir vergangen und mich danach vor die Tür gesetzt. Am 25. Juni lockte er mich nach Daegu mit den Worten, er wolle mich doch untersuchen lassen. Ich landete jedoch nicht in einem Krankenhaus, sondern in irgendeinem Stundenhotel vor dem Bahnhof. Er hatte einen getrunken, und ich musste ihn an jenem Tag dreimal ranlassen. In den frühen Morgenstunden sagte er zu mir, dass mein Hautleiden unheilbar sei und ich gehen solle. Ich wollte mich um jeden Preis an ihm rächen und da ich mich nun bei seiner Familie revanchiert habe, habe ich keinen Wunsch mehr.«5
Die koreanischen Kriegerwitwen hatten keine Zeit, über den Verlust ihrer Männer zu trauern. Niemand wusste um die Lage der Frauen besser als sie selbst; im Wissen, dass das wirtschaftliche und gesellschaftliche Sicherheitsnetz nicht mehr existierte, stürzten sie sich in die Arbeit, um sich selbst und die Familie zu ernähren. Überall auf der Welt wirkte sich der Krieg entscheidend auf die wirtschaftliche Tätigkeit der Frauen aus, und Korea bildete dabei keine Ausnahme. Es herrschte eine rege Erwerbstätigkeit der Frauen insbesondere im Einzelhandel.
Diese Frauen, darunter auch Kriegerwitwen, hatten längst die Rolle als Gehilfin des Mannes abgelegt. Doch trotz dieser Entwicklung wurden Frauen immer noch als »schwach und schutzbedürftig« angesehen: »Sie haben sich bisher in dieser männerorientierten Gesellschaft nur um die Familie und die Erziehung der Kinder gekümmert […] Ohne zu wissen, welch harte Arbeit hinter dem Geld steckt, das der Mann nach Hause bringt, waren sie es gewohnt nur auszugeben. […] Sie waren schockiert und verzweifelt, als der Familienvater und Träger des Lebensunterhalts plötzlich verschwand.« »Würde man zunächst versuchen, die Witwen menschlich zu verstehen und ihnen näherzukommen, anstatt sie als eine Frau zu betrachten, […] so würden bestimmt weniger Frauen in den Sittenverfall hineingerissen werden. Man sollte sie als eigene Schwester betrachten und nicht als eine Frau und ihnen von Mensch zu Mensch helfen.« Diese Sätze, die in Zusammenhang mit den Kriegerwitwen geäußert wurden, spiegeln den Diskurs wider, der die Frau, deren Existenz vom Mann abhängt, als hilflos und schutzbedürftig betrachtet.
Die Witwe wurde, obwohl der Ehemann nicht mehr da war, »Frau des verstorbenen Mannes« genannt, was ihr Verhalten immer noch unter die männliche Autorität stellte. Nichtstuerinnen waren sie schon lange nicht mehr, da sie die Familie mit ihrer Hände Arbeit ernährten; doch das hinderte die Gesellschaft nicht daran, diese Frauen in Bezug auf den verstorbenen Mann oder die Kinder zu definieren. Dieser Diskurs spiegelt sich auch in Zeitungsberichten wider, in denen Frauen, die bei einer Veranstaltung zwecks moralischer Unterstützung der Witwen ausgezeichnet wurden, als »beispielhafte Frau« oder »pietätvolle Schwiegertochter« gerühmt wurden.
Die Gefahr des sittlichen Verfalls lauert überall auf sie, und zahllose Kriegerwitwen sind bereits daran gescheitert. Doch ihre Treue und Tugend wachsen mit jedem Tag. Anstelle ihres Ehemanns, den sie im Krieg verlor, verkauft sie selbst die zu Gelee verarbeiteten Mungobohnen und ernährt damit ihre Schwiegermutter (54) und Schwägerin (13). Zu Hause in der beklemmend engen Küche mahlt und siebt sie die 18 Liter Mungobohnen, die sie für 1700 Hoan eingekauft hat, und gewinnt daraus 30 Stück Gelee. Für sie bleiben täglich ganze 200 Hoan übrig, das einzige Mittel, mit dem sie ihre Achtung vor ihrer Schwiegermutter und Schwägerin bezeugen kann. Sie wird von den Dorfbewohnern einstimmig gelobt. Doch ihnen muss diese Witwe mit ihrer genauso tadellosen Erscheinung wie vor 6 Jahren bei der Hochzeit schon leidgetan haben, hatten sie doch bereits versucht, sie zu einer neuen Ehe zu überreden. Sanft und entschieden zugleich lehnte sie es jedoch ab und schwor, bis zum Tod dem Hause ihres Mannes treu zu bleiben. »Es war April, ein Jahr nach dem Ausbruch des Krieges. Ich weiß noch bis auf den Tag genau. Am 21. April, in der Morgenstunde bekam ich die Nachricht, dass mein Mann, Obergefreiter in der 1. Division, vermisst wurde. Aber ich war fest davon überzeugt, dass mein Mann nicht gefallen war und zurückkehren wird. An dem Tag wird wahrscheinlich auch unser Land die Wiedervereinigung feiern.« Voller Sehnsucht nach ihrem vermissten Mann sagt sie laut und deutlich: »Ich werde auf ihn warten.«6
Fast stoisch trägt sie die schwere Verantwortung einer Hausfrau und kümmert sich um die Schwiegereltern, drei Töchter und Schwägerin. Sie hatte beschlossen, den verzweifelten Schwiegereltern beizustehen und anstelle des Mannes den Haushalt wieder auf Vordermann zu bringen. Für die Schwiegereltern, die im hohen Alter ihren Sohn verloren haben, ist jetzt die Schwiegertochter ihre einzige Hoffnung, zumal die Frau des Bruders ihres Mannes, die mit ihr das gleiche Schicksal teilte, zu ihren Eltern zurückgekehrt ist. Blitzschnell erfasste sie die Lage und stärkte ihren Willen, aus Liebe zu ihrem Mann die Schwiegereltern zu ehren. Einzig dieser Wille wird Weihrauch sein für die Seligkeit des Verstorbenen. Ihr Gesicht strahlt Reife und Ruhe aus – typisch für koreanische Hausfrauen –, und mit Anstand und Fassung führt sie einen vorbildlichen Haushalt einer hinterbliebenen Familie.7
Im Zentrum dieser Berichte stehen nicht Witwen, die als Familienoberhaupt mit den Widrigkeiten des Lebens zu kämpfen hatten. Nein, hier sollen Kriegerwitwen vorgestellt werden, welche für die Seele der »Verstorbenen« beteten, an traditionellen Werten wie »beispielhafter Frau«, »Treue« und »pietätvoller Schwiegertochter« festhielten und mit ihren Taten dieser Tradition alle Ehre machten. Die Witwen wurden von der Gesellschaft nur akzeptiert, insofern sie die Schwiegereltern achteten, die Pflicht einer Ehefrau, Mutter und Schwiegertochter zugleich erfüllten und sich verhielten, als wäre der Ehemann immer noch bei ihnen. Die Tatsache, dass viele Kriegerwitwen, obwohl sie sexuell nicht gebunden waren, aus Angst vor neugierigen Blicken und Verachtung heimlich abtreiben ließen und dabei umkamen, ist darauf zurückzuführen, dass die Gesellschaft diese Frauen nur als »Ehefrau des Verstorbenen« definierte.
Ohne Ehemänner standen nun die Witwen ohne jede Absicherung vor gesellschaftlichen Problemen. Eine Kriegerwitwe, die zwei Kinder großzog, meinte, nicht das finanzielle Problem habe ihr in den letzten neun Jahren nach dem Tod ihres Mannes am meisten zu schaffen gemacht, sondern die Schulbildung und Heirat der Kinder sowie Behördengänge.
Die Gesellschaft nimmt uns, die ohne Ehemänner dastehen, nicht ernst. Das heißt, wir werden nicht als vollwertige Person behandelt. Bei der Immatrikulation an der Universität waren meine Kinder gezwungen, falsche Angaben zu machen aus Furcht, das Vorurteil gegen Kinder einkommensschwacher Witwen könnte ihnen den Weg zur Universität versperren. Und als meine Tochter heiraten wollte, wurden ihr mehrmals Absagen erteilt, allein aus dem Grund, weil sie keinen Vater hatte. Bei den Behörden haben sie mich auch stehen lassen, weil ich einen Rock trug. Und wenn sie bei der Sachbearbeitung einen männlichen A...