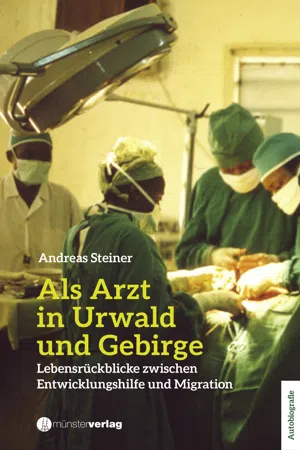![]()
1. Einführung
Heute beobachten wir eine zusehends grösser werdende Fluchtbewegung in die europäischen Länder. Die Flüchtlinge stammen aus Weltgegenden, die wir, ohne viel zu nachzudenken, als ‹unterentwickelt› bezeichnen. Die Bewegung hat das Ausmass einer Völkerwanderung angenommen, wie wir sie aus der Geschichte des späten Altertums und frühen Mittelalters kennen. Haben sich anfänglich unsere Regierungen und Verwaltungen verpflichtet gefühlt, die verarmten und halb verhungerten Menschen wohlwollend aufzunehmen, wird die immer grösser werdende Zahl der Flüchtlinge zusehends zu einem räumlichen, zwischenmenschlichen und logistischen Problem. Unsere christlich motivierte Hilfsbereitschaft fühlt sich überfordert, im Volk regt sich Widerstand. Parteien der extremen Rechten, die unsere Grenzen schliessen und die Übertritte von mittellosen Menschen mit Gewalt verhindern möchten, bekommen Zulauf.
Grundsätzlich müssen wir zwischen zwei Gruppen von Flüchtlingen unterscheiden: Es sind einerseits Menschen, die vor einem Krieg flüchten, der das Weiterleben in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt unmöglich macht. Anderseits sind es Menschen, deren Lebensbedingungen auch ohne Krieg derart schwierig geworden sind, dass sie sich kaum mehr ernähren und eine sichere Unterkunft finden, geschweige denn eine höhere Bildung erreichen können. Dazu gehören intelligente Leute, die trotz Veranlagung, Wille und Fleiss keine Möglichkeit sehen, sich selbst und ihre Familie sozial abzusichern.
Jedes Übel muss an der Wurzel angegangen werden. Wenn wir in Europa verhindern wollen, dass unsere Länder von immer grösseren Zahlen von Flüchtlingen überschwemmt werden, muss unsere Hilfe vorerst lebensrettend mit Ernährung, Kleidung, Behausung einsetzen. Katastrophenhilfe ist eine Frage von Organisation und Finanzen, für die in der UNO und in den einzelnen Ländern gut ausgebildete Leute bereitstehen und auch Material vorhanden ist. Darüber gibt es Publikationen, Anleitungen, Verordnungen, Materiallisten, auf die ich hier nicht eingehen will.
Bei Kriegen können wir ausser der Überlebenshilfe nur Eines tun: darauf einwirken, dass der Kriegszustand so schnell wie möglich beendet wird. Das ist leichter gesagt als getan. Aber leider ist es so, dass Länder aus Westeuropa und Nordamerika immer in irgendeiner Weise in kriegerische Zustände, die auf der Welt stattfinden und Tausende von Menschen in Elend und Flucht treiben, verwickelt sind. Entweder sind die Länder aktiv am Krieg beteiligt wie der Krieg gegen Gaddafi oder der Luftkrieg Saudi-Arabiens gegen den Jemen, oder sie selbst haben den Krieg wie den Feldzug gegen Saddam Hussein initiiert, der später zu Gruppierungen wie dem Islamischen Staat (IS) führt und in einen Folgekrieg ausartet. Nicht selten sind unsere Wirtschaft und Industrie als Profiteure an einem Krieg beteiligt wie im Krieg Ruandas und Ugandas gegen den Kongo von 1998 bis 2002, in dem sechs Millionen Menschen ermordet wurden. Bei solchen Kriegen, aus denen Millionen von Flüchtlingen resultieren, könnten wir über die Medien darauf hinwirken, dass sich unsere Regierungen und unsere Industrie aus jeder Beteiligung heraushalten. Aber meistens tun wir nichts und lassen es zu, dass bei uns Unternehmen am Krieg beteiligt sind und Gewinne erzielen. Wir dürfen nicht erstaunt sein, wenn unter diesen Umständen Menschen aus ihren zerstörten Häusern in unsere Länder flüchten. Wir werden so lange Kriegsflüchtlinge aufnehmen müssen, als es bei uns Konzerne und Personen gibt, die von den Kriegen profitieren und unsere Regierungen sich duckmäuserisch von jeder Kritik und jedem Druck auf die Kriegsverursacher zurückhalten.
Ausser Flüchtlingen, die vor Tod und Zerstörung durch kriegerische Handlungen davonrennen, hat es seit je Leute gegeben, die ihre Heimat verlassen, weil es dort keine Weiterbildung, kein zuverlässiges Gewerbe, keine beruflichen und sozialen Aufstiegsmöglichkeiten, kein ruhiges und sicheres Leben für sie selbst und ihre Familien gibt. Diese Art von Flüchtenden wird es immer geben, solange sich die Zustände in ihren Heimatländern nicht ändern, Schulen und Weiterbildungsmöglichkeiten rudimentär bleiben und korrupte und gefrässige Politiker1 das Sagen haben.
Hier hätten wir die Möglichkeit, einzugreifen und auf eine Veränderung der Zustände in den Heimatländern der Flüchtlinge hinzuwirken, um die Beweggründe zur Flucht auszuschalten oder mindestens abzuschwächen. Wenn wir mithülfen, die Zustände, vor denen die Leute fliehen, zu verbessern, wäre es uns auch erlaubt, Flüchtlinge, die bei uns ankommen, in ihr Land zurückzuschicken!
Heute herrscht bei uns die Ansicht, jahrelange Entwicklungshilfe habe die Zustände in den sogenannten Drittweltländern zum Besseren verändert und es sollte eigentlich möglich sein, dass Menschen aus Drittweltländern ihr Land nicht mehr verlassen und mit Forderungen zu uns flüchten. Leider ist dem nicht so, weil das, was wir als ‹Entwicklungshilfe› bezeichnen, versagt hat. Auch herrschen bei uns noch immer falsche Vorstellungen über das, was ‹Entwicklung› in ihrer Eigentlichkeit ist und wie Hilfe zur ‹Entwicklung› richtig durchgeführt werden sollte.
‹Entwicklung› im eigentlichen Sinn bedeutet, dass, was im Kleinen angelegt ist, in Erscheinung tritt und sich ausbreitet. Von aussen kann jemand dabei nur behilflich sein, wenn er Hindernisse wegräumt oder Einflüsse fördert, die das Hervortreten des als Anlage Vorhandenen erleichtern. Wo es sich um echte Entwicklung handelt, kann das Eigentliche und die Richtung des sich zu Entwickelnden von aussen weder bestimmt noch beeinflusst werden2.
Nach meiner eigenen Erfahrung kann Zusammenarbeit nur dann die Entwicklung fördern, wenn beide Partien, das heisst sowohl die Menschen in Afrika, Südamerika oder Asien als auch wir Fremde, die wir zur Förderung der Entwicklung hergereist sind, bereit sind, sich gemeinsam und gegenseitig zu entwickeln. Echte Entwicklungszusammenarbeit ist ein Austauschprozess. Dies habe ich während meiner Tätigkeit als Arzt in medizinischen Entwicklungsprojekten erfahren. Ich merkte, wie ich mich selbst verändern musste, um in Afrika und in Südamerika Leute ausbilden zu können. Je länger ich arbeitete, desto besser gelang es mir, mich den Afrikanern oder den Indios gegenüber zu öffnen, bis ich fähig wurde, von ihnen anzunehmen, was auch sie zu meiner Entwicklung beitragen wollten und konnten. Meine Tätigkeit war dann nicht mehr Hilfe, die Fremdes aufoktroyierte, sondern ein Zusammengehen, bei dem Entwicklung in beiden Richtungen – das heisst auch bei mir – eintrat.
Ich werde im Folgenden anhand meiner Tätigkeit als Arzt in Afrika und Südamerika darstellen, was für mich Entwicklung bedeutet. Was ich erlebt habe, erzähle ich in Form von wahren Berichten und einigen Geschichten, die ich erlebt oder gehört habe, ohne dabei zu verschweigen, dass es mir in erster Linie immer um die medizinische Versorgung der mir anvertrauten ländlichen Bevölkerung ging. Ich werde darstellen, wie ich das Notwendige fördern konnte und mich gleichzeitig die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung mit Genugtuung erfüllte, wie sich bei mir Zuneigung zu den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, entwickelte und wie ich merkte, wie auch die Leute sich mir gegenüber öffneten. Eine Beziehung gegenseitiger Achtsamkeit ist wichtig für die Entwicklungszusammenarbeit. Bei mir hat sich während meines Wirkens wohlwollendes Empfinden für die Menschen, für die Arbeit und für das Abenteuer, das ich eingegangen bin, entwickelt. So war es mir möglich, etwas in den Menschen hervorzuholen und zum Ausdruck zu bringen, das bei ihnen andauern wird.
Auf Grund meiner Ausbildung, meiner Erfahrung, meines Alters war ich der Hauptverantwortliche für die Organisation, für die Behandlung der Kranken und für die Ausbildung meiner Mitarbeiter. Als Mensch lernte ich immer mehr, mich auf die gleiche menschliche Stufe zu stellen wie alle, mit denen ich zu tun hatte. So wurde es möglich, dass wir uns gegenseitig beeinflussen und entwickeln konnten.
![]()
2. Frühe Neigung
Seit meinem Kindesalter – ich kam am 29. Januar 1937 zur Welt – hat sich bei mir eine Zuneigung zu Menschen, die ursprünglich leben, und zu Landschaften, die unberührt sind, bemerkbar gemacht. Als Knabe konnte ich mir nichts Abenteuerlicheres vorstellen, als in eine von Gefahren und Geheimnissen durchwobene Welt einzudringen, wie es in meiner Phantasie der Urwald sein musste. Diesen kannte ich nur aus Beschreibungen, ich glaubte jedoch im Zolliker Wald, der damals noch wild und unerschlossen war, Ersatz dafür gefunden zu haben. Ich liebte es, abseits der Wege zu pirschen und mich, von meiner Phantasie angetrieben, durch Dickichte vorwärts zu kämpfen.
Ich war zwölf Jahre alt, als ich an der Hand meines Vaters spazierte und er mir die Frage stellte: «Hast du dir schon überlegt, was du später werden willst?» – «Ja», antwortete ich ohne zu zögern, «ich will Urwaldforscher werden!» – Mein Vater schwieg, dann sagte er: «Na gut! Beende deine Schulen, dann wollen wir wieder darüber reden.»
Die Antwort, die ich damals dem Vater gab, war ehrlich, und ich war ihm dankbar, dass er den ‹Urwaldforscher› nicht als Hirngespinst zurückwies. Während Jahren redete ich nicht mehr über meine Neigung, doch für mich selbst blieb ich entschlossen, den Urwald und dessen Bewohner auszukundschaften. Langsam erkannte ich, wie sich bei allen Menschen das für sie Massgebliche in der Kindheit bemerkbar macht und sie auf Ideen bringt, die für ihr Leben Bedeutung haben. Ich tat unterdessen, was meine Eltern von mir erwarteten: nach der Primarschule besuchte ich das Gymnasium in Zürich.
Während der höheren Klassen des Gymnasiums beschäftigte ich mich mit der Frage nach der Eigentlichkeit von uns Menschen: «Wer sind wir, wo liegt der Grund unseres Menschseins? In welche Richtung gehen wir, was ist für uns wesentlich, um Vollendung zu erlangen?» Noch vor der Matura drängte es mich, den Menschen näher zu erforschen. Für mich gab es zwei Möglichkeiten der Weiterbildung: die Geisteswissenschaften, das heisst Philosophie und Literatur, oder die Medizin. Für den einen der beiden Wege musste ich mich damals entscheiden. Eigentlich wollte ich Dichter und Schriftsteller werden, doch als Achtzehnjähriger sagte ich mir: «Bevor ich anfange, über Menschen zu schreiben, muss ich den Menschen näher kennenlernen, seinen Leib, seinen Geist. Bevor ich mich an seine Geistigkeit heranwage, täte ich gut, das Körperliche des Menschen zu erforschen! Also fange ich an, Medizin zu studieren!»
Vor dem zweiten propädeutischen Examen war mir das Medizinstudium verleidet: ich wollte Dichter werden und die Medizin aufgeben. Ich redete mit meinem Vater, er sagte, ich solle es mir gut überlegen und noch jemanden um Rat fragen. Ich suchte meinen ehemaligen Französischlehrer auf, der früher meine Gedichte durchgelesen und kritisiert hatte. Er redete mir zu, unter allen Umständen die zweite medizinische Vorprüfung in Anatomie, Physiologie und physiologischer Chemie abzulegen und mich erst nachher zu entscheiden. Ich hörte auf die Stimme des älteren Mannes. Nachdem ich das zweite Propaedeuticum (Physicum) bestanden hatte, änderte sich die Ausbildung in der Medizin. Fortan musste ich nicht mehr Leichen sezieren, ich lernte jetzt Patienten zu untersuchen und zu behandeln. Ich fühlte mich herausgefordert, ich fing an, den ärztlichen Beruf zu lieben. Als ich mein eidgenössisches Arztdiplom in den Händen hielt, war ich noch keine fünfundzwanzig Jahre alt. Nie habe ich später den Entschluss, Mediziner zu werden, bereut. Arzt zu sein war der Beruf, der zu mir gehörte, der mich später dorthin brachte, wo ich als kleiner Junge schon hinwollte: in den Urwald!
Als ich studierte, gab es noch kein zermürbendes Bolognasystem mit sinnlosen Prüfungen. Nach dem zweiten Propi lagen sieben prüfungslose Semester der klinischen Ausbildung vor mir, dann kam das Staatsexamen. Je ein Semester studierte ich an der Universität Hamburg und an der Sorbonne in Paris, die übrigen fünf Semester in Zürich. Zum klinischen Teil des Studiums gehörte auch die Verpflichtung, als Unterassistent in Krankenhäusern zu arbeiten, sowie die Militärpflicht bis zum Unteroffizier zu absolvieren. Dazu dienten die Sommerferien. Ein Semester vor dem Staatsexamen vertrat ich einen praktischen Arzt in Sulgen, im Kanton Thurgau. Diese Arbeit begeisterte mich.
Trotz des strengen Studiums hatte ich genügend Zeit zu reisen. Ich wollte ursprünglich gebliebene Länder und deren Menschen kennenlernen. Zwanzigjährig besuchte ich mit einem Freund das damals vom Tourismus noch kaum berührte Griechenland. In den Sommerferien 1958 reiste ich alleine durch die Türkei: Istanbul, Westküste, Südküste bis nach Antakya, zentrales Hochland von Konya über Göreme bis nach Sivas und von dort nach Ankara und zurück an die Westküste, wo ich wegen schweren Darmbeschwerden die Reise abbrechen musste. In den Frühlingsferien 1959 durchquerte ich teilweise zu Fuss, teilweise im ländlichen Autobus die Insel Kreta. 1960 begleitete ich kretische Schleppnetzfischer an die Küste Libyens. Trotz dieser Eskapaden legte ich nach zwölf Semestern mit guten Noten das eidgenössische Staatsexamen ab. Meine Reisen förderten gleichzeitig meine Bildung zum achtsamen Menschen. Sie bereiteten mich auf meine spätere Arbeit als Arzt in abgelegenen Gegenden vor.
Ich merkte damals, wie problemlos es für mich war, überall auf der Erde in eine offene, herzliche Beziehung zu den Menschen zu treten. Unterschiede in Abstammung, Hautfarbe, Bildungsgrad und Religion spielten für mich keine Rolle. Wohin ich mich wendete, öffnete ich mich den Menschen. Bald stellte sich gegenseitige Vertrautheit ein. Ich lernte ihre Sprachen: Neugriechisch, Türkisch, Persisch und später Arabisch, Spanisch, Kisuaheli.
Wenn ich in ein Land komme, sei es als Tourist oder wie in späteren Jahren als Arzt, lasse ich die Leute, mit denen ich zusammenkomme, intuitiv merken, dass ich mich als einen Menschen, wie sie selbst Menschen sind, verstehe und mich in ihrer Nähe wohl fühle. Fast immer finde ich Entgegenkommen. Der Vater meiner ersten Frau, ein Fischhändler auf einer kleinen Dodekanesinsel, sagte eines Tages zu mir: «Die Leute auf unserer Insel schätzen dich, weil du ihnen auf gleicher Ebene begegnest und nicht vorgibst, etwas Besseres zu sein, weil du dich hinsetzt, einen Ouzo oder einen Kaffee mit ihnen trinkst, weil du mit ihnen redest, als wärest du ihresgleichen.» Mit dieser Bereitschaft bin ich an alle Menschen herangetreten, und fast immer fand ich wohlwollende Aufnahme. Anderseits stiess ich deswegen nicht selten auf Unverständnis und Missgunst bei Europäern und Amerikanern, die sich gleichzeitig in meiner Nähe aufhielten.
Während meiner Studentenzeit wurde mir Griechenland zu einer zweiten Heimat. Ich liebte es, mit griechischen Hirten und Fischern zusammen zu sein, ich liebte die karge Landschaft, das Meer und den tiefblauen Himmel. Ich war verrückt nach diesem Land. Etwas überstürzt heiratete ich 1966 eine achtzehnjährige Griechin, die mir, als sie neun Jahre alt war, auf einem Schiff eine halbe Orange geschenkt hatte und mir seither unentwegt Briefe schrieb. Mit dieser Geschichte allein könnte ich ein Buch füllen.
Nach Staatsexamen und Offiziersschule reiste ich während drei Monaten durch den Vorderen Orient, zuerst mit dem Zug über Jugoslawien nach Athen, von dort mit dem Flugzeug nach Ankara und mit dem Bus über Sivas in die Osttürkei. Mit der Eisenbahn ging es weiter nach Erzurum, von wo einmal in der Woche ein iranischer Bus Reisende nach Täbris brachte. In Teheran angekommen, blieb ich einige Tage in der iranischen Hauptstadt. Dann fu...