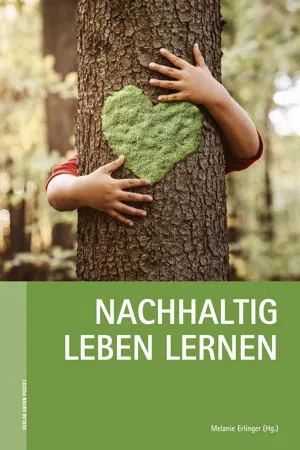![]()
Michael Rosenberger
Von den Mühen und dem Glück des Verzichts – Suffizienz als Schlüssel zur Nachhaltigkeit
Zusammenfassung
Die Ziele des Pariser Klimaabkommens sind ambitioniert, wenngleich sie bis dato nicht erreicht wurden. Es liegt dabei aber nicht am Mangel technischer Infrastruktur, sondern an der fehlenden Genügsamkeit der Menschen. Ansätze der klassischen Tugendethik gepaart mit der notwendigen ökonomischen Basis sollen bescheidenere, freudvollere Lebensentwürfe ermöglichen.
1.Einleitung
Der 12. Dezember 2015 wird in die Geschichtsbücher eingehen. Denn an diesem letzten Tag der 21. UN-Klimakonferenz haben sich alle Staaten weltweit auf das Ziel verpflichtet, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die Anwesenden feierten das Ergebnis als großen Durchbruch. Doch ist die Umsetzung der für dieses Ziel nötigen Maßnahmen seitdem kaum vorangekommen. Vielmehr sind weitere fünfeinhalb Jahre ergebnislos verpufft. Die zornige Reaktion von Greta Thunberg und den „Fridays for Future“ ist daher mehr als verständlich. Schnelles und einschneidendes politisches Handeln sind nötig. Aber was ist zu tun? Worauf kommt es an? Und wie kann ein gutes Leben aussehen, das die Belastungsgrenzen des Planeten respektiert?
2.Das Paris-Ziel: 1,5 Grad Celsius
Im Vergleich zum vorindustriellen Niveau haben wir 2017 bereits eine globale Erwärmung von 1 Grad Celsius (IPCC 2018, S. 4) und 2021 von 1,1 Grad Celsius erreicht. Die als Maximum angestrebten 1,5 Grad Celsius erreichen wir bei „business as usual” zwischen 2030 und 2052 (IPCC 2018, S. 4) – und zwar vermutlich eher 2030 als 2052. Bis zum Jahr 2100 würden alle bislang von den Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens eingegangenen Verpflichtungen eine Erderwärmung von deutlich über 2 Grad Celsius bewirken (IPCC 2018, S. vi) – geschätzt 3 bis 4 Grad Celsius.
Eine derartige Erwärmung ist inakzeptabel. Der Grund sind vor allem sogenannte Kipppunkte (IPCC 2018, S. 262–264). Das sind Grenzwerte, ab denen sich ein für das Erdklima wichtiges Ökosystem schlagartig so verändert, dass wir die sich daraus ergebenden Kettenreaktionen nicht mehr berechnen können. Werden diese Grenzwerte überschritten, werden Prozesse angestoßen, die der Mensch nicht mehr kontrollieren oder zurückdrehen kann: Es handelt sich um „points of no return“! Als solche Kipppunkte nennt die Klimaforschung vor allem: vollständiger Verlust des ganzjährigen arktischen Eises, Bewaldung der Tundra, Auftauen des Permafrosts, Steigerung der Intensität des asiatischen Monsuns, massive Reduktion des Regens im abgeholzten Regenwald und damit weiterer Verlust von aufgrund der Dürre sterbendem Regenwald, vermehrtes Absterben der borealen Wälder.
Die meisten dieser Kipppunkte können unterhalb von 1,5 Grad Celsius Erwärmung ziemlich sicher vermieden werden und bleiben selbst unterhalb von 2 Grad Celsius halbwegs unwahrscheinlich, werden aber zwischen 3 und 4 Grad Celsius mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Genau aus diesem Grund ist das 1,5-Grad-Celsius-Ziel keine beliebige Marke, sondern verdankt sich klar benennbaren Risikoabwägungen.
3.Der Weg zum Paris-Ziel: Net Zero 2040
Was ist die Obergrenze für den Ausstoß anthropogener Treibhausgase, um das Paris-Ziel zu erreichen und die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen? Allerspätestens im Jahr 2050 sollte die weltweite CO2-Neutralität („net zero“) erreicht werden, 2030 eine Reduktion um 45 Prozent im Vergleich zu 2010 (IPCC 2018, S. 12). Das entsprach 2018 einem Restbudget von 580 Gigatonnen Kohlendioxid-Äquivalenten. Die Chance, dass die Erderwärmung 1,5 Grad Celsius nicht übersteigt, beträgt dann 50 Prozent. Wird das Restbudget auf 420 Gigatonnen Kohlendioxid-Äquivalente gekürzt und „net zero“ bereits 2040 erreicht, steigen die Chancen für maximal 1,5 Grad Celsius Erderwärmung auf 66 Prozent (IPCC 2018, S. 33). Zur Orientierung: Im Jahr 2019 lag der globale Ausstoß an Treibhausgasen bei 37 Gigatonnen Kohlendioxid-Äquivalenten. Wir haben also für die kommenden 30 Jahre nur noch ein Restbudget von ungefähr zehn bis fünfzehn solchen Jahresverbräuchen zur Verfügung. Die Herausforderung ist gewaltig.
Nun ist das Nachhaltigkeitskonzept ein international und intergenerational ausgeweitetes Gerechtigkeitskonzept: Alle Menschen, gleich welcher Nationalität und gleich welcher Generation, sollen die gleiche Chance haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Die gegenwärtigen Treibhausgasemissionen sind jedoch global betrachtet sehr ungleich verteilt. Im Mittleren Osten emittiert jeder Mensch über 20 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente pro Jahr, in Kanada und den USA rund 15, in Europa 6 bis 9, in China 7, aber in Indien nur 2 und in Afrika nur 1 Tonne. Während in Europa leichte Rückgänge zu verzeichnen sind, steigen die Emissionen in den meisten anderen Ländern der Welt weiter an – derzeit um global 1,1 Prozent jährlich. Wir sind also nicht nur von „net zero“ meilenweit entfernt, sondern beschreiten sogar einen Pfad in die entgegengesetzte Richtung. Das Ziel wäre nämlich ungefähr das gegenwärtige Niveau von Indien: 1,5 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente pro Person und Jahr. Das ethische Prinzip der „Equity“ verlangt einen ungefähr gleichen Pro-Kopf-Verbrauch für jeden Menschen. Afrika und die ärmsten Staaten Asiens dürfen also noch zulegen, während praktisch der gesamte Rest der Welt drastisch reduzieren muss.
4.Von den Mühen des Verzichts: Der Rebound-Effekt
Man kann sich leicht vorstellen, dass so grundstürzende Veränderungen nicht spurlos am Lebensstil der Menschen vorbeigehen. In der Tat lässt sich die Ursache dafür schnell benennen, dass die Industrieländer beim Klimaschutz seit 30 Jahren auf der Stelle treten: Alle Einsparungen durch technische Effizienzsteigerungen werden durch die immer größeren Ansprüche der Menschen aufgefressen. Das sei in den folgenden beiden Grafiken an zwei Beispielen gezeigt:
•Die Effizienz der österreichischen PKW-Flotte hat sich von 2000 bis 2018 spürbar verbessert. Der durchschnittliche PKW braucht, obwohl er größer und schwerer geworden ist, 16 Prozentpunkte weniger Energie für 1 Kilometer Fahrstrecke. Gleichzeitig fahren die Österreicherinnen und Österreicher aber 2018 um 17 Prozent mehr Kilometer – was de facto darauf hinausläuft, dass sie praktisch die gleiche Menge Energie verbrauchen und Kohlendioxid emittieren wie im Jahr 2000.
•Ganz ähnlich sieht es bei der Beheizung des Wohnraums aus. Die Energieintensität pro Fläche wurde von 2004 bis 2018 durch Gebäudedämmung und bessere Heizsysteme um 12 Prozentpunkte reduziert. Gleichzeitig hat sich die Wohnfläche pro Person um 10 Prozent erhöht – was ebenfalls auf ein Nullsummenspiel hinausläuft.
Mit anderen Worten: Es liegt nicht an der mangelnden technischen Effizienz. Industrie und Technik haben ihre Hausaufgaben zu einem erheblichen Teil erledigt (siehe Grafik 1). Es liegt vielmehr an der mangelnden Genügsamkeit (Suffizienz) der Menschen. Kaum ist ein Effizienzgewinn entstanden, beanspruchen ihn die Menschen für sich, anstatt ihn an die Umwelt weiterzugeben. Dieser sogenannte „Rebound-Effekt“ ist bereits im Jahr 1865 vorhergesagt worden (Jevons 1865, S. 103) und wird nach seinem Entdecker auch Jevons’ Paradox genannt. Nachhaltiger Klimaschutz ist also vor allem ein Suffizienzproblem und nicht ein Effizienzproblem. Das „Evangelium der Öko-Effizienz“ („Gospel of Eco-Efficiency“, so der Titel von Hays 1959; später populär gemacht von Martinez-Alier 2002, S. 1) funktioniert nicht. Im Gegenteil: Ökonomisch betrachtet ist Effizienz sogar eine Wachstumstreiberin (Haberl et al. 2011, S. 9).
Die Frage ist: Wer traut sich das zu sagen? Suffizienz zu fordern ist unbequem – schon manche politischen Parteien haben auf diese Weise Wahlen verloren. Daher kann es nicht verwundern, dass der IPCC1 in dieser Hinsicht eher vorsichtig formuliert. So heißt es: „Nachfrageseitige Maßnahmen sind Schlüsselelemente von 1,5°C-Entwicklungspfaden. Lebensstilentscheidungen zur Senkung des Energiebedarfs und der Land- und Treibhausgasintensität des Nahrungsmittelverbrauchs können die Erreichung von 1,5°C-Entwicklungspfaden weiter unterstützen.“ (IPCC 2018, S. 34. 97; übersetzt durch den Autor) Nachfrageseitige Maßnahmen werden als „Schlüsselelement“ bezeichnet – gemeint ist vermutlich die Nachfrage seitens der Industrie, die rohstoffärmere Produkte herstellen soll. Persönliche Lebensstiländerungen vor allem in den Bereichen Energie und Ernährung können das Erreichen des 1,5-Grad-Celsius-Ziels „zusätzlich unterstützen“, heißt es dann. Man spürt, wie scheu und verschämt die 3000 renommiertesten Klimaforscherinnen und Klimaforscher der Welt das Thema „Lebensstil“ ansprechen. Fast grotesk mutet an, dass sie dann sogar behaupten, solche Lebensstilveränderungen fänden bereits „rund um die Welt“ statt und hätten zu signifikanten Reduktionen geführt (IPCC 2018, S. 42. 317). Da kann eigentlich nur der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen sein, der aus lokalen Vorzeigeprojekten eine weltumspannende Erfolgsstory zu schreiben versucht.
Grafik 1: Steigerungen der technischen Effizienz und der menschlichen Ansprüche und die daraus resultierenden Energieverbräuche im Bereich PKW (Grafik: Rosenberger; Zahlenmaterial: Statistik Austria/Mikrozensus Energieeinsatz der Haushalte)
Grafik 2: Steigerungen der technischen Effizienz und der menschlichen Ansprüche und die daraus resultierenden Energieverbräuche im Bereich Wohnungsbeheizung. (Grafik: Rosenberger; Zahlenmaterial: Statistik Austria/Mikrozensus Energieeinsatz der Haushalte)
Insgesamt werden dem Thema Lebensstil- und Verhaltensänderungen in dem 630 Seiten starken Bericht nur acht Seiten gewidmet (IPCC 2018, S. 362–369). Einleitend wird dort ein einziges Mal Klartext gesprochen: „Die Menschen stehen im Zentrum des globalen Klimawandels: Ihr Handeln verursacht anthropogenen Klimawandel, und der soziale Wandel ist der Schlüssel, um wirksam auf den Klimawandel zu reagieren […] Konsistente Entwicklungspfade gehen von wesentlichen Verhaltensänderungen aus“ (IPCC 2018, S. 362; übersetzt durch den Autor). Schon wenig später erfährt man jedoch, dass die Menschen Effizienzmaßnahmen mehr lieben als Suffizienzmaßnahmen, weil jene sie weniger Anstrengung „kosten“ (IPCC 2018, S. 364). Und die darauffolgenden Ratschläge lassen die geballte Mut- und Ratlosigkeit des IPCC erkennen: Man solle die Fähigkeit ärmerer Menschen zum Tun stärken, Wissen und Motivation fördern. Wo gemeinsam gehandelt werde, seien alle motivierter (IPCC 2018, S. 365). Negative Gefühle angesichts der Klimaerwärmung könnten helfen – je größer die Sorge, umso mehr täten Menschen (IPCC 2018, S. 365). Die Politik bevorzuge technische Lösungen, doch: „Sie verfehlen ihr wahres Potenzial, wenn ihre sozialen und psychologischen Implikationen übersehen werden“ (IPCC 2018, S. 366). Preisanreize seien daher wichtig – die extrinsische Motivation soll die intrinsische begleiten (IPCC 2018, S. 367).
Diese intrinsische Motivation zur Suffizienz wird ein einziges Mal in einem allerdings eindringlichen Appell zur Werteforschung beschworen: „Die tiefgreifenden Veränderungen, die notwendig wären, um nachhaltige Entwicklung und 1,5°C-kompatible Entwicklungspfade zu integrieren, erfordern die Überprüfung der Werte, Ethiken, Einstellungen und Verhaltensweisen, die Gesellschaften zugrunde liegen. Werte zu entwickeln, die eine nachhaltige Entwicklung fördern, individuelle wirtschaftliche Interessen überwinden und über das Wirtschaftswachstum hinausgehen, wünschenswerte und transformative Visionen fördern und sich um die weniger Glücklichen kümmern, ist ein fester Bestandteil klimaresistenter und nachhaltiger Entwicklungspfade. Dazu gehört, dass Gesellschaften und Einzelpersonen dabei unterstützt werden, beim Ressourcenverbrauch nach Genügsamkeit (Suffizienz) innerhalb der planetarischen Grenzen zu streben, verbunden mit nachhaltigem und gerechtem Wohlbefinden” (IPCC 2018, S. 475; übersetzt durch den Autor).
Um es einmal klar zu sagen: Die geforderte Werteforschung gibt es längst. Aber der IPCC traut sich offensichtlich nicht, deren Ergebnisse klar und unumwunden zu benennen – er würde sonst die Akzeptanz seiner Forderungen in Politik und Gesellschaft gefährden.
5.Faktoren menschlicher Zufriedenheit
Machen Geld und Besitz glücklich? Seit vielen Jahrzehnten setzt man die subjektive Lebenszufriedenheit der Bevölkerung eines Landes in Relation zu dessen Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt, um diese Frage zu beantworten. Dabei stellen sich absolut konstant zwei Erkenntnisse heraus:
1) Mehr Geld und Besitz, also mehr materieller Wohlstand, sorgen für mehr Lebenszufriedenheit. Das ist sozusagen die antiökologische oder nicht-nachhaltige Seite der Problemstellung.
2) Je höher das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt liegt, umso geringer fällt die weitere Steigerung der Lebenszufriedenheit aus. Während zum Beispiel die Steigerung des Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukts von 10.000 auf 20.000 US-Dollar noch eine große Steigerung der Lebenszufriedenheit bewirkt, fällt die Steigerung der Lebenszufriedenheit durch Steigerung des Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukts von 30.000 auf 40.000 US-Dollar nur noch sehr gering aus. Das ist die ökologische und nachhaltige Seite der Problemstellung.
Grafik 3: Subjektive Lebenszufriedenheit in Relation zum Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt 2018 (Our World in Data; World Happiness Report 2019, World Bank)
Man fragt sich, warum das so ist. Die ökonomische Antwort ist (gemessen am Al...