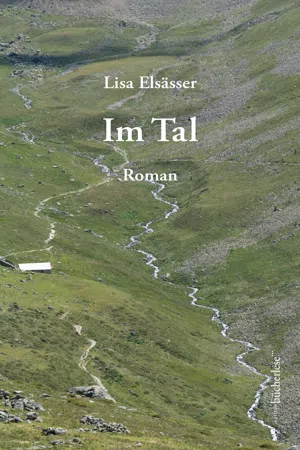![]()
II
»Wie lange ist das her?«
»Jedenfalls lange genug, um mehr Falten im Gesicht zu haben!«
Sie lachte. Ob er sich selbst oder sie gemeint hatte, war vollkommen unerheblich.
Er putzte bei ihrer Ankunft die Klauen eines Rinds. Er sagte, die Kühe brauchen gesunde Klauen. Sie seien einer der wichtigsten Körperteile. Sie schaute ihm zu. Es faszinierte sie, wie sorgfältig, geradezu liebevoll er den Tschaggen – wie die Bauern die Klauen nennen – in der Hand hielt. Am liebsten hätte sie ihm auch gleich ihre Füße zur Pflege hingehalten.
»Und?«
Er zeigte auf den Kasten, der am Stall hing. Dort liegt der Schlüssel.
»Und?«, fragte er wieder. Sie nickte nur, als ob ihr Nicken die Antwort auf seine Frage wäre. Und als ob sie ihm damit die richtige Antwort gegeben hätte, war er zufrieden.
Das letzte Abendlicht wanderte über die Berge. Frische Luft wehte ihr entgegen, als sie den Weg zur Hütte unter die Füße nahm. Unten am Bach lagen bereits die Schatten. Sie hatten nichts anderes zu tun, als zu warten, bis die Dunkelheit ihnen das Wort Schatten nahm. Dann würde die Dunkelheit selbst daliegen, sich strecken, und etwas Undurchschaubares würde sich ausbreiten, in dem sich Geräusche und Tiere gleichermaßen bewegten und ebenso ihre Zweifel, ob es sich beim Gehörten in der Dunkelheit um ein Tier oder um ein eingebildetes Geräusch handelte.
Vor Jahren – nein – Jahrzehnten, als sie sich, nach einem in der Zeitung gelesenen Inserat »Berghütte zu vermieten« sofort angezogen fühlte und, nach Absprache mit dem Bauern, für einige Tage zuhinterst ins Tal zog, dorthin, wo die kleine Hütte stand. Damals verbrachte sie die letzte Nacht, bevor sie aufbrach, am Bett ihres Kindes, lauschte seinem Atem, seinen Traumgesprächen, die seinen Atem reizten, dem ein kurzer Husten folgte.
Hätte sie diesmal, vor ihrem Weggang, das Zimmer des inzwischen erwachsenen Sohnes wieder betreten wollen, wäre sie dort gar nicht zum Bett gelangt. Offensichtlich liebte ihr Sohn das ihn umgebende Chaos in der Hoffnung, den tanzenden Stern zu sehen, von dem sie einmal geschrieben hatte. Er hatte also das Nietzsche-Zitat tüchtig missverstanden, denn dort ging es um das Chaos in sich und nicht um die Unordnung in einem Zimmer.
Sagte sie hie und da: »Mach mal wieder Ordnung«, meinte er nur: »Das ist MEINE Ordnung!« Sie betrat das Zimmer nur noch, wenn sie sehr schlechte Laune hatte und sie dieser dort, mitten in der Unordnung, freien Lauf lassen konnte. Löste sich dann ein Schrei, war es einer, der im Grunde genommen gar nicht ihrem Sohn galt.
Mit Kopfhörern lag er auf dem Bett und schlug mit den Fingern den Takt der Musik, die er gerade hörte, und ihr schien, als schlage er zugleich auch den Takt ihrer Tirade, die er ja gar nicht hören konnte. Sah sie dann später am Tag zur Essenszeit seine lebhaften, charmanten Augen, seine vollkommene Unschuld, mit der er seiner Unordnung begegnete, nämlich wie der natürlichsten Sache der Welt, wusste sie wieder, dass es nichts zu schreien gab.
Sie sagte diesmal beim Abschied nur: »Vergiss den Tag nicht, an dem du zum Militär einrücken musst«, obwohl sie geneigt war, das Gegenteil zu sagen, und zu ihrem Mann sagte sie: »Vergiss nicht, dass du ihn am besagten Tag daran erinnern musst.«
Bei sich selbst dachte sie, es könnte ihm nichts Schöneres als dieses Vergessen passieren. Später einmal erzählte der stramme Soldat lachend, dass der Vorgesetzte ihm spätabends bei der Kontrolle die halb volle Wasserflasche direkt aufs Nachtlager geleert hätte, er dann die Nacht im nassen Bett habe verbringen müssen. Vielleicht hätte sie das auch einmal machen müssen, um Ordnung zu erzwingen. Aber sie konnte ja nicht gleichzeitig gegen das Militär sein und dieselben drakonischen Methoden anwenden.
War es beim letzten Mal, als sie sich für den Aufenthalt in der Hütte entschieden hatte, ein reiner Fluchtakt gewesen, ein Versuch, dort ihre Stimme und die Stimme der Natur, der Einsamkeit wieder zu hören, so spürte sie dieses Mal ein eigentliches Hingezogen sein, ein freiwillig sich allem Überlassen wollen. Sie würde sich erwartet fühlen von jedem Stein, jedem Tännchen, und der Bach würde rauschen, als begrüße er ungeduldig ihren nackten Körper, über den er seine kühle Zärtlichkeit fließen lassen konnte. Ihr abendliches Ritual, bevor sie sich ins Bett legen und, bis in den Traum hinein von seinem Murmeln begleitet, in ihre Traumgewässer fallen lassen würde.
Als sie auf dem Weg zur Hütte auf dem feuchten Moos und gut getarnt zwischen dichtem Farn das Schlangenpaar eng übereinander oder ineinander verbandelt liegen sah, nahm sie ihren Fotoapparat und machte ein paar Bilder. Noch nie hatte sie das aus so unmittelbarer Nähe sehen können. Es freute sie mehr, als es sie ängstigte, obwohl sie hinterher dachte, es mit dieser Nähe ein wenig übertrieben zu haben. Mehrmals suchte sie die nächsten Tage diese Stelle wieder auf, saß dann still auf einem Stein, als erwartete sie ein ähnliches Schauspiel oder zumindest, dass sich eine der beiden Schlangen wieder an der genau gleichen Stelle aufhalten würde. Auch Schlangen hatten ihre Rituale, sonnten sich, so hatte sie das gelesen, immer wieder am gleichen Ort, an warmen oder halbschattigen Plätzen. Aber wie auch Glücksmomente immer an ganz unerwarteten Orten aufscheinen konnten, schien das plötzliche Auftauchen auch ein Gesetz dieser Schlange zu sein.
Es hatte sich nichts verändert. Wie ein Königskind stand das Häuschen da. Aufgeheizt auch im Innern durch die anhaltend schönen Sommertage. Auf dem Tisch die karge Notiz: »Hoffe, alles ist in Ordnung!« Aber es gab hier gar keinen Platz für Unordnung, das karge Mobiliar konnte gar nicht umgestellt werden. Es war, als ob das Häuschen einmal vor langer Zeit um die nötige Einrichtung herumgebaut worden wäre.
Eine Weile saß sie auf der verwitterten Holzbank, die mit dem Haus verwachsen schien, atmete die frische Abendluft, sah, wie die letzten Glutstreifen an den Bergen erloschen. Sie fühlte sich geborgen in der Stille. Nichts anderes geschah, als dass die Dunkelheit sich über und zwischen alles legte; jedes Gebüsch war erfüllt von diesem schwerelosen Trost der Nacht.
Im Tal schien die Zeit stillzustehen. Nichts hatte sich verändert. Sie meinte, dass selbst die Grasbüschel, das Moos und die Flechten an den gleichen Stellen wuchsen wie vor Jahren. Vor dem Haus, unter dem kleinen Vordach, hatte ihr der Bauer das gespaltene Holz aufgeschichtet, und sie spürte schon jetzt, dass es ihr schwerfallen würde, dieses kleine Kunstwerk durch den Gebrauch der Holzscheite zu verändern. Sie liebte den alten Herd, die verrußten Pfannen, die über dem Herd an Nägeln hingen, und freute sich darauf, das Feuer zu riechen. Niemand stellte hier Ansprüche an sie. Es gab nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen. Das war schön. Sie konnte um vier Uhr nachmittags den ersten Kaffee trinken und um Mitternacht eine Polenta auf dem Holzherd kochen. Sie konnte tagsüber träumen und nachts den Mond bestaunen. Selbst die Rehe hatten begriffen, dass sie keine Jägerin war und blieben jeweils für eine Weile an Ort und Stelle stehen. Oft hatte sie beim letzten Aufenthalt sogar das Gefühl gehabt, dass ihnen ihre Gesellschaft – anstelle der von immer nur anderen Tieren – ganz recht gewesen sei.
Sie packte ihre Bücher aus, die Nahrungsmittel, stellte diese in den kleinen Schrank, den Schreibblock und den Bleistift legte sie auf den Tisch. Sie öffnete die Schachtel mit den Kerzen und steckte eine in den Kerzenhalter. Ihre Schuhe hatte sie noch nicht ausgezogen, da sie wusste, dass sie noch einmal nach draußen wollte, um sich vertraut zu machen mit der Stille oder den Geräuschen des Waldes, mit der Dunkelheit.
Nach einer kleinen Mahlzeit legte sie sich ins Bett, las im Schein der Taschenlampe. Sie hatte dieselben Bücher mitgenommen wie beim letzten Mal: »Die Wand« von Marlen Haushofer und »Dunkle Wälder« von Corinna Bille. Sie schienen einfach hierher zu gehören, obwohl sie beide schon mehrere Male gelesen hatte. Sie entschied sich für »Die Wand«, las, hörte dazu das Rauschen des Baches. Und als ob sie mit allem Vergangenen Frieden geschlossen hätte, ja sogar mit sich selbst, fühlte sie eine Schläfrigkeit, die bald ihre Lider erfassen und sie zudecken, das Denken flügellos machen würde. Sie erinnerte sich nur noch kurz an die letztmals verbrachten Tage hier in der Stille. Nichts Wesentliches hatte sich seither verändert, außer dass die Zeit dazwischen schnell vergangen war.
Oder doch?
Sie erwachte in den frühen Morgenstunden, blieb in der Bettwärme liegen und überließ sich ihren Gedanken.
Die kleinen Schritte. Diese unmerklich kleinen Schritte, die sich plötzlich, aus der Distanz gesehen, als große Schritte bezeichnen ließen: Sie hatte niemanden verlassen, das war der größte Schritt für sie. Während ihr Kind erwachsen geworden war, war ein neuer Mensch bei ihr eingezogen. Und noch größer war der andere Schritt, den nicht sie getan hatte: Dass nicht sie verlassen worden war. Diese großen Schritte hatten tausend kleine erfordert. Ihr kam zu jener Zeit ihr Leben plötzlich wie ein implantierter Schrittmacher vor, der durch die eigenen verwirrten Herzschläge selbst ins Stolpern geriet. Seine Aufgabe war das nicht, aber welches Ersatzgerät übernahm schon stets und zuverlässig die Pflicht, es seinem Protagonisten immer recht zu machen. Immer so zu gehen, dass von Normalität die Rede sein konnte.
Hatte sie Moritz, dem ihr sehr nahen Freund, schon einmal vom Tal erzählt, von den Tieren, von der Wildnis? Und dass sie dem Bachwasser mehr als ihm erzählte, sagte sie sich, als sie am Bach saß. Er plätscherte, gelassen gurgelnd, irgendwohin, letztlich in den See, an dessen Ufer auch Moritz oft stand. Aber das Wasser gab auch dort nur unverständliche Floskeln zum Besten und die Wellen schafften es nicht bis zu seinen Füßen.
Sie lachte über dieses Bild, die Fantasie der Übertragung, froh auch, sich auf die Verschwiegenheit eines Elementes verlassen zu können.
Ihr war in den Sinn gekommen, dass sie Moritz beim letzten Aufenthalt noch gar nicht gekannt hatte.
Ihre Zehen im kalten Wasser wurden blau. Sie trocknete die Füße mit ihrem ausgeleierten Pullover. Sie war nicht ausgerüstet wie eine Touristin am Meer, aber glücklich wie ein Bergkind, das keine Ahnung hatte von all dem Sand, der abends in jeder Körperfalte reiben konnte wie die Ablagerungen in Gedanken geführter Gespräche. Sie warf den nassen Pullover über ihre Schultern und spazierte hoch zur Hütte.
Abends, so gegen sieben, kam der Bauer. Wie schon damals hing in seinem linken Mundwinkel ein Stumpen, mit dem er aber trotzdem fähig war, zu reden.
»Und?«, fragte er.
Und sie sagte auch: »Und?«
Vor der Hütte tranken sie einen Kaffee. Die Sonne leuchtete noch eine Weile auf den höchsten Spitzen. Das tat sie ja immer, an jedem schönen Tag. Aber die Bergler sind romantisch, ein Sonnenuntergang verführt sie zu Sentimentalitäten. Das hatte sie schon als Kind bei ihrem Onkel im Tal erlebt, der sie jedes Mal beim Sonnenuntergang an die Hand nahm, sich mit ihr auf die alte Steintreppe setzte und mit seiner anderen Hand oben auf die Berge zeigte. Sie hatte als Kind zuerst gar nicht gemerkt, was es da oben zu sehen gab. Erst als der Berg dunkler wurde, wusste sie, was er gemeint hatte.
»Jetzt schau mal da hoch!«, und der Bauer drehte sich auf der Holzbank dem letzten Glühen zu und sagte:
»Und?«
»Schön!«, sagte sie. »Was machen die Kühe?«
»Die sind gemolken!«
»Der Hund?«
»Wollte bei den Ziegen bleiben!«
Seine blauen Augen musterten sie und zum ersten Mal sah sie in diesen blauen Augen eine Offenheit, die sie erstaunte. Schön und auch demütig, so als hätte ihnen die Schönheit sogleich auch Demut verordnet, ein kleines, fast unsichtbares Lächeln am freien Mundwinkel, ein interessiertes Bei-ihr-Sein, ein Warten auf ihr Gegeninteresse für sein bäuerliches Leben, von dem sie nichts wusste.
Er hatte seinen Stumpen fertiggeraucht, und sie zündete sich eine Zigarette an, bot ihm eine an, er nahm sie und ließ sich Feuer geben. Die Sonne war inzwischen untergegangen, obwohl sie wahrscheinlich noch am Himmel über Deutschland hauste, wo sie nie unterzugehen schien. Deutschland, das Land, in dem sie einige Jahre gelebt hatte. Er, der Bauer, kannte es nicht, wie er ihr später einmal verriet.
Wieder kam das bei der Ankunft schon erwähnte »Und« aus seinem Mund. Seine Welt schien nur diese Frage zu stellen, um mit einem Gegenüber in Kontakt zu kommen, und falls er eine Antwort bekam, war das gut. Wenn er keine bekam, war es auch gut; ganz so, als erwarte er überhaupt nichts.
So blieb es an diesem Abend. Fast so sprachlos wie das Tal selbst, wie die unmittelbare, sie umgebende Welt. Ein paar Wolken ballten sic...