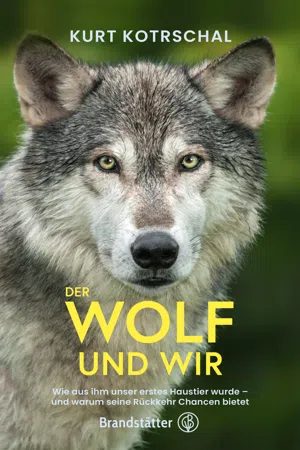![]()
Kapitel 2
Die Rückkehr der Wölfe: Chancen und Herausforderungen
Sie kommen rasch, nicht alle freut das
Wenn man sie lässt, kommen Wölfe überaus schnell zurück. Musterbeispiel dafür ist Deutschland, wo es vor 20 Jahren so gut wie keine Wölfe gab, 2021 waren es bereits um die 2.000. Ungestörte Populationen mit guter Nahrungsversorgung können pro Jahr um bis zu 30 Prozent wachsen. Mit einer Vorstellung von Zinseszinsrechnung weiß man, was das zumindest theoretisch bedeutet. Die Rechnung ist allerdings nicht ganz so einfach, da Wölfe frühestens im zweiten, meist erst im dritten Jahr reproduzieren und die Todesrate vor allem der Jungwölfe durch eine Reihe von Faktoren relativ hoch ist. Bisher trifft die Annahme eines etwa zwanzigprozentigen Anstiegs der Zahl der Rudel die Verhältnisse in Deutschland recht gut. Das geht aber nicht so weiter, es gibt in der Biologie kein ewiges exponentielles Wachstum. Vor allem werden die lokalen Wolfsdichten nicht ständig zunehmen. Denn ist ein Gebiet mit Rudeln „gesättigt“, was etwa sechs Wölfe auf 200 bis 600 Quadratkilometern bedeutet, dann verhindern die Rudelwölfe selber mit Zähnen und Klauen, dass sich weitere Wölfe ansiedeln. Diese aggressive Verteidigung des Territoriums nennt man in der Biologie „dichteabhängige Regulation“. Da Jungwölfe sich im eigenen Rudel nicht vermehren können, verlassen sie es mit ein bis zwei Jahren. Sie ziehen Hunderte oder sogar Tausende Kilometer weg, um in der Fremde einen Partner zu finden und ein neues Rudel zu gründen. Die hohe Vermehrungsrate der Wölfe bewirkt also ihre rasche Ausbreitung in der Fläche – wiederum: Wenn man sie lässt.
So besiedeln die in den 1970er-Jahren noch vom Aussterben gefährdeten italienischen Wölfe heute nicht nur die bergigen Anteile Italiens, vom Süden Kalabriens bis ins Piemont, sondern auch die französischen Alpen – eigentlich den gesamten Osten Frankreichs – sowie die Schweiz. In Deutschland vermehrten sich in der sächsischen Lausitz vor gut 20 Jahren die ersten Wölfe aus der baltischpolnischen Population; sie besiedeln heute Deutschland in einem weiten Bogen ausgehend von Sachsen im Osten und breiteten sich bis an die Atlantikküste aus. Die Tiere zogen nach Dänemark, erste Pionierpaare erreichten die Niederlande und Belgien. In Richtung Osten besiedelten sie von der Lausitz aus wieder Polen und Tschechien und in Richtung Süden breiteten sie sich nach Bayern und Österreich aus. Dort werden allerdings die meisten von ihnen illegal abgeschossen, weswegen es in Bayern und Österreich noch kaum Rudel gibt. Zur deren Gründung bevorzugen Wölfe Gebiete mit geringen Menschen- und hohen Wilddichten. Daher ist es kein Zufall, dass die Pionierrudel in Deutschland und Österreich auf Truppenübungsplätzen landeten – in der sächsischen Lausitz und im niederösterreichischen Allentsteig. Sonderlich wählerisch sind sie bezüglich ihres Lebensraumes aber nicht. Wölfe brauchen keine Wildnis, sie besiedeln bereitwillig auch Kulturland – und nicht unbedingt immer nur den Wald.
Wölfe sind milde Kulturfolger, die sich auch in land- und forstwirtschaftlich genutzten Gebieten niederlassen. Sie bleiben darin allerdings viel zurückhaltender als etwa Kojoten, Rotfüchse oder Wildschweine. Während Letztere bereits im Zentrum von Berlin siedeln, ist das von Wölfen nicht zu erwarten. Damit Wölfe zurückhaltend bleiben, braucht es den regelmäßigen Beschuss nicht, wie uns die Jägerschaft und ihre Lobby ständig einzureden versuchen. Diese Behauptung wird durch keinerlei wissenschaftliche Evidenz gestützt. Vielmehr sind Wölfe von ihrer Natur her zwar sehr neugierig, aber auch sehr scheu-zurückhaltend Neuem gegenüber. Wie im dritten Teil dieses Buches ausgeführt wird, sind Wölfe im Gegensatz zu Hunden leicht von der für sie unwägbaren Reizüberflutung in einer menschlichen Kulturumgebung zu überfordern. Dagegen ertragen Hunde den Jahrmarkt menschlicher Eitelkeiten problemlos. Wölfe können das nicht und gewöhnen sich auch nicht ohne Weiteres daran im Gegensatz zu den viel anpassungsfähigeren Füchsen oder Kojoten. Was nicht bedeutet, dass sich Jungwölfe nicht auch gelegentlich Menschen und ihre Siedlungen aus der Nähe anschauen. Wölfe sind aber gar nicht gut darin, einen städtischen und menschennahen Lebensstil als Tradition an ihre Nachkommen weiterzugeben. Allerdings sollte man bei Wölfen niemals nie sagen bzw. sich nicht allzu sehr auf das „typisch Wölfische“ verlassen. So etwa lebt seit 2016 ein Wolfsrudel am südlichen Stadtrand von Rom – durchaus passend zum Gründungsmythos der Stadt. Es ist aber ziemlich sicher nicht damit zu rechnen, dass sie sich am römischen Forum Romanum ansiedeln werden, oder nahe am Berliner Brandenburger Tor.
Das Gezerre um den Wolf
Eine Mehrheit der Bevölkerung in Österreich, Deutschland und generell in Europa steht der Rückkehr der Wölfe positiv gegenüber. Allerdings leben wir aufgrund einer Gemengelage von einer sich verschlechternden Diskussionskultur, des Vertrauensverlustes in die Politik, der Bildungskrise und der Blasenbildung in den sogenannten sozialen Medien etc. in immer polarisierbareren Gesellschaften. Das gilt auch für das Thema Wolf, der noch dazu von allen Wildtieren immer schon am meisten „politisch“ vereinnahmt wurde und polarisierte. Während eine Mehrheit eher lauwarm pro Wolf eingestellt ist, tritt nur eine kleine Minderheit aktiv zum Schutz der schwindenden Arten und auch des Wolfes an. Sehr engagiert etwa im WWF oder auch in speziellen Wolfs-NGOs, wie in der regen deutschen Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e. V. oder im Schweizer Verein CHWOLF. Eine solche NGO fehlt in Österreich, entsprechend schlecht geht es auch den Wölfen. Am anderen Ende des Spektrums der Meinungen findet sich eine Minderheit teils sehr radikaler Wolfsgegner.
Verständlich, dass Weidetierhalter keine Freude mit der Rückkehr der großen Beutegreifer haben. Sie wirtschafteten die vergangenen 150 Jahre wolfsfrei und vertreten die aus ihrer Sicht wohl berechtigte Ansicht, ihre Vorfahren hätten es geschafft, die Wölfe auszurotten, wofür sie gute Gründe gehabt hätten; und nun würden ihnen „die Tierschützer“ wieder den Wolf aufs Auge drücken. Weswegen sich viele von ihnen, besonders im Alpenraum, dem Herdenschutz grundsätzlich verweigern, weil sie fürchten, damit die Existenz des Wolfes anzuerkennen. Daraus spricht nicht nur Sorge um die materielle Existenz, es schwingt auch die Angst mit, der Wolf könnte wieder zur Bedrohung für den Menschen werden. Das ist im Moment zwar nicht zu befürchten, ist aber dennoch nicht so irrational, wie es scheinen mag und wird später im Buch noch Thema sein.
Vor allem aber wird der Wolf zum beinahe willkommenen Sündenbock für erlittene Einbußen und Demütigungen durch eine überzogene Bürokratie und verfehlte Landwirtschaftspolitik. Die Internationalisierung im Lebensmittelbereich, die beherrschende Marktstellung des Handels bewirken neben andere Faktoren, dass Bauern immer mehr von Subventionen statt den viel zu geringen Erzeugerpreisen leben müssen. Der Wolf wird daher fälschlicherweise allenthalben zum Totengräber der Weidewirtschaft erklärt, besonders in den Alpen. Dem widerspricht der seit Jahrzehnten anhaltende Trend zur Aufgabe landwirtschaftlicher Betriebe, auch ohne Zutun des Wolfes. Vielfach herrscht ein Gefühl des Ausgeliefertseins an eine Mehrheit der Städter und „Eliten“, welche die Parlamente beherrschen, sich welt- und naturentfremdet über die Rückkehr der Wölfe freuen und auf deren strengen Schutz beharren.
Kein großes Verständnis muss man dagegen für die Skepsis der Jäger hinsichtlich der Rückkehr der Wölfe haben. Weil ihnen das viel zu viele Wild in unseren Wäldern nicht gehört, kann ihnen der Wolf auch keinen Schaden zufügen. Wölfe wirken sich zudem positiv auf die Biodiversität und die Gesundheit der Wildbestände aus. Darauf und auf die Argumente von Landwirtschaft und Jagd wird später noch eingegangen. Über die letzten Jahre fand man beinahe täglich Anti-Wolf-Folklore in den europäischen Medien, vor allem in den regionalen Zeitungen. Es gab Mahnfeuer und -wachen, Fackelzüge und Demonstrationen gegen den Wolf von Tirol bis Norddeutschland und man schürt die Angst vor dem Wolf. Man könnte glauben, der Wolf wäre das Ende des christlichen Abendlandes. Die Erzählung ähnelt verdächtig der Panikmache im Zusammenhang mit den „Flutwellen“ der Zuwanderer. Es wird dummdreist manipuliert, etwa indem Land- und Forstwirte Warntafeln aufhängen, man befände sich im „Wolfsgebiet“ – Betreten auf eigene Gefahr. Selten so gefürchtet!
Diese seltsame Folklore macht zumindest in Österreich auch vor dem offenen Aufruf zum Gesetzesbruch nicht Halt, sogar durch führende Politiker: „Die Jäger wissen schon, was zu tun ist“, heißt es augenzwinkernd in volkstümlichen Reden. Solche Aussprüche in der Öffentlichkeit waren von einem Salzburger Landeshauptmann, einem ehemaligen Umweltminister und anderen Mitgliedern der Bundesregierung zu hören. Und natürlich von hohen Repräsentanten der Jägerschaft. Eine solche Anstiftung zum Gesetzesbruch von ganz oben hat schon eine besondere Qualität. So wird geschossen, geschaufelt und geschwiegen, was das Zeug hält. Die meisten Wölfe verschwinden spurlos, die grassierende und kaum geahndete Wildtierkriminalität gilt als Hauptfaktor für die im Gegensatz zu den Nachbarländern nur sehr langsame Rückkehr in Österreich. Im August 2019 etwa wurde im Tiroler Sellrain ein abgeschossener Wolf ohne Kopf gefunden. Auch in Deutschland steigen mit der Zahl der Wölfe die illegalen Abschüsse, aber sie sind nicht bestandsgefährdend wie in Österreich.
Die Spitze der Anti-Wolfs-Folklore bilden aber sicherlich die nicht EU-rechtskonformen Verordnungen und Bescheide der Landesregierungen in Tirol, Kärnten und Salzburg. Ein besonderes Gustostück leistete sich die Tiroler Landesregierung, eine schwarz-grüne Koalition. Der Wolf 118MATK italienischer Abstammung hatte bis Mitte Oktober 2021 genetischen Nachweisen zufolge an die 40 Schafe in verschiedenen Almgebieten gerissen. Daraufhin fasste die Regierung Mitte Oktober den Beschluss, den Wolf im Fall weiterer Schäden abschießen zu lassen. Als dann der Befund seiner Urheberschaft für weitere tote Schafe kam – die er wohlgemerkt bereits vor dem erwähnten Beschluss gerissen hatte –, gab man ihn am 22. Oktober 2021 für 60 Tage zum Abschuss frei. Damit verstößt dieser Gesetzgeber gleich mehrfach gegen gültiges Recht. Der an und für sich ganzjährig geschonte Wolf ist laut FFH-Richtlinie nur dann zum „Problem“ zu erklären und zum Abschuss freizugeben, wenn er sich an sachgerecht geschützten Nutztieren vergreift. Keines der getöteten Schafe war aber geschützt. Zudem verlangt ein gesetzeskonformer Abschuss, dass der Wolf vorher individuell identifiziert werden muss. Wie soll das gehen? Ist dem Wolf sein Name ins Gesicht geschrieben?
Der Erlass gibt also das Feuer auf jeden Wolf frei, was ganz klar gegen bestehendes Recht verstößt. Eine weitere Würze dieses Falles liegt darin, dass sich die Politik auf die Empfehlung einer von ihr zusammengestellten Expertenkommission beruft. Kleiner Schönheitsfehler nur, dass die Namen dieser „Experten“ geheim gehalten werden, mit der offiziellen Begründung des aufgeheizten Klimas im Lande – sogar Morddrohungen hätte es gegeben. Das geht aus mehreren Gründen gar nicht in einer liberalen Demokratie: Erstens sollte man Erpresser dingfest machen, aber keinesfalls die Politik nach ihren Wünschen ausrichten. Zweitens spricht es nicht für die Zivilcourage der Leute in der Kommission. Als gelernter Österreicher kann man aus guten Gründen kein Vertrauen zu einer solchen Feigenblatt-Kommission haben. Glaubwürdigkeit braucht Namen und Kompetenz. Drittens ist völlig klar, dass eine von einem solchen Gremium ausgesprochene Abschussempfehlung nicht FFH-konform ist. Bitte den Leitfaden der Europäischen Kommission zur FFH-Richtlinie vom 12. Oktober 2021 lesen! Tatsächlich wurde die Tiroler Verordnung von einem österreichischen Gericht Mitte November 2021 aus formalen Gründen wieder gekippt. Und zum Drüberstreuen: Die Bauern sollen finanziell entschädigt werden, obwohl sie ihre Schafe nicht geschützt hatten. Eigentlich wären sie wegen der Verletzung ihrer Aufsichtspflicht nach österreichischem Tierschutzgesetz zu belangen.
Wohl um die laute Klientel zu beruhigen, verstößt man bewusst gegen geltendes Recht, verfügt den Abschuss von „Problemwölfen“, die keine sind, und definiert wolfsfreie Zonen, in denen Herdenschutz angeblich nicht möglich ist, wo daher jeder Wolf geschossen werden muss – auf die makellose Empfehlung der geheimen Kommission hin. Dabei geht es aber nicht bloß um die eher technische Frage, ob man Wölfe durch Abschuss regulieren muss, die noch zu diskutieren sein wird. Wölfe ähneln in ihrer sozialen Organisation und Klugheit sehr uns Menschen. Zumindest sensible Gemüter könnten daher fragen, ob man Wölfe tatsächlich einfach über den Haufen schießen muss. Die gewählten Hüter des Rechtsstaates lassen es immer wieder darauf ankommen, durch unabhängige Gerichte korrigiert zu werden. Der Wolf stellt damit unseren demokratischen Rechtsstaat auf die Probe. Wenigstens in Österreich hat man diese Probe bislang nicht bestanden.
Wölfe waren in Europa nie ganz weg
An den Rändern Europas gab es im 19. und 20. Jahrhundert durchgehend Wölfe. Manche davon nur in Restpopulationen, wie etwa in den italienischen Abruzzen. In Frankreich wurden sie erst in den 1930er-Jahren ausgerottet. Trotz teils erbitterter Verfolgung verschwanden Wölfe nie ganz aus Spanien. Dort hielten sie sich im galicischen Grenzgebiet zu Portugal und in einigen zentralen Sierras. Wölfe gab es immer auch trotz rigorosem Abschuss im Norden Skandinaviens. Von dort wanderten sie in den 1970ern wieder in den Süden Schwedens ein, wo sie sich vor allem im bergigen Grenzgebiet zu Norwegen festsetzten. Wenn man aus dem dicht besiedelten Mitteleuropa kommt, wähnt man sich in den kaum besiedelten borrealen Nadelwäldern Schwedens, Norwegens und Finnlands in unberührter Natur. Leider täuscht dieser Eindruck, denn die Jagd hat dort traditionell einen großen Stellenwert. Es wird viel zu viel geschossen, seit es Motorschlitten gibt, auch unter Einsatz von Hundemeuten, zu viele Wölfe und Vielfraße im Winter. Man folgt den Spuren, bis man zum Schuss kommt. Das Spuren per Motorschlitten ist zwar verboten, wird aber praktiziert.
Die Wolfspopulation im Süden Skandinaviens stagniert auch, weil man nicht mit EU-Recht vereinbare Abschussquoten festsetzt, die etwa dem jährlichen Zuwachs entsprechen. Zudem leiden diese zu kleinen Populationen unter Inzuchtproblemen, weil die Rentiere haltenden Samen den Nord-Süd-Wanderkorridor dichtmachen, indem sie dort alles abschießen, was nach Wolf aussieht. Ganz legal übrigens, denn als Indigene dürfen sie das. Was früher zum Schutz ihrer domestizierten Rentiere sinnvoll gewesen sein mag, läuft zu Zeiten der Motorschlitten und Präzisionsgewehre auf die Ausrottung der großen Beutegreifer hinaus. So kollidiert heute das traditionelle Jagdprivileg der skandinavischen Indigenen frontal mit dem Artenschutz.
Auch aus den baltischen Staaten und aus den nördlichen Teilen Polens, Weißrusslands und Russlands verschwanden Wölfe nie ganz. Sie hielten sich im weiten Bogen der Karpaten, von der slowakischen Tatra über das rumänische Zentralmassiv bis in ihre südöstlichen Ausläufer in Serbien. Rumänien war immer Kerngebiet. Die Zahl der Wölfe, wie auch der Bären, sank aber seit den unseligen Zeiten der kommunistischen Diktatur, obwohl Wölfe wie anderswo in Europa auch in Rumänien durch die nationalen und EU-Bestimmungen unter strengem Schutz stehen. Hauptursache ist in diesem korruptionsgebeutelten Land wahrscheinlich die illegale Jagd. Überlebensfähige Wolfspopulationen gab es immer auch auf dem Balkan – die sogenannte „dinarische Population“, von Slowenien bis Albanien und Griechenland. Da...