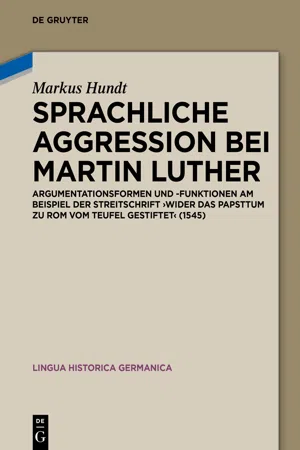
Sprachliche Aggression bei Martin Luther
Argumentationsformen und -funktionen am Beispiel der Streitschrift "Wider das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet" (1545)
- 244 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Sprachliche Aggression bei Martin Luther
Argumentationsformen und -funktionen am Beispiel der Streitschrift "Wider das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet" (1545)
Über dieses Buch
Die Frühe Neuzeit ist bekannt dafür, dass sich die Kontrahenten in konfessionellen Streitfragen gegenseitig heftig attackierten. Ein herausragender Vertreter dieser Form der Auseinandersetzung war Martin Luther. In den zahlreichen von ihm verfassten Streitschriften zeigt er sich auch als großer Polemiker. Wie diese Art der sprachlich aggressiven Argumentation funktioniert, wird in der vorliegenden Studie detailliert vorgeführt. Gegenstand der Untersuchung ist die wohl prominenteste Streitschrift Luthers von 1545 "Wider das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet". Auf der Basis der "neuen Rhetorik" mit ihrer deutlich weiter gefassten Definition dessen, was unter Argumenten und Argumentation verstanden werden kann, konnten mehr als 60 verschiedene Argumentationsformen eruiert werden, die verschiedene Argumentationsfunktionen erfüllen. Die Studie möchte damit sowohl einen Beitrag zur Argumentationsanalyse und einen Vorschlag zur Modellierung von Argumentationen anbieten als auch eine praktische Detailanalyse sprachlicher Aggression, die nachvollziehbar macht, worin genau der in der Forschung häufig adressierte Grobianismus dieser Texte liegt.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
1 Erkenntnisinteresse
Luther füllte die Rolle des Streittheologen, indem er sich der Stilmittel der literarischen Polemik bediente. Dazu gehörte der Einsatz gezielter Grobheiten und Verunglimpfungen, wie er in der zeitgenössischen Streitliteratur an der Tagesordnung war. Luther hob sich dabei durch den Erfindungsreichtum seiner polemischen Sprache und die Bewußtheit ihres Einsatzes von der Norm ab.
2 Forschungslage und Forschungshypothesen
Der in der argumentationsanalytischen Tradition seit Toulmin verwendete Begriff (argumentieren) hat hingegen eine weitere Bedeutung. Hier wird gerade darauf abgehoben, dass eine streng syllogistische, deduktive Argumentation, die eher zur Überprüfung vorliegender Schlüsse als zum Erkenntnisgewinn beitragen kann, nicht als Maßstab für reale Alltagsargumentationen taugt. Konstitutiv für eine Argumentation ist demnach weniger ihre Form als ein inhaltliches Kriterium: der Anspruch des Argumentierenden, etwas Strittiges bzw. für strittig Gehaltenes zu untermauern, zu stützen.(Niehr 2017: 167)
The schemes we shall try to examine – which can also be considered as loci of argumentation because only agreement on their validity can justify their application to particular cases – are charaterized by processes of association and dissociation.By processes of association we understand schemes which bring separate elements together and allow us to establish a unity among them, which aims either at organizing them or at evaluating them, positively or negatively, by means of one another. By processes of dissociation, we mean techniques of separation which have the purpose of dissociating, separating, disuniting elements which are regarded as forming a whole or at least a unified group within some system of thought: dissociation modifies such a system by modifying certain concepts which make up its essential parts.(Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971: 190)
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Vorwort
- Abbildungen
- Tabellen
- 1 Erkenntnisinteresse
- 2 Forschungslage und Forschungshypothesen
- 3 Methodik – Argumentationsanalyse auf der Basis der neuen Rhetorik
- 4 Der Inhalt und die Streitfragen
- 5 Argumentationsmuster – formal
- 6 Argumentationsfunktionen
- 7 Fazit
- Anhang