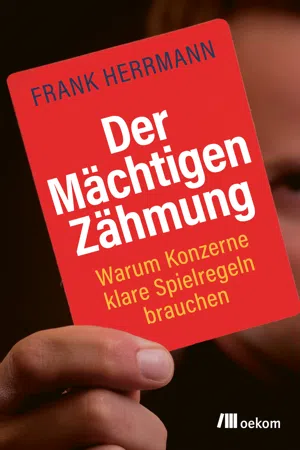
- 224 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Faire Löhne, nachhaltige Produkte, klimaneutrales Wirtschaften – viele Konzerne geben vor, die Umwelt zu schützen und Menschenrechte einzuhalten. Doch zwischen Versprechen und Realität klaffen meist große Lücken, globale Ungleichheiten nehmen weiter zu. Die Politik hat diese Entwicklungen begünstigt. Jahrzehntelang hat sie auf Eigenverantwortung der Unternehmen und ihr freiwilliges Engagement gesetzt. Frank Herrmann ist überzeugt: Freiwilligkeit reicht nicht. Wir brauchen mehr Anreize für nachhaltiges Handeln, höhere Standards und bessere Möglichkeiten, Regelverstöße auch zu ahnden.
Ein Plädoyer für entschiedenes politisches Handeln, das Ausbalancieren von Wirtschaftsmacht und das Übernehmen von Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Der Mächtigen Zähmung von Frank Herrmann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Politik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Kapitel 1
Globale Unternehmen
Viele Freiheiten, wenig Verantwortung
»Die Konzerne sind globale Organisationen, die nicht von einem einzigen Staat abhängen. Ihre Aktivitäten werden nicht kontrolliert. Sie sind keinem Parlament und keiner anderen Institution des Allgemeininteresses zur Rechenschaft verpflichtet. Kurz, die ganze politische Weltordnung wird unterminiert.«
Salvador Allende, Chiles Präsident von 1970–1973, Rede vor den Vereinten Nationen am 4. Dezember 1972
Size matters – auf die Größe kommt es an. Das trifft nicht nur auf Parkplätze oder Lottogewinne zu, sondern auch auf globale Konzerne. International operierende Unternehmen wie Google, Walmart oder Volkswagen sind riesig. Und mächtig. Und die »Mega-Companies« wachsen weiter. Gefräßig verschlingen sie Start-ups und Konkurrenten oder fusionieren zu immer größeren Unternehmensgruppen mit immer größerer Marktdominanz.1
Begünstigt hat das Entstehen großer, weltweit operierender Konzerne eine unzureichend regulierte Globalisierung. Fusionen und Übernahmen ließen nur noch schwer zu durchschauende Firmengeflechte entstehen. Das Spielfeld der Konzerne ist der sogenannte freie Markt, ein Geflecht aus bi- und multilateralen Handelsabkommen, Zollsystemen, Freihandelszonen, Normen und Standards. »Die Globalisierung der Märkte hat in den vergangenen Jahrzehnten einen Typus von multi- oder sogar transnationalen Konzernen hervorgebracht, die mit ihren weltumspannenden Geschäftsaktivitäten in fast jeder Hinsicht Grenzen sprengen«, schreibt der Schweizer Wirtschaftswissenschaftler Peter Ulrich.2 Diese Entwicklung sei in der frühen Globalisierungseuphorie vorwiegend begrüßt worden, doch zeigten sich nun immer mehr kaum vorausgesehene, zunehmend als problematisch empfundene strukturelle Auswirkungen.
Der »freie Markt« ist ein Mythos. Es gab ihn nie – und es wird ihn wohl auch nie geben. »Von einer menschlichen Globalisierung mit verlässlichen Regeln«, wie sie der frühere deutsche Bundespräsident Horst Köhler wünschte, scheint die Welt noch weit entfernt zu sein. All das interessiert Konzerne nur am Rand. Es läuft gut für sie.
Der Einfluss global agierender Konzerne hat im 21. Jahrhundert infolge ihrer wachsenden Marktmacht massiv zugenommen. Und der Trend hat sich nach 2010 noch beschleunigt, so der Internationale Währungsfonds (IWF).3 Immer weniger, aber zugleich immer größere Konzerne besitzen enorme Marktanteile in so gut wie allen Wirtschaftssektoren. Besonders eindrucksvoll belegen das Digitalkonzerne. So erreichte die Internetsuchmaschine Google im September 2021 eine Marktdominanz von 89,88 Prozent bei Mobilgeräten und 78,39 Prozent bei Desktop-Geräten.4 In Deutschland kommt die Bürosoftware MS-Office auf einen Marktanteil von rund 85 Prozent.5 Rund 70 Prozent aller Smartphones werden von nur fünf Herstellern gefertigt.6 Der Internethändler Amazon macht in Deutschland mehr Umsatz als seine neun umsatzstärksten Konkurrenten zusammen.7 Und die drei Unternehmensgruppen Booking Group (booking.com, agoda), Expedia Group (expedia, hotels.com, eBookers, Orbitz Travel) und HRS Group teilen sich fast den gesamten Markt (92 Prozent) der Online–buchungsportale für Ferienunterkünfte in Europa. Der Marktanteil des Branchenprimus booking.com allein beträgt dabei fast 70 Prozent.8 Ökonomen zufolge steigt ab einer Marktkonzentration von 40 Prozent die Gefahr, dass Unternehmen den Lieferanten die Preise diktieren können. Sind es mehr als 60 Prozent, spricht man bereits von einem stark konzentrierten Markt.9
Auf dem Nahrungsmittelmarkt ist das längst der Fall: Das globale Ernährungssystem – angefangen von den Saatguterzeugern und Landmaschinenherstellern über die Fleischverarbeiter oder Molkereien bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel (s. Kapitel »Aldi, Lidl, Netto & Co. – Umsatz um jeden Preis«) – befindet sich in der Hand weniger Global Player.10 Im Agrar- und Ernährungssektor haben mit den Fusionen von Kraft und Heinz, Dow und Dupont, Anheuser Busch InBev und SAB Miller sowie Bayer und Monsanto fünf der weltweit größten Unternehmensübernahmen der vergangenen Jahre stattgefunden.11 Nach den Megafusionen der letzten Jahre kontrollieren nur noch vier Konzerne mehr als 60 Prozent des kommerziellen Saatgutmarktes.12 Und auch die enorme Markenvielfalt in den Regalen der Supermärkte darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich nur ein knappes Dutzend großer Lebensmittelkonzerne, darunter Nestlé, Unilever, Mars und Coca-Cola, diesen Markt unter sich aufteilen.13
Konzerne: reicher als viele Staaten
Die Größe der Konzerne manifestiert sich auch in immer höheren Börsenwerten – unbeeindruckt von Corona oder der Klimakrise. Ende März 2021 waren die 100 weltweit wertvollsten Unternehmen 31,7 Billionen Dollar wert – fast 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.14 Der Elektronikriese Apple, 1976 von Steve Wozniak, Steve Jobs und Ron Wayne in einer Garage gegründet, sprengte Anfang 2022 als weltweit erstes Unternehmen die Drei-Billionen-Dollar-Marke – in etwa die jährliche Wirtschaftsleistung Großbritanniens.15 Apple gehört zusammen mit Saudi Aramco, Amazon und Microsoft zu den weltweit wertvollsten Unternehmen.16 Wären diese Konzerne Länder, würden sie die meisten Staaten an Wirtschaftsleistung übertreffen. Zu den 200 reichsten Körperschaften der Welt zählten 2018 nach Angaben der Initiative Global Justice Now mit 157 Konzernen weit mehr private Unternehmen als Staaten. So hätten Walmart, Apple und Shell mehr Reichtum angehäuft als wohlhabende Länder wie Russland, Belgien und Schweden.17
Noch verlaufen die Unternehmenskonzentration und Marktmacht in Deutschland – anders als etwa in den USA – moderat, findet die Monopolkommission. Sie sah Mitte 2020 »für die Unternehmenskonzentration in Deutschland weiterhin keinen besorgniserregenden Trend und damit keinen unmittelbaren wettbewerbspolitischen Handlungsbedarf«.18 Das sehen rund dreißig Organisationen der Zivilgesellschaft, darunter Germanwatch, Lobbycontrol, Foodwatch und die Bürgerbewegung Finanzwende, deutlich anders: Sie forderten 2021 in einem gemeinsamen Positionspapier, große Konzerne zu entflechten (s. Kapitel »Entflechten – aber wie?«), denn deren übergroße Macht schade der Demokratie.19 Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hält die »Zusammenballung wirtschaftlicher Macht bei wenigen global aufgestellten Großunternehmen und die massive Konzentration wirtschaftlicher Ressourcen in den Händen extrem reicher Vermögensbesitzer« sogar für den wichtigsten Faktor, »der die Demokratie in den meisten westlichen Ländern außer Kraft gesetzt hat«.20 Mit negativen Folgen für Menschenrechte und Umwelt. Denn Großkonzerne nutzen ihren Einfluss zunehmend, um Lieferanten Preise aufzuzwingen, Konkurrenten auszuschalten und Politiker sowie Endverbraucher zu beeinflussen. Die von ihnen verursachten sozialen und ökologischen Kosten wälzen diese Unternehmen auf die Gesellschaft weltweit ab. Doch einen Faktor hatten auch sie nicht auf der Rechnung.
Ändert Corona die Spielregeln?
Das Virus SARS-CoV-2 hat die Weltwirtschaft ordentlich durchgeschüttelt. Weltweit fielen Ernten aus, standen Fließbänder still, flogen kaum noch Flugzeuge und fuhren nur wenige Lastwagen und Schiffe. Die Folgen für die internationalen Lieferketten bekam (und bekommt) auch die deutsche Wirtschaft zu spüren (s. Kapitel »Wenige Regeln, noch weniger Kontrolle«). In seinem Hauptgutachten 2020 urteilt die Monopolkommission, ein unabhängiges Gremium, das die Bundesregierung und die gesetzgebenden Körperschaften auf den Gebieten der Wettbewerbspolitik, des Wettbewerbsrechts und der Regulierung berät: »Die Corona-Krise wird die deutsche Wirtschaft nachhaltig verändern« – hin zu noch mehr Konzentration.21 Zu erwarten sei, »dass es insgesamt und in einzelnen Wirtschaftsbereichen zu einem Konzentrationsanstieg mit der Folge einer abnehmenden Wettbewerbsintensität kommen wird«.22 Die Marktmacht der großen Digitalunternehmen werde zunehmen und der direkte staatliche Einfluss auf die Unternehmen wachsen, ist das Gremium überzeugt.
Was das bedeutet, ist abzusehen: Je größer, stärker und einflussreicher große Unternehmen werden, desto schwieriger wird es für Politik und Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass sie Menschen-, Arbeits-, Umwelt- oder Verbraucherrechte befolgen und einhalten. Wir müssten also dringend einschreiten. Wir tun es aber nicht. »Und der Grund dafür, dass wir nicht handeln, sind das große Geld und die großen Unternehmen, und es ist fehlende Ehrlichkeit«, meint US-Ökonom Jeffrey Sachs, unter anderem Sonderberater für die Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen.23
Das auf kurze, schnelle Erfolge ausgerichtete Wirtschaften hat Mark Carney, früherer Chef der britischen Zentralbank, einmal als »Tragik des kurzfristigen Horizonts« bezeichnet.24 Es mag Investoren gefallen, doch für die Zukunft von Mensch und Umwelt ist es pures Gift.
Globale Wertschöpfungsketten – störanfällig, unfair und zu lang
Ich war noch Student, als ich in den 1980er-Jahren erstmals mit Wertschöpfungs- und Lieferketten in Berührung kam. Doch wie komplex das Thema ist und wie es sich auf Mensch und Umwelt auswirkt, wurde mir erst später bewusst. In ihrer 1992 veröffentlichten Diplomarbeit sezierte Stefanie Böge den Weg eines Erdbeerjoghurts – von der Ernte der Früchte bis zum Supermarkt. Schon damals hatte jeder Becher, bis er im Regal stand, eine Strecke von rund 9.000 Kilometern zurückgelegt: Die Erdbeeren stammten aus Polen, die Bakterien aus Schleswig-Holstein, die Aludeckel aus dem Rheinland. Auch der Zucker, die Etiketten, die Transportfolie und die Palette hatten lange Wege hinter sich.25
Seitdem hat die Globalisierung immer mehr, immer komplexere und immer längere Wertschöpfungsketten hervorgebracht. So legt beispielsweise eine Jeans auf dem Weg von der Baumwollplantage bis zum Modegeschäft 50.000 Kilometer und mehr zurück; für Volkswagen produzieren weltweit mehr als 40.000 Zulieferer, die wiederum von zahllosen weiteren Zulieferern auf der ganzen Welt abhängen; ein Passagierflugzeug besteht aus mehreren Millionen Einzelteilen. Da fällt es schwer, sich die Komplexität der dahinter existierenden globalen Lieferketten überhaupt vorzustellen. Möglich gemacht haben die Entwicklung hin zu immer globaleren Wertschöpfungsketten zum einen die Liberalisierung der Güter- und Finanzmärkte und der damit verbundene Abbau von Zollschranken und nichttarifären Handelshemmnissen wie etwa Importquoten. Dadurch vereinfachte sich der Austausch von Zwischenprodukten, Dienstleistungen und Investitionen. Zum anderen erleichterten digitale Lösungen, neue Verkehrswege, günstige Transporte und bessere Logistik den globalen Warenhandel. Parallel entstanden einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen wie beispielsweise internationale Hygienestandards oder die globale Regelung von Patenten und Eigentumsrechten. Nur unter diesen Voraussetzungen und unter Ausblendung der negativen Auswirkungen von Ressourcenabbau, Produktion und Konsum für Mensch und Natur kann es überhaupt sinnvoll scheinen, den gesamten Planeten als Produktionsstätte und Ressourcenlager zu betrachten.
Das ist auch für Deutschland als eine der weltweit größten Exportnationen von Bedeutung. Das Land ist in besonderem Maß von globalen Lieferketten abhängig. Während bei uns laut Ifo-Institut rund 17 Prozent der Produktion durch internationale Wertschöpfung entstehen, liegt der Wert im globalen Durchschnitt bei gerade einmal 12 Prozent.26 Ein knappes Drittel aller deutschen Einfuhren entfallen auf Vorleistungsgüter, die dann in deutschen Betrieben veredelt und teilweise exportiert werden.
Mit der Globalisierung haben sich die Wertschöpfungs- und Lieferketten vor allem seit Beginn des 21. Jahrhunderts immer mehr internationalisiert und fragmentiert.27 Vor allem große Konzerne nutzen die sich von Land zu Land unterscheidenden Wirtschaftsregeln bei der Wahl ihrer Produktionsstandorte aus. Zugute kommen ihnen dabei unter anderem das globale Lohngefälle, unterschiedliche Rechts- und Steuersysteme, Investitionshilfen, staatliche Subventionen sowie privilegierter Zugang zu den Kapitalmärkten.
»[A]rbeitsintensive Tätigkeiten [werden] häufig in Länder[n] mit niedrigen Löhnen, gewinnbringende Tätigkeiten […] in Länder[n] mit geringen Steuern und technologieintensive Tätigkeiten in Ländern mit einer gut gebildeten Bevölkerung konzentriert«, schreiben die Wissenschaftler Jakob Kapeller und Claudius Gräbner in ihrer Untersuchung der Konzernmacht in globalen Lieferketten.28 Das führe dazu, dass Südamerika immer stärker vom Abbau etwa von Rohstoffen wie Gold, Kupfer oder Zink lebe, Südostasien billige Arbeitskräfte mit niedrigen arbeitsrechtlichen Standards und einem moderaten Bildungsniveau anbiete und sich kleinere Ökonomien im globalen Wettbewerb zusehends zu Schattenfinanzplätzen entwickelten (s. Kapitel »Steuertricksereien auf Kosten der Allgemeinheit«).
Wenige Regeln, noch weniger Kontrolle
Welche Mindeststandards zum Schutz der Umwelt und welche Menschenrechte für Konzerne gelten, ist durchaus geregelt (s. Kapitel »Globale Rahmenvereinbarungen – zahnlose Tiger«), allerdings ...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Widmung
- INHALT
- Einleitung
- Kapitel 1: Globale Unternehmen
- Kapitel 2: Ethik, Moral und Freiwilligkeit
- Kapitel 3: Das verwaiste Ruder
- Kapitel 4: Zivilorganisationen
- Kapitel 5: (Globales) Gleichgewicht
- Ausblick
- Anmerkungen
- Über den Autor