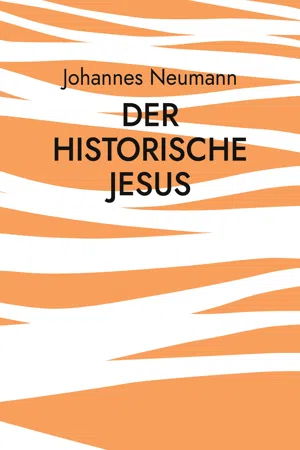![]()
1. Die Biographie
1.1. Sohn Davids?
Familie und soziale Prägung
Stammte Jesus aus einer Handwerkerfamilie in Nazareth oder war er der Sohn alteingesessener und vermögender Grundbesitzer in Bethlehem? Die antiken Gesellschaften waren sozial weit aufgefächert, von den ungebildeten Sklaven und Tagelöhnern über eine bäuerliche und städtische Mittelschicht mit eingeschränkten Bildungschancen bis zur sozialen Oberschicht und Bildungselite, deren Mitgliedern alle Möglichkeiten offen standen. Die führenden Familien einer Stadt und eines Landes müssen wir uns als eine extrem kleine exklusive Bevölkerungsgruppe vorstellen, die die Geschicke einer Stadt und eines Landes lenkte und die die Kultur und Bildung dominierte. Ein sozialer Aufstieg war möglich, aber meist nur über mehrere Generationen durchführbar, weil die Bildungssituation und die Partnerwahl stark von der sozialen Schicht abhängig waren. Wenn sozialer Aufstieg ungewohnt schnell möglich war wie in der neuen galiläischen Hauptstadt Tiberias, die um 20 n. Chr. gegründet wurde, rief das den Unwillen der Wohlhabenden hervor: Josephus kritisiert, dass in der Gründungsphase von Tiberias sogar hergelaufene Sklaven als Bürger Eigentum erhielten, Ant 18,2,3. Wenn jemand eine hohe Bildung oder Ausbildung erworben hatte wie Manaen in Antiochia, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, Acta 13,1, dann ist das die Ausnahme und der Erwähnung wert.
Kein Bericht über den sozialen Aufstieg
Das Leben des Fabeldichters Aesop (ca. 620-560 v. Chr.) ist in vieler Hinsicht mit dem Leben Jesu vergleichbar. Aesop wurde als Sklave geboren, konnte durch Mutterwitz und ein freundliches Wesen auf sich aufmerksam machen, wurde berühmt, unternahm Reisen, zuletzt ging er nach Delphi, wo er als Tempelräuber und Gotteslästerer angeklagt wurde. Die Delphier stürzten ihn von einem Felsen, angeblich war es ein Justizmord. Der Aesop-Roman, der in der frühen römischen Kaiserzeit entstand, widmet einen großen Teil seiner Darstellung dem sozialen Aufstieg vom stummen, missgebildeten Sklaven zum geachteten Beamten. Wolfgang Müller schreibt in der Einleitung zu einer Ausgabe des Romans: Ein zunächst stummer phrygischer Sklave - nach anderen Quellen soll er in Thrakien geboren sein -, Landarbeiter, mißgestaltet und häßlich, doch begabt mit Intelligenz und Gerechtigkeitssinn, Schlagfertigkeit und Witz, wird zum Lohn für seine Freundlichkeit, die er einer Priesterin der ägyptischen Göttin Isis erweist, von dieser mit der Sprache beschenkt. Da sein Verstand und seine Ehrlichkeit ein mahnender lebender Vorwurf für die menschliche Unzulänglichkeit sind, verkauft man ihn an einen Sklavenhändler, der ihn bald auf Samos an den Philosophen Xanthos abgibt. Hier wird der Diener bald zum geistig überlegenen Partner, zuletzt sogar zum Retter seines Herrn, der ihn endlich freigeben muß, nachdem sich der Sklave als kluger politischer Ratgeber der Samier gegenüber dem Lyderkönig Kroisos bewährt hatte.
Bald reist Äsop in diplomatischem Auftrag zu Kroisos, wo er ehrenvoll aufgenommen wird; er ist jetzt durch seine Weisheit ein berühmter Mann geworden, besucht fremde Länder und erlangt als / Wesir das höchste Staatsamt in Babylon.12
Vergleicht man diese Geschichte des sozialen Aufstiegs mit der Geschichte Jesu in den Evangelien, fällt auf, dass es von Jesus keine Erzählungen über einen sozialen Aufstieg gibt. Schon seine Geburt wird von den Sternen(göttern) angezeigt und von Engeln verkündet. Beim Beginn seines öffentlichen Wirkens kann er es sich leisten, die angebotene Herrschaft über die Reiche der Welt auszuschlagen. Am Ende gibt es mit dem Hohenpriester in Jerusalem und dem römischen Statthalter Pilatus Gespräche auf Augenhöhe, obwohl Jesus der Angeklagte ist. Das Fehlen von Erzählungen über den sozialen Aufstieg Jesu lässt nur einen Schluss zu: Es gab ihn nicht, es gab keinen sozialen Aufstieg, weil Jesus von Anfang an zur Oberschicht, zur Elite gehörte. Man könnte überlegen, ob die neutestamentlichen Schriftsteller die Aufstiegsgeschichten unterdrückt haben, aber das ist extrem unwahrscheinlich. Denn die Anhänger Jesu würden voller Stolz seinen sozialen Aufstieg geschildert haben, an dem sie selbst Anteil gehabt hätten. Diese Berichte hätten in den Evangelien ihren Niederschlag finden müssen. Die einzige Aufstiegsgeschichte findet sich in 1 Sam 16, wo die körperlichen Vorzüge Davids (=Jesus') hervorgehoben werden (Vers 12), wo David von Samuel zum König gesalbt wird (Vers 13) und anschließend an den Hof des Königs Saul (=Herodes) kommt (Verse 14-23).13
Im Folgenden werde ich einige Texte des Neuen Testaments, die als Aussagen über die soziale Herkunft Jesu interpretiert werden können, untersuchen.
Der Christuspsalm Philipper 2,6-11
6 Er, der in göttlicher Gestalt war,
hielt es nicht für einen Raub,
Gott gleich zu sein,
7 sondern entäußerte sich selbst
und nahm Knechtsgestalt an,
ward den Menschen gleich
und der Erscheinung nach als
Mensch erkannt.
8 Er erniedrigte sich selbst
und ward gehorsam bis zum Tode,
ja zum Tode am Kreuz.
9 Darum hat ihn auch Gott erhöht
und hat ihm einen Namen gegeben,
Der über alle Namen ist,
10 dass in dem Namen Jesu sich beugen
Sollen aller derer Knie,
die im Himmel und auf Erden
und unter der Erde sind,
11 und alle Zungen bekennen sollen,
dass Jesus Christus der Herr ist,
zur Ehre Gottes, des Vaters.
Der bekannte Christuspsalm aus der Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi ist ein besonderes Kleinod der urchristlichen Überlieferung. Nach allgemeiner Einschätzung vorpaulinisch, gehört er weder dem paulinischen noch dem johanneischen noch dem synoptisch-lukanischen Überlieferungsgut an. Ähnliche hymnische Stücke werden in 1. Timotheus 3,16 und im Brief an die Hebräer 1,3-4 zitiert, aber der Christuspsalm von Philipper 2 ist in seiner Schönheit und Vollständigkeit einzigartig. Von der Struktur her erinnert das Stück an alttestamentliche Psalmen, und der Gedankengang und der Begriff Knechtsgestalt lässt Bezüge zu Jesaja 53, wo vom Knecht Gottes die Rede ist, erkennen. Der Christuspsalm bietet als Ganzes ein wichtiges Stück urchristlicher Theologie, hier geht es um Vers 6 und um die Begriffe in göttlicher Gestalt und Gott gleich zu sein. Der zweite Teil des Textes ab Vers 9 hat einen mythischen Inhalt: In dem Namen Jesu sollen sich die Knie aller (zur Anbetung) beugen, das alle wird ausgeführt: alle im Himmel, alle auf der Erde und alle unter der Erde. Jesus wird also über seine irdische Bedeutung hinausgehoben, auch die Geister im Himmel und die Geister der Verstorbenen unter der Erde sollen Jesus anbeten.
Der Text spielt in der christlichen Dogmatik, genauer in der Präexistenzchristologie, also in der Lehre von der göttlichen Existenz Christi vor seinem Erdenleben, eine Rolle. Es wird folgendermaßen argumentiert: 1. Stufe: Wenn Jesus von allen im Himmel, auf und unter der Erde kultisch verehrt werden soll, heißt das, dass er von Gott in den Himmel erhöht wird. 2. Stufe: Wenn Jesus von Gott in den Himmel erhöht worden ist, dann muss die in den Versen 6-8 beschriebene Erniedrigung Jesu von dort, vom Himmel, ihren Ausgang genommen haben. In der christlichen Dogmatik kommt es darauf an, die dogmatischen Aussagen mit Bibelstellen zu begründen. Dort geht es also darum, die Präexistenzchristologie zu begründen, also die dogmatische Aussage, Jesus habe vor seinem Erdenleben bereits im Himmel gelebt, habe eventuell schon an der Schöpfung teilgenommen usw. Für den, der an die vor-irdische Existenz Jesu glaubt und diese in der Bibel bestätigt finden will, bietet sich die Stelle Phil 2,6-7 an. Soweit die dogmatische Auslegung.
Anders sieht die exegetische Sicht aus, die Textanalyse: Hier gilt der Grundsatz, dass zunächst der Einzeltext zu analysieren ist, bevor weitreichende Schlussfolgerungen gezogen werden können. Bevor wir mit der Textanalyse beginnen, müssen wir uns daran erinnern, dass die strikte Trennung von Diesseits und Jenseits eine moderne Idee ist. Die Antike denkt anders: Diesseits und Jenseits sind verschränkt. Der König und der Kaiser haben mehr Macht als die kleinen Geister, die überall herumwuseln. Jeder Mensch lebt mit seinem Körper im Diesseits, aber sein Geist gehört der geistigen, der jenseitigen Welt, an und wird die Erde nach dem Tod verlassen und im Hades, in der Totenwelt, oder im Himmel sein. Jesus wird von den Geistern im Himmel und unter der Erde verehrt werden und von Geistern und Menschen auf der Erde. Ob Jesus selbst sich im Himmel befinden wird, oder als Nachfolger des römischen Kaisers ein das Diesseits transzendierendes Friedensreich auf der Erde errichtet, dem auch die Geister untertan sein werden, wird in den Versen 10-11 nicht beschrieben. Fazit: Die Verehrung Jesu durch die diesseitigen und die jenseitigen Wesen schließt nach Phil 2,10-11 seine Verbringung in den Himmel nicht ein.
Der gottgleiche Herrscher
Mit der exegetischen Demontage der 1. Stufe der dogmatischen Argumentation entfällt die 2. Stufe. Wie sind dann die Verse 6-8 zu verstehen? Wenn wir einen indischen Bauern fragen: Wer ist wie Gott, wer ist Gott gleich? Dann wird die Antwort lauten: Ein Maharadscha. Wenn wir einen ägyptischen Bauern des Pharaonenzeitalters gefragt hätten, wer wie Gott sei, hätten wir die Antwort erhalten, der Pharao, ein palästinischer Bauer des 1. Jahrhunderts n. Chr. hätte auf dieselbe Frage geantwortet, der König. Die Vergleichskriterien wären jedes Mal der materielle Reichtum und die Möglichkeit, Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben, seinen Willen zur Geltung zu bringen. Ernst Käsemann argumentiert in seinem Aufsatz über Phil 2,5-11: Auf die Frage, wer wie Gott sei -...- antwortet das gesamte Judentum: Niemand ist dir (Gott) gleich.14 Das ist die religiös korrekte Antwort, sie unterstreicht aber zugleich, dass die allgemeine Auffassung das Gegenteil besagt. Unser volkstümlicher Christuspsalm in Phil 2 könnte nun genau das meinen: Jesus war König oder ein königsgleicher Herrscher, der sich den Menschen gleichstellte. Raimund Schulz schreibt dazu in seiner Studie über die römischen Statthalter in den Provinzen:
Je mehr der Statthalter die Distanz gegenüber der breiten Masse der Untertanen betonte, umso wirkungsvoller ließen sich Auftritte auch außerhalb des Palastes oder des Prätoriums in Szene setzen, bei denen er sich betont zugänglich gegenüber den Klagen und Wünschen seiner Untertanen zeigte...
Diese Beschwörungen herrschaftlicher Zugänglichkeit (...) waren kein leeres Gerede. Jede herrschaftliche gravitas benötigte die öffentliche Bestätigung, um glaubwürdig zu bleiben und nicht den Kontakt zu den Untertanen zu verlieren... Von einer großen rat- und hilfesuchenden Menge allmorgend-/lich umdrängt zu werden - auch dies war ein Zeichen von Prestige und Macht. Es legitimierte den aristokratischen Herrscher und den erfolgreichen Feldherrn.15
Schulz zitiert weiter einen Passus von Cicero über Pompeius, der genau wie Phil 2,7 die Gleichstellung des Herrschers mit den gewöhnlichen Untertanen zeigt:
"Die Privatleute haben sogar", so Cicero über den Aufenthalt des Pompeius im Osten, "so unbehindert Zugang zu ihm, und Klagen über Ungerechtigkeiten anderer dürfen so offen vorgebracht werden, daß er, der durch seine Würde (dignitas) die Mächtigsten überragt, sich durch seine Umgänglichkeit (facilitas) den Niedrigsten gleichzustellen scheint.16
In der theologischen Auslegung biblischer Texte wird gern der Jenseitsbezug hervorgehoben. Die biblischen Autoren waren aber viel diesseitigerals gedacht, das Jenseits ist zunächst als geistige Welt im Diesseits anwesend.
Die Erfahrungswelt unserer Autoren ist das Diesseits, nicht die jenseitige Welt. Deshalb können wir zuerst Aussagen über das Diesseits erwarten, allerdings mit einer großen Bandbreite auch an sozialen Gegebenheiten. Bei der Auslegung von biblischen Texten frage ich deshalb immer zuerst nach dem Erfahrungshorizont des Autors. Im Fall Phil 2 wird allgemein der Bezug zu den alttestamentlichen Psalmen hervorgehoben. Dort wird ebenfalls die diesseitige Welt mit ihren ganz persönlichen Nöten und Erfahrungen thematisiert. Hätten wir in Phil 2 einen gnostischen Psalm vor uns wie bei Texten des Johannesevangeliums, man könnte an den gnostischen Mythos vom Lichtteilchen, das von den Sterngöttern auf die Erde kommt, denken. Das ist aber hier nicht der Fall. Allerdings möchte ich nicht eine Entweder- oder-Konzeption entwerfen. Ich halte beide Auslegungen des Gottgleichen für möglich, die des irdischen Herrschers oder die des Präexistenten Christus. Allerdings vermute ich eine zeitliche Bedeutungsverschiebung: das frühchristliche Lied besang den irdischen Herrscher, der sich wie Pompeius bei Cicero um die Untertanen kümmerte, in der späteren Theologie wurde die Linie der Erniedrigung unter dem Einfluss gnostischer Ideen so verlängert, dass der Abstieg im Himmel beginnt.
Der Johannes-Prolog, Joh 1,14
Im Prolog des Johannesevangeliums Joh 1,14 heißt es: Wir sahen seine Herrlichkeit... Das Wort ist eingebettet in den Mythos vom Wort (griechisch: Logos), das Gottes Sohn und Schöpfungsmittler ist und in Jesus als Mensch auf die Erde kommt. Der ganze Vers heißt:
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Joh 1,14
Das Wort ward Fleisch beschreibt das, was mit dem Fachausdruck Inkarnation genannt wird. Ein Gott erscheint auf der Erde, eine Formel, die jedem, der einmal griechische Sagen gelesen hat, geläufig ist. Wenn Zeus oder Dionysos in ihrer realen Gestalt auf einen Menschen treffen, geht die Begegnung für den Erdenbürger tödlich aus. Deshalb können die Götter, wenn sie sich Sterblichen nähern, nur inkognito, in menschlicher Gestalt, reisen. Der Mythos im Johannes-Prolog variiert die Szenerie: Der Gott reist nicht inkognito, er reist auch nicht als Gott, sondern hat sich in einen Menschen verwandelt. Der Evangelist will nun die positive Wirkung beschreiben, die der Gott trotz Verwandlung (Inkarnation) auf die Jünger machte. Er schreibt: Wir sahen seine Herrlichkeit. Das griechische Wort doxa, das Luther mit Herrlichkeit übersetzt, meint hier die Aura eines Gottes, den Lichtglanz, der einen Gott umgibt, an der die Jünger Jesu Göttlichkeit erkannt haben wollen.
Was hat das mit der sozialen Prägung und der Familie Jesu zu tun? Die Herrlichkeit Gottes korrespondiert mit der Herrlichkeit, der Aura, der Ehre und Ehrerbietung, die einem antiken Herrscher zukommt. Aber woran könnten die Jünger Jesus erkannt haben, wenn der nur ein armer Wanderprediger war? Einem armen, immer hungrigen Philosophen, der höchstens schöne Geschichten erzählt, kommt die Aura, die Ehre, die Herrlichkeit eines Gottes nicht zu. Als Agrippa I. 44 n. Chr. in einem reich verzierten königlichen Gewand sich auf seinen Thron setzt und eine Rede an sein Volk hält, da rufen die Zuhörer: Das ist Gottes Stimme, und nicht die eines Menschen! (Act 12,22). Göt...