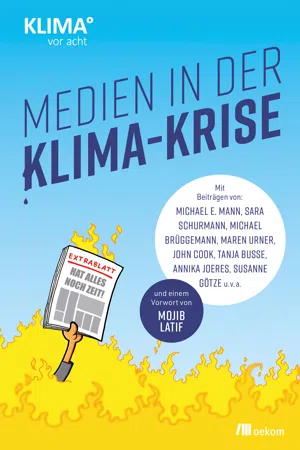
eBook - ePub
Medien in der Klima-Krise
- 272 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Medien in der Klima-Krise
Über dieses Buch
Stellen wir uns vor, die Welt geht unter – und keiner redet darüber. Was dramatisch klingt, geschieht im Kern beim Thema Klimawandel. Denn einerseits warnt die Wissenschaft seit Jahrzehnten vor der Klimakatastrophe, andererseits fällt es der Politik schwer, etwas gegen die Erderwärmung zu unternehmen. Und die Medien, die eine Debatte in die Öffentlichkeit tragen sollten? Sie verhalten sich seltsam passiv.
Wie kann das sein angesichts der größten Herausforderung in der Menschheitsgeschichte? Die Klimakrise geht uns alle an. Ebenso werden Fernsehen und Hörfunk, Zeitungen und Zeitschriften, Podcasts und Onlinemagazine für jede:n von uns produziert, und wir alle haben ein Recht auf umfassende und gute Berichterstattung.
28 namhafte Autor:innen, vorwiegend aus Kommunikationswissenschaft und Journalismus, belegen eindrucksvoll, wie und warum die Medien in ihrer eigenen Klima-Krise stecken. Sie zeigen auf, warum der Klimawandel eine journalistische Herausforderung ist, und stellen Lösungen, Ideen und Erfahrungen vor, wie Medienschaffende besser in der Krise handeln können.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Medien in der Klima-Krise von Michael E. Mann,Sara Schurmann,Michael Brüggemann,Maren Urner,John Cook,Tanja Busse,Annika Joeres,Susanne Götze im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politique et relations internationales & Liberté politique. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Zwischen Unterlassung und ökologischer Verantwortung
Klimajournalismus in Zeiten kognitiver Dissonanz
Michael Brüggemann und Susan Jörges
Mehr als eine Dekade der Nichtkommunikation, der Untätigkeit und des Verdrängens liegt hinter uns. Heiße, trockene Sommer, grenzüberschreitende Jugendproteste und eine »Jahrhundertflut« im Westen Deutschlands haben den Klimawandel in das öffentliche Bewusstsein gedrängt und gezeigt: Klimawandel passiert hier vor Ort, vor der Haustür jedes und jeder Einzelnen. Expert:innen weltweit sind sich einig: Eine sofortige Reduktion von Emissionen ist längst überfällig. Vor und neben dem Handeln steht aber eine Verständigung über Probleme, Verantwortlichkeiten, angemessene Reaktionen und Ziele im Klimaschutz. Und dafür ist Klimakommunikation so wichtig, verstanden als das öffentliche Selbstgespräch der Gesellschaft über das Thema Klimawandel. Wir zeichnen die großen Linien dieses Gesprächs nach, werfen einen Blick in Richtung USA, diskutieren blinde Flecken des Journalismus und erklären, wie der Berufsstand seiner ökologischen Verantwortung gerecht werden könnte.
Schon 1896 vermutete der schwedische Physiker Svante Arrhenius, dass Kohlendioxid die globale Atmosphäre erwärmt. Seit den 1980er-Jahren haben sozial engagierte Klimawissenschaftler öffentlich vor den Gefahren des Klimawandels gewarnt. Dass der Klimawandel menschengemacht ist und gewaltige Risiken birgt, ist spätestens seit dem vierten Bericht des Weltklimarats, dem Intergouvernemental Panel on Climate Change (IPCC), aus dem Jahr 2007 klar.1 Der erste Teil des fünften Berichts des Weltklimarates ist im Sommer 2021 erschienen. Der Bericht macht nochmals deutlich, dass sich die Situation im Klimasystem weiter verschlechtert hat. Überraschend ist das nicht, denn das Jahrzehnt 2011 bis 2020 war das bisher wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.2 Die Risiken und Auswirkungen einer Erderwärmung von mehr als zwei Grad bis zum Jahr 2100, etwa ein deutlicher Meeresspiegelanstieg oder häufigere und intensivere Extremwetterereignisse, lassen sich nur reduzieren, wenn der menschengemachte Treibhausgasausstoß schon in den nächsten zehn bis 20 Jahren drastisch verringert wird.3 Doch der Ausstieg aus der massenhaften Emission von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen erfordert einen Wandel, der in alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche hineinreicht. Während Expert:innen schon lange Dokumente mit Visionen für diese große Transformationen vorgelegt haben,4 so ist die Debatte immer noch nicht in der politischen Öffentlichkeit angekommen, wie der deutsche Bundestagswahlkampf 2021 gezeigt hat: Praktisch alle Wahlkämpfenden hatten suggeriert, dass Klimaschutz ohne weitreichende Veränderungen und Konsequenzen für Bürger:innen möglich sei. Dass Politiker:innen im Wahlkampf so kommunizieren, ist erklärbar. Doch statt kritisch nachzufragen, haben Journalist:innen in TV-Wahlkampf-Triellen Themen wie ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen oder eine CO2-Bepreisung von Benzin und Diesel erfolgreich skandalisiert. ZDF-Chefredakteur Peter Frey und seine Stellvertreterin Bettina Schausten sprachen im Wahlkampfformat »Was nun, Frau Baerbock« zum Beispiel wiederholt von »Zumutungen« für Bürger:innen, die die Klimapolitik der Grünen mit sich bringen würde. Das Netzwerk Klimajournalismus hat daraufhin einen Brief an die Intendant:innen aller Fernsehsender geschrieben, in dem die Moderation der Wahlkampf-TV-Debatten im Hinblick auf das Thema Klimawandel kritisiert wird. Die Autor:innen bemängelten, dass gerade die Moderator:innen immer wieder nur nach den Kosten des Klimaschutzes gefragt und darüber unterschlagen haben, dass der ungebremst fortschreitende Klimawandel die viel größeren Kosten verursachen wird.5 Statt den Wahlkampf mittels oberflächlicher Schlagworte (Markt vs. Verbote; Freiheit vs. Verzicht; Klimapolitik vs. Sozialpolitik) zu befeuern, wäre ein hart nachfragender Journalismus wünschenswert, der zum Beispiel herausarbeitet, wie denn »der Markt« Klimaschutz hervorbringen sollte und ob das effizienter ist als das Ordnungsrecht.
Fridays for Future holt Klimawandel in die Mitte der Gesellschaft
Angesichts der wiederholten, deutlichen und ernüchternden Worte des Weltklimarates sollte man meinen, dass der Klimawandel in den vergangenen Jahren ein Dauerthema ganz oben auf der Agenda der Medien gewesen wäre. Doch dem war lange nicht so. Lange wurden die Anwesenheit und die Risiken des Klimawandels von Politik und Öffentlichkeit verdrängt, um Unbehagen und längst überfälligen Handlungen aus dem Weg zu gehen. Erst im Spätsommer 2018 lief in Deutschland eine intensive Klimawandeldebatte an (siehe Abbildung 1), angestoßen durch den langen Dürresommer mit neuen Rekorden an Hitzetagen. Der Spiegel titelte »Der Sommer, der nie endet« (Nr. 32/2018), und auf allen Kanälen diskutierten die Medien die Folgen für Bürger:innen, Landwirtschaft und Ökosysteme. Bilder von verbranntem Rasen, vertrockneten Flüssen und um ihre Ernte bangenden Bauern führten uns die Wirkungsmacht von Hitze und Trockenheit vor Augen. Zur allgemeinen Aufmerksamkeit entscheidend beigetragen hat auch die soziale Bewegung Fridays for Future. Greta Thunbergs Streik vor dem schwedischen Parlament im August 2018 und ihre Ansprache auf der Weltklimakonferenz in Katowice 2018 gingen durch die Medien und lösten zunächst lokale und regionale, später nationale und globale Streiks von Schüler:innen aus. Die Jugend hat erkannt, was viele bis heute verdrängen: Jetzt ist allerhöchste Zeit zu handeln. Greta Thunberg gab dem abstrakten Thema Klimaschutz ein Gesicht und eine persönliche Geschichte, die dem journalistischen Nachrichtenfaktor Personalisierung entspricht und leichter erzählt werden kann als zum Beispiel die komplexen Hintergründe globaler Klimapolitik.

Abbildung 1: Entwicklung der Klimaberichterstattung, USA und Deutschland.6
Klimakonferenzen schaffen punktuelle Aufmerksamkeit
Schon das Jahr 2007 hätte mit den deutlichen Warnungen der Klimawissenschaft den Beginn einer großen weltweiten Debatte über die Transformation unserer Lebensweise markieren können. Zugleich hat der ehemalige amerikanische Vizepräsident Al Gore mit dem Dokumentarfilm »An Inconvenient Truth« (»Eine unbequeme Wahrheit«, 2006) das Thema Klimawandel in die Öffentlichkeit gebracht. Der Weltklimarat und Al Gore erhielten für ihr Engagement im Jahr 2007 den Friedensnobelpreis. Das Thema Klimawandel wurde zu dieser Zeit auch intensiv und grenzüberschreitend diskutiert, intensiver als je zuvor und danach, wie sich aus einem Monitoring der weltweiten Zeitungsberichterstattung zum Thema ablesen lässt (Abbildung 2).

Abbildung 2: Weltweite Zeitungsberichterstattung über den Klimawandel oder die globale Erwärmung (2004 bis 2022) in 127 Quellen aus 59 Ländern, Zeitungen, TV, Agenturen.7
In ähnlichen Zeiträumen zeigten auch die Google-Nutzer:innen ein besonders intensives Interesse am Thema Klimawandel. Abbildung 3 zeigt die gebündelten Suchanfragen aus dem Themenfeld Klimawandel in Deutschland.

Abbildung 3: Gebündelte Suchanfragen aus dem Themenfeld »Klimawandel« für Deutschland.8
Der Gipfel bisheriger medialer und damit öffentlicher Aufmerksamkeit für das Thema Klimawandel war die UN-Klimakonferenz in Kopenhagen im Jahr 2009, auf der große Hoffnungen auf einen verbindlichen Vertrag ruhten, der dann erst 2015 in Paris zustande kam.9 Mehr als tausend nach Kopenhagen angereiste Journalist:innen fuhren nach Hause, ohne über nennenswerte Beschlüsse berichten zu können. Das Thema Klimaschutz verschwand von der Medienagenda.
Bis weit in den Hitzesommer 2018 hinein vernachlässigten führende deutsche Onlinemedien (zum Beispiel Spiegel Online, Tagesschau.de), deren Berichterstattung wir im »Online Media Monitor on Climate Change« (OMM) verfolgen, das Thema und erwähnten nur in unter zwei Prozent der Beiträge das Wort »Klimawandel« (Abbildung 4). Einzelne engagierte Fachjournalist:innen schrieben in den großen Tageszeitungen zwar Analysen zu den alljährlichen Klimagipfeln der Vereinten Nationen und den Berichten des Weltklimarates, der öffentlich-rechtliche Rundfunk produzierte vereinzelt Dokumentationen und tiefer gehende Hintergrundstücke, doch eine kontinuierliche Berichterstattung in der Breite der Medienlandschaft, die das Bewusstsein der Bevölkerung schärft, sieht anders aus.
Die Auswirkungen der Trockenheit im Jahr 2018 gaben der Klimaberichterstattung in Deutschland neuen Anschub. Die Anzahl an Artikeln mit Bezug zum Klimawandel nahm stetig zu und erreichte zunächst ihren Höhepunkt im Spätsommer 2019 (Abbildungen 1 und 4), als die Große Koalition ihr sogenanntes Klimaschutzpaket verabschiedete. In Gegenüberstellung zu Politik- und Wirtschaftsthemen standen Klimathemen jedoch weiterhin in zweiter Reihe: Selbst im Dürrejahr 2018 ging es in den deutschen Polit-Talkshows »Anne Will«, »Maybrit Illner«, »Hart aber fair« und »Maischberger« 44-mal um Wahlkampf- und Politikthemen, aber nur dreimal um das Klima und neunmal um Umwelt- und Energiethemen.10

Abbildung 4: Entwicklung der Klimaberichterstattung in verschiedenen deutschen Onlinemedien.11
Klimaberichterstattung schafft kein Klimawissen
Die Häufigkeit von Klimaberichterstattung ist die eine Frage. Ob Berichterstattung auch zu Aufmerksamkeit und Sensibilität bei Rezipienten führt, ist die andere, möglicherweise noch sehr viel wichtigere Frage, für die sich Klimakommunikationswissenschaftler:innen interessieren. Ergebnisse zeigen, dass selbst kurzfristige und intensive Spannen der Medienaufmerksamkeit, etwa rund um den wichtigsten aller Klimagipfel in Paris 2015, die breite Öffentlichkeit nicht für das Thema engagieren können. Drei Viertel der deutschen Bevölkerung erfuhren laut unseren Befragungen aus den Medien zwar etwas über den Klimagipfel in Paris 2015.12 Doch es kam zu keiner tieferen Auseinandersetzung mit dem Thema, zum Beispiel in Gesprächen, Google-Suchen, Onlinekommentaren oder ähnlichen Aktivitäten. 70 Prozent der Befragten taten 2015 während des Klimagipfels nichts dergleichen.
Das hat sich inzwischen geändert: Die deutsche Bevölkerung sprach während des UN-Klimagipfels 2019 öfter über den Klimawandel und die Klimapolitik als im Jahr 2015. Während des Paris-Gipfels 2015 sprachen nur 25 Prozent der Befragten in der Familie oder mit Freund:innen (mindestens einmal in der Woche) über den Klimawandel. 2019 waren es immerhin 51 Prozent. Auch gaben die Menschen an, ihr Konsumverhalten klimafreundlicher ausrichten zu wollen.13 Nach wie vor fehlt, wie die gestellten Wissensfragen zeigen, aber ein Grundverständnis von Klimapolitik. Die nur punktuelle Berichterstattung hat kein Hintergrundwissen zu Klimapolitik vermittelt. Zum Beispiel wussten die (befragten) Deutschen nicht, ob wir oder nicht doch eher Indien weniger Emissionen pro Kopf verantworten. Auch die Tatsache, dass die weltweiten Emissionen keineswegs rückläufig waren (bis auf ein kurzes Zeitfenster in der Coronapandemie), war unbekannt. Ohne Basiswissen über den Klimawandel können die Menschen Klimapolitik jedoch nicht angemessen beurteilen. Da der Journalismus als Brücke zwischen Wissenschaft, Politik und Bürger:innen die zentrale Quelle von Klimapolitikwissen ist, kann bisher nur konstatiert werden: Entweder wurden zentrale Dinge nicht erklärt oder aber nicht so erklärt, dass die Menschen die Relevanz für ihr Leben erkannt und sich entsprechend intensiver damit beschäftigt haben.
Dafür lief und läuft bis heute eine andere Art der Klimakommunikation ungebremst weiter: Werbung für klimaschädliche Produkte, vom SUV über das superbillige Rindersteak bis zur Kreuzfahrt, umrahmt online und im Print die journalistischen Artikel über die Risiken des Klimawandels. Perfide wird diese Art der Klimakommunikation, wenn Unternehmen im Rahmen von Greenwashing-Kampagnen mittlerweile den Kauf eines überdimensionierten und übermotorisierten E-Autos als einen ökologischen Akt darstellen.
Das Schweigen der deutschen Medien als Echo unterlassener Klimapolitik
Im Durchschnitt weniger als drei Prozent aller Nachrichten von führenden deutschen Onlinemedien erwähnen das Wort »Klimawandel« und seine verschiedenen von uns getesteten Synonyme (siehe Abbildung 4). Der Anteil von Artikeln, die sich wirklich substanziell mit dem Thema beschäftigen, fällt folglich noch deutlich geringer aus. Wenig überraschend, wird über das Thema in der Boulevardpresse noch viel seltener berichtet. Es scheint allerdings einen Aufwärtstrend im Jahr 2021 zu geben. Besonders während des Klimagipfels in Glasgow war eine deutliche Zunahme an Berichterstattung zu beobachten; Klimathemen erscheinen ab und an auch als erster Beitrag in den Abendnachrichten, und auf vielen Websites führender deutscher Medien sind dauerhaft Zusammenfassungen und Dossiers zu den wichtigsten Fragen und Antworten zu finden.14 Klimaberichterstattung scheint jedoch in Wechselwirkung mit den Wellen der Co...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort der Herausgeber
- Vorwort
- Wir sehen das Klima vor lauter Bäumen nicht: Ein Appell zum Umdenken
- Zwischen Unterlassung und ökologischer Verantwortung: Klimajournalismus in Zeiten kognitiver Dissonanz
- Das letzte Gefecht
- Klimakrise und öffentlich-rechtlicher Auftrag: Die Versäumnisse der öffentlich-rechtlichen Medien
- Vom Verständnis und der Vermeidung von False Balance in der Medienberichterstattung über den Klimawandel
- Wieso Medien die Strategien der Klimaschmutzlobby (er)kennen müssen
- Relevanz, Framing und Konstruktiver Journalismus: Warum der Journalismus sich so schwer damit tut, die Klimakrise adäquat zu adressieren
- Warum Klima und Wetterbericht zusammengehören: Ein Appell aus Sicht eines TV-Meteorologen
- Die vierte Gewalt und ihr Versagen beim Klimawandel
- Klimawandel und Artensterben – gemeinsam gedacht, gemeinsam publiziert
- Was für eine Nachricht ist das denn?
- Klimakrise und Bildung
- Wie wir ohne Panik aus dem brennenden Haus kommen: Plädoyer für einen konstruktiven Klimajournalismus
- Hören, was ist: Über einen zugewandten und empathischen konstruktiven Journalismus
- Transformativer Journalismus: Ein neues Berichterstattungsmuster für das Anthropozän
- Klima ins Programm: Das »Klima Update« bei RTL und ntv
- Senderstrategien für junge Zielgruppen im Klimajournalismus
- »Der neutrale, objektive Journalismus ist eine Fata Morgana«: Interview mit Jürgen Döschner
- Kein Thema: Dimensionen des Journalismus in der Klimakrise
- Grenzüberschreitender Journalismus: Warum Klimajournalismus nationale Perspektiven überwinden muss
- Qualität im Klimajournalismus – und was die Journalistenausbildung dazu beitragen kann
- Transformation und Wiederverortung in der Zwillingskrise: Artensterben und Klimanotstand fordern vom Journalismus und von dessen Theorie ein, sich Ort, Landschaft und Natur mit neuen Ethikkonzepten, Rollenbildern und Sprachgewohnheiten zu öffnen
- Lebensdienlicher Journalismus – ein notwendiger Paradigmenwechsel
- Über die Autorinnen und Autoren