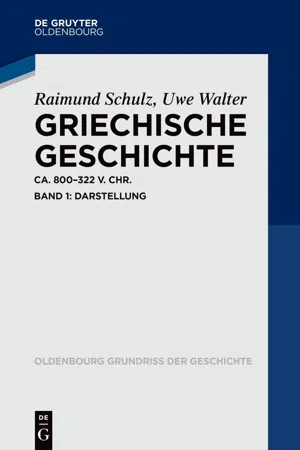1.1 Traditionen und neue Ausrichtungen
Die Geschichte der „alten Griechen“ war für fast zweihundert Jahre eine durch die Höhere Schule vermittelte Selbstverständlichkeit, so wie die der Römer. Diese Vertrautheit überdeckte einen wesentlichen Unterschied: Römer selbst haben den Gang der Ereignisse „seit Gründung der Stadt“ in verschiedenen Formaten immer wieder aufgezeichnet; „Römische Geschichte“ konnte damit bereits in der Antike als traditioneller und halbwegs fixer Gegenstand gelten. Bei den Griechen verhielt es sich anders. Zwar gab es ein durch Sprache und kulturelle Praktiken formiertes Bewusstsein, Hellene zu sein; strittig ist unter den Gelehrten nur, wie alt und wie ausgeprägt dieses Bewusstsein war.
Keine antike Geschichte ‚der Griechen‘
Aber niemand kam in der Antike auf die Idee, eine Gesamtgeschichte der Hellenen zu schreiben. Werke mit dem Titel „Helleniká“ behandelten meist nur die jüngste Vergangenheit und nie den gesamten Siedlungsraum der Griechen. Historiographie nahm, von der späten Universalgeschichte (Diodor) abgesehen, große Ereigniszusammenhänge – wie die Perserkriege bei Herodot und den Peloponnesischen Krieg bei Thukydides – oder einzelne Städte, Regionen oder prägende Gestalten zum Gegenstand. Erst im Gefolge des von Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) in ganz Europa befeuerten ästhetischen Interesses an den antiken Griechen, zumal an der Entwicklung ihrer Ausdrucksformen des Schönen und Vorbildlichen, kam das Bedürfnis auf, nun auch die Geschichte ‚der Griechen‘ zu schreiben. Das Stichwort dafür fanden Winckelmann sowie die Philhellenen mit und nach ihm in der Freiheit. „Was sie taten und litten“, so formulierte Jacob Burckhardt (1818–1897) das Alleinstellungsmerkmal [1.2.1: Griechische Kulturgeschichte 1, 12], „das taten und litten sie frei und anders als alle frühern Völker.“
Die vielfältigen Bemühungen um die alten Griechen (so die von den Römern geprägte Fremdbezeichnung: Graeci) oder Hellenen (so die Selbstbezeichnung) drängten ab etwa 1800 immer wieder zu einem Gesamtbild, das einerseits konsistent zu sein hatte – man sollte den Gegenstand jederzeit als mit sich selbst identisch erkennen können –, das andererseits aber auch im Modus der Erzählung eine Entfaltung oder Entwicklung präsentieren beziehungsweise sich wie ein lebender Organismus darstellen sollte. Den Drang zur Synthese bedingte auch der sich verfestigende Rang der Geschichtswissenschaft in der bürgerlichen Welt: Man hatte immer wieder Rechenschaft zu geben über das Gesamtbild und – in historistischer Weiterentwicklung – über den Gesamtverlauf. Die „Altertümer“ enzyklopädisch zusammenzustellen, wie es seit der Renaissance betrieben wurde, galt nun als überholt (oder geringerwertig), und für eine systematische Rekonstruktion fehlten angesichts der Vielfalt der Phänomene und der ungleichmäßigen Überlieferung die sachlichen Voraussetzungen. Außerdem existierten im antiken Hellas viele Zentren, anders als im Fall von Rom. So wurde die Großerzählung in Form der entwicklungsgeschichtlich angelegten Gesamtdarstellung auf der Basis der literarischen Quellen zum Maß der Dinge, während sich die Forschung ausdifferenzierte, spezialisierte und mit ‚unordentlichen‘ Überresten wie den Inschriften oder den materiellen Funden und Befunden umzugehen lernte.
Die Griechische Geschichte als ausgearbeiteter Entwurf ist also wesentlich jünger als ihre römische Schwester. Maßgebliche Definitionsarbeit leisteten zunächst Autoren auf den Britischen Inseln unter dem Einfluss der Schottischen Aufklärung. Breit angelegt und auf politische Entwicklungen ausgerichtet, hoben sie sich von der antiquarischen Tradition ab und scheuten gegenwartsbezogene Analogien und Wertungen nicht.
Ihren Höhepunkt fand diese Richtung in George Grote (1794–1871), einem gelehrten Bankier und Parlamentarier, dessen zwölfbändige „History of Greece“ (1846–1856) den Gegenstand „Griechische Geschichte“ definierte und die Debatten lange bestimmte. Wenn das Zeitalter der griechischen Stadtstaaten (Poleis) von etwa 750 bis 338 und in ihm die Geschichte der athenischen Demokratie bis heute besondere Aufmerksamkeit genießen, so ist dies zum Teil Grotes Wirken zu verdanken. Autoren wie er hatten dabei mit anspruchsvollen Problemen zu kämpfen. Es ging unter anderem darum, zwischen bloß erzählten Mythen und tatsächlicher Geschichte zu unterscheiden, wo die Quellen dies nicht taten, ferner generell über die bloße Wiedergabe der antiken Historiker hinauszukommen sowie fragmentarische Erzählungen und Überlieferungsinseln in ein größeres Ganzes zu integrieren. Der Impuls, solche Probleme anzugehen, hatte zu einem guten Teil politische Gründe. Im Vordergrund standen bei den Engländern die Grundfragen der Gestaltung von Monarchie und Demokratie, von Regierung und Repräsentation.
Politische Zeitgenossenschaft
Dieser politische Akzent haftete dem Interesse am Gegenstand auch weiterhin an: Der Blick auf die Griechische Geschichte wurde oft durch zeitbedingte Positionsbestimmungen und Auseinandersetzungen gelenkt, angefangen bei der geistigen Identifikation („Wir sind alle Griechen!“) und der Idealisierung Athens (viel seltener Spartas) über das Studium der Polis und ihres angeblichen Scheiterns bis hin zu den Urteilen über die Athenische Demokratie, die Sklaverei, den athenischen oder spartanischen Imperialismus sowie die makedonisch-griechische Monarchie seit Alexander dem Großen (356–323). In diesem Rahmen bildete die mehrbändige „Griechische Geschichte“ die maßgebliche Form, in der das Quellenmaterial kritisch behandelt wurde und zeitgenössische politische Themen in die Perspektive einflossen. Das galt zumindest für Deutschland und England, während in Frankreich ein systematischer, auf Felder wie Familie und Religion konzentrierter Ansatz dominierte, für den etwa Numa D. Fustel de Coulanges (1830–1889) steht. Es bestand also bei den Gelehrten wie im Publikum das Bedürfnis, den Sinn im Ganzen zu suchen und in der Erzählung plausibel gemacht zu finden. Die „Griechische Geschichte“ als Werktitel wurde zum Rückgrat des neukonstituierten Fachgebiets; dabei gaben zwei Generationen lang deutsche Wissenschaftler den Ton an. Zu nennen sind hier vor allem die großen Mehrbänder von Georg Busolt (1850–1920), Karl-Julius Beloch (1854–1929) und Eduard Meyer (1855–1930), die einen ausgeprägten historischen Realismus pflegten.
Dieser schlug sich in einer markanten Fixierung auf Staat und Macht nieder; auch wirtschaftliche Interessen und Entwicklungen sowie geistige Tendenzen spielten eine wichtige Rolle. Ernstgenommen wurde eine Synthese nur, sofern sie auf einem empirischen Fundament aus durchgearbeiteten Quellen sowie solider Detailforschung ruhte.
Bei einem so deutlich ‚erzeugten‘ Gegenstand ergab sich für die Gesamtschau die zentrale Frage, wie eigentlich die Geschichte der antiken Hellenen nach Zeit und Raum abzugrenzen sei. Den gedanklichen Kern des bis heute verbreiteten Dreiepochenschemas bildet die klassizistisch-neuhumanistische Konzeption einer vorbildhaften und unübertroffenen Phase der geistig-kulturellen Entwicklung von Aischylos bis Aristoteles oder von Phidias bis Praxiteles, die sog. Klassik.
Sie konnte sich auf antike Tatbestände und Wertungen berufen, die bereits im 4. Jahrhundert, dann verstärkt in der römischen Kaiserzeit entwickelt wurden und bei Autoren wie Pausanias und Plutarch deutlich zu sehen sind. Die davor gelagerte, gern als „Archaik“ oder „Archaische Zeit“ (800–500 oder 479) angesprochene Epoche zu untersuchen, ergab sich in historisch-genetischer Sicht aus der Frage nach den Voraussetzungen der griechischen Einzigartigkeit und ‚Ursprünglichkeit‘.
Die in diese frühere Zeit fallenden homerischen Epen warfen zudem das Problem des Anfangs in einiger Schärfe auf. Damit verknüpft war das bis heute diskutierte Problem, wie weit man diese Epoche des „noch nicht“ rückwärts ausziehen wollte: Begann Hellas im Kern mit einer ‚Renaissance‘ im 8. Jahrhundert, oder gehören die bronzezeitlichen Kulturen des 2. Jahrtausends integral dazu? – Die Jahrhunderte nach dem klassischen Höhepunkt, eingeläutet durch die Herrschaft Alexanders des Großen (reg. 338–323), wurden lange Zeit als Niedergang und Verlust an Freiheit und Schöpferkraft betrachtet, bis Johann Gustav Droysen (1808–1884) einen anderen Horizont eröffnete.
Erst durch eine Universalisierung im „Hellenismus“ erhielten die Griechen, die im Kontext der Alten Welt insgesamt eine doch nur kleine, späte, begrenzte und randständige Rolle spielten, die große Chance, losgelöst von höchst kontingenten und partikularen Voraussetzungen gleich mehrfach ‚aufgehoben‘ zu werden, nämlich als kulturbestimmender Faktor für die römische Welt, im Christentum und – wie aktuell verstärkt herausgestellt wird – auch im frühen Islam.
Welche Regionen der mehr als tausend Einheiten umfassenden Welt der Hellenen in Forschung und Unterricht unter dem Dach „Griechische Geschichte“ zu behandeln seien, war im Zeitalter der exakt definierten Nationalstaaten eine wichtige Frage und hing wiederum stark von Setzungen und Konventionen ab. Den Raum abzugrenzen erwies sich als schwierig, da die geistige Landkarte seit dem frühen 19. Jahrhundert vom modernen Staat Griechenland geprägt wurde. Kleinasien gehörte noch dazu, denn dort siedelten bis 1923 viele Griechen, aber schon die „Westgriechen“ in Sizilien und Süditalien („Großgriechenland“) wurden vielfach als gesonderte Größe betrachtet, deren Geschicke sich nur phasenweise mit denen im Kernland und in Kleinasien kreuzten. Wegen der Gründung zahlreicher griechisch geprägter Städte in Gebieten des ‚Orients‘ wurde die Abgrenzung für die Zeit seit Alexander noch schwieriger. Der Widerstreit zwischen inklusiven und exklusiven Griechenlandmodellen existiert schon seit der römischen Kaiserzeit.
Äußerlich suchte man den Zusammenhang der griechischen Geschichte, wie skizziert, in der Gesamtdarstellung evident zu machen. Gedanklich strukturierend wirkten dabei bestimmte Grundfigurationen, in denen man sowohl die Einheit wie die Individualität der Entwicklung des antiken Hellas aufsuchte. Da war zum einen die maßgeblich von Karl Otfried Müller (1797–1840) aufgebrachte, in der Romantik wurzelnde Idee, die griechischen Stämme, vor allem die Dorer und die Ioner, als formative Kräfte anzusprechen. Dieser Ansatz folgte dem Bedürfnis, das Wesen im Anfang zu erkennen und zu einer ganzheitlichen Betrachtung vorzustoßen, die Abstammung, Sitte, Religion, Landschaft, Mythos und Geschichte als Facetten von jeweils einheitlichen und letztlich überhistorischen Lebensformen zusammenfügt. Allerdings erwies sich eine solche Perspektive auch als anfällig für Mystifizierungen, wie die zweibändige, 1931/1933 vorgelegte „Griechische Geschichte“ von Helmut Berve (1896–1979) zeigt. Daneben stand die zumal in Deutschland gepflegte Idee der Einheit einer griechischen Kulturnation, die wegen einer Art von Daseinsverfehlung niemals zur politischen Nation gefunden habe, wenn man nicht ihre Überwältigung durch Makedonien seit 350 in diesem Sinne verstehen wollte. In jüngerer Zeit wurde die Suche nach übergreifenden Strukturen in anderer Form wieder aufgegriffen: in den Forschungen zur griechischen Ethnogenese und Identitätsbildung, damit verbunden auch zur Verbreitung griechischer Lebensformen im Zuge der ‚Großen Kolonisation‘, sowie in den Versuchen, übergreifende Formen von Staatlichkeit zu etablieren. Dieser Blick konzentrierte sich zum einen auf die recht kurzlebigen hegemonialen Machtbildungen (Athen, Sparta, Theben), zum anderen auf die Ansätze zu einem Territorialstaat (Syrakus) sowie drittens auf die neuartigen Bundesstaaten seit etwa 400.
In jüngerer Zeit richtete sich das Augenmerk vermehrt auf Vielfalt und Differenzen. Dabei wurde zunächst die griechische Staatenwelt „jenseits von Athen und Sparta“ (H.-J. Gehrke) stärker beachtet und hat das „Copenhagen Polis Centre“ im Geiste des Aristoteles alle erreichbaren Daten zu jeder politischen Einheit gesammelt und klassifiziert. Aktuelle Bestrebungen gehen dahin, die Lebenswirklichkeiten im lokalen Kontext umfassend und interdisziplinär zu rekonstruieren. Ein anderer Trend weist in die Richtung, die antiken Griechen ihrer lange gängigen Zuschreibungen zu entkleiden: Sie seien nicht einzigartig gewesen, sie stellten keine mit Begriffen wie ‚Volk‘ oder ‚Identität‘ zu fassende, wesenhafte historische Größe dar und sie dürften nicht isoliert von den sie umgebenden Akteuren studiert werden.
Vielmehr müsse man sich auf ihre Interaktionen und Netzwerke, ihre Mobilität und – so ein neues Zauberwort – Konnektivität konzentrieren und die zahlreichen Hybridformen ihrer Existenz hervorheben. Letzteres ist freilich wiederum ohne eingehende Lokalstudien nicht zu machen.
Postkoloniale Dekonstruktion
Noch radikalere Revisionen fordert der sog. Postkolonialismus im Bunde mit einem extremen erkenntnistheoretischen Konstruktivismus: Die Geschichte der antiken Griechen sei zur Gänze ein Machwerk des imperialen Westens; sie rühme das Vorbild des Mannes als Alleinherrscher in seinem Haus sowie (als Bürger) im Staat, dränge Frauen, Unfreie und Fremde an den Rand, empfehle Expansion und kulturelle Dominanz als Vorbild (etwa in der sog. Großen Kolonisation) und phantasiere für die Tyrannei der westlichen, ‚rationalen‘ Wissens- und Werteordnung eine Vorgeschichte herbei, die von der Ionischen Naturphilosophie über Platon bis Aristoteles reiche und die ebenfalls in der griechischen Antike ausgebildete Diskursform der Rhetorik einschließe. In dieser vor allem in der englischsprachigen Welt verbreiteten, auf der Rezeption bestimmter französischer Meisterdenker beruhenden Richtung stellt böse ‚Macht‘ eine zentrale Kategorie dar und wird die Grenzlinie zwischen Realhistorie und Literatur zugunsten eines allmächtigen Diskurses – ‚Was tun Menschen mit Worten? Was machen Worte mit Menschen?‘ – verwischt beziehungsweise gleich ganz zur Fiktion erklärt. ‚Griechische Geschichte‘ ist in dieser Lesart nicht länger ein sinnvoller Gegenstand des Fragens und Erkennens.
Die antiken Griechen: eine aufregend moderne Angelegenheit!
Solche Extrempositionen wurden allerdings bislang nur polemisch-programmatisch vorgetragen und nicht durch eine überzeugende neue Darstellung untermauert. Dagegen halten wir als die Autoren des vorliegenden Grundrisses im Einklang mit der höchst lebendigen Forschung in mehreren Disziplinen die Griechische Geschichte von ca. 800 bis 322 für einen überaus zeitgemäßen, ja zukunftsweisenden Gegenstand: Mit enormer Kreativität haben die Griechen ‚ihre‘ Welt gestaltet, sich dabei sehr unterschiedlichen und auch fluiden Herausforderungen, wie sie die natürlichen und die machtpolitischen Umwelten ihnen bereiteten, energisch gestellt und zugleich ein markantes eigenes Profil entwickelt. Sehr bald war in der antiken Welt jedem klar, wer ‚die Griechen‘ waren, was sie ausmachte und was ihnen eine besondere Stellung gab. Vielfalt, Gestaltungsfreude, Anpassungsfähigkeit und ein Ausgreifen nach allen Richtungen – diese Merkmale (und andere), die das vorliegende Buch konzeptionell prägen, machen die antiken Griechen gerade in unserer Zeit aufregend aktuell.