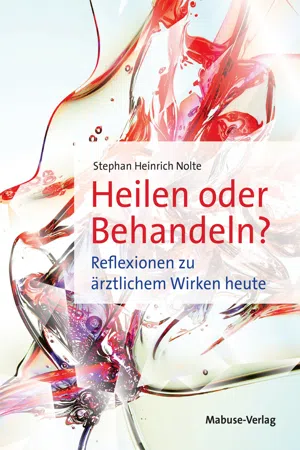Das Wort „heilen“ hat zwei Bedeutungen, eine aktive (transitive): „heil machen“: etwas oder jemanden heil machen, und eine passive (intransitive): „heil werden“: Die Wunde heilt. Das Heil steht für Ganzheit, Wiederherstellung, Gesundheit und Erlösung, im profanen wie im religiösen Sinn. Im Englischen gibt es drei verschiedene Adjektive dieses Stammes, die den weiteren Wortsinn gut verständlich machen: whole im Sinne von „ganz“, hale im Sinne von „frisch, ungeschwächt“ und holy im Sinne von „heilig“. Letztere Bedeutung ist eine gewisse Steigerung: Das von Heil abstammende Wort „heilig“ bezeichnet etwas ganz Besonderes und Verehrtes. Dieser Begriff wird heute fast ausschließlich im Zusammenhang mit etwas Sakralem, Religiösem, Göttlichem und Übermenschlichem gebraucht. Früher kam das Wort „heilig“ durchaus in gesundheitlichem Zusammenhang vor, etwa als Heilige Krankheit für die Epilepsie oder als ignis sacer, heiliges Feuer, bei der Mutterkornvergiftung (Ergotismus).
Für uns ist im Zusammenhang des Heilens die Frage wichtig, wer oder was (transitiv) heilt, oder wie (intransitiv) etwas heilt. Der Begriff der Selbstheilung und der zugrunde liegenden Kräfte bezeichnet die Fähigkeit des Organismus, äußere und innerliche psychische und physische Verletzungen und Erkrankungen zu heilen. Die Aktivierung und Nutzung dieser Selbstheilungskräfte sollte durch den Patienten selbst erfolgen und muss das einzige und vorrangige Ziel auch der ärztlichen Bemühungen sein. Sie ist aber keinesfalls ein ärztliches Privileg; jeder, der sich um seine Mitmenschen bemüht, kann diese Selbstheilungskräfte anstoßen und aufrechterhalten.
Heilen ist nicht Handeln: Die medizinische Ethik nach Childress und Beauchamps
In der medizinischen Ethik haben sich vier Grundsätze herauskristallisiert, die Leitprinzipien ärztlichen Handelns sein sollen. Der Anspruch des Heilens kommt in diesem Kodex aus den oben genannten Gründen gar nicht vor, da ist die ärztliche Ethik viel bescheidener. In Ermangelung allgemein anerkannter religiöser und allgemeinethischer Instanzen können sie in der heutigen Zeit als die Grundregeln menschlichen Umgangs allgemein gelten, ihre Reichweite geht weit über den medizinischen Bereich, aber auch den Bereich sonstiger therapeutischer und pädagogischer Tätigkeiten hinaus und gelten für das ganze Spektrum des menschlichen Miteinanders. Die üblicherweise zitierte Reihenfolge ist hier aus didaktischen Gründen geändert, weil die Berücksichtigung der Selbstbestimmung, das Autonomieprinzip für pädiatrische, geriatrische und sonst nicht einwillensfähige Patienten, ein schwieriger und nicht endgültig zu beantwortender Baustein des ethischen Gebäudes darstellt.
1. Das Prinzip des Nicht-Schadens (nonmaleficence)
Primum nil nocere – in erster Linie nicht schaden: Jegliche Unternehmung, ob Handeln oder Nicht-Handeln, sollte dem Gegenüber keinen Schaden zufügen. Dieses Prinzip einer Schadensvermeidung erscheint zunächst selbstverständlich, kommt aber bei vielen Behandlungen in Konflikt mit dem Helfen; etwa dann, wenn der Erfolg einer Behandlung von einer vorherigen Beeinträchtigung abhängt, so etwa bei einer Impfung, einem vorsorglich vorgenommenen Eingriff, noch eklatanter bei einer Chemotherapie, am extremsten vor einer Knochenmarkstransplantation.
2. Gutes tun, Helfen (beneficence)
Das Prinzip, Gutes zu tun, besagt, das Wohl des Mitmenschen zu fördern und ihm Nutzen zu bringen. Auch das kann Handeln oder Nicht-Handeln sein. Dieses Prinzip der Fürsorge kann dem erstgenannten Prinzip des Nicht-Schadens entgegenstehen. Wenn ich zum Beispiel gegen eine Erkrankung impfe, verstoße ich gegen das erste Prinzip, um dem zweiten (vermeintlich) zu dienen. Es muss eine sorgfältige Abwägung von Nutzen und Schaden einer Maßnahme unter Einbeziehung der Wünsche, Ziele und Wertvorstellungen des Gegenübers vorgenommen werden. Was gut oder schlecht ist, unterliegt zudem situationsbezogenen normativen Ansichten: Im Krieg soll der Soldat seinen Gegner kampfunfähig machen, wenn nicht gar töten, was im Friedensalltag nicht erlaubt ist. Dieser Konflikt kann in vielen Fällen zu Verwirrung führen, man denke an das Problem des Tyrannenmordes.
3. Gleichheit und Gerechtigkeit (justice)
Noch schwieriger, weil noch mehr von komplexen Randbedingungen abhängig, ist das Prinzip der Gerechtigkeit: Zuwendungen und Leistungen sollen fair und gerecht verteilt werden, in ähnlichen Fällen sollte ähnlich gehandelt werden. Wenn eine Ungleichbehandlung notwendig ist, etwa bei der Vergabe von Spenderorganen zur Transplantation, sollten moralisch relevante und konsentierte Kriterien definiert werden: Bevorzugung von Kindern – oder „aussichtsreicheren“ Kandidaten. Angesichts der unterschiedlichen Ressourcenverteilung und der resultierenden großen Ungleichheit auf der Welt ist dieses Prinzip von großer Bedeutung und Strittigkeit, man denke etwa an die Situation der Bootsflüchtlinge aus Afrika.
4. Respekt vor der Autonomie (respect for autonomy)
Das Autonomieprinzip gesteht jeder Person Selbstständigkeit und Entscheidungsfreiheit zu. Es fordert ein informiertes Einverständnis (informed consent) vor jedweder diagnostischen und therapeutischen Maßnahme oder deren Unterlassung unter der Berücksichtigung des freien Willens, der Wünsche, Ziele und Wertvorstellungen des Patienten. Bei Kindern geht man vom Kindswohl (best interest of the child) aus, einem sehr unklaren Begriff aus dem Familienrecht. Bei anderweitig nicht einwillensfähigen Patienten kann der mutmaßliche Wille nicht geklärt und so muss stellvertretend entschieden werden, etwa über einen vorher einvernehmlich bestellten Betreuer, einen eingesetzten Vormund oder das Betreuungsgericht. Das führt im medizinischen Alltag häufig zu Pattsituationen und Fortführungen von sinnlosen Behandlungen, vor allem am Lebensende im Krankenhaus, besonders auf den Intensivstationen, aber auch in Pflegeheimen und in den Familien.
Was wirkt?
„Wer heilt, hat recht“, heißt es, und damit wird mehr oder weniger resigniert zugegeben, dass es nicht immer die naturwissenschaftliche Medizin ist, die dem Patienten geholfen hat. Nicht selten geht es dem Patienten trotz oder mit abstrusen, teuren und irrationalen Maßnahmen besser, sodass man sich die Frage stellen muss, was in der Therapie eigentlich wirkt.
Drei Faktoren wurden in der Vergangenheit herausgearbeitet, die als übergreifende Wirkfaktoren für alle auch noch so divergierenden Richtungen der Medizin gelten:2
Der erste Faktor ist der Beziehungsaspekt: Das Vertrauen in den Arzt, die Institution oder das Verfahren, die Wahl des Verfahrens, die Zuweisungsmodalität, die Persönlichkeit des Behandlers, seine Übertragungen und Gegenübertragungen sind hierunter zusammenzufassen.
Der zweite Faktor ist der Klärungsaspekt: Was liegt vor, welche Umstände haben dazu geführt, wie ist der zeitliche, räumliche, biografische Zusammenhang? Hier sind häufig detektivische Fähigkeiten notwendig, und nicht selten ist allein die sorgfältige Aufarbeitung des Problems, die genaue Anamnese, klärend und heilend.
Der dritte Faktor ist der Problembewältigungsaspekt: Was ist nun zu tun? Was wirkt, was heilt? Aber auch: Was erwartet der Patient, der Arzt? Wie begründet er seine Therapie? Die Lösung kann sich auf den verschiedensten Ebenen abspielen. Für einen Chirurgen ist ein Fall ein Einsatz des Skalpells – oder es ist kein „chirurgischer Fall“. Der Internist gibt Medikamente, der Homöopath Kügelchen, der Osteopath renkt, der Ernährungsmediziner stellt die Ernährung um – jeder nach seiner Ausrichtung und seinem Wissen. Eine allgemein akzeptierte Lösung nach nachvollziehbaren Kriterien gibt es selten. Das macht es dem Patienten schwer, zumal er nicht weiß, wessen Geistes Kind sein Gegenüber ist. Denn die Heilberufler sind ein merkwürdiges Völkchen. Bevor wir uns denen zuwenden, noch etwas Theorie.
Die Lebenskraft, die Seele und der Körper
„Die Kraft des Arztes liegt im Kranken.“
(Paracelsus, 1493–1541)
Es heilt: Vis medicatrix naturae – der innere Arzt des Menschen. Die Selbstheilungskraft ist der größte und einzige Wirkfaktor der Heilung, aber gleichzeitig auch der Feind der Gesundheitsindustrie.
Die Umgangssprache macht es deutlich: Es heilt. Es ist verheilt. Es wird schon heilen. Es. Wer oder was ist dieses Es? Eines der größten Rätsel der Natur, Quell und Ursprung des Lebendigen an sich.
Was ist Leben? Was unterscheidet einen Lebenden von einem frisch Verstorbenen? Die Organe sind gleich, die Muskeln und das Skelet sind gleich – nur das Leben ist gewichen. Früher gab es einmal Versuche, die Lebenskraft zu wiegen, indem man Sterbende gewogen und das Gewicht mit dem nach dem Tode verglichen hat. Der Unterschied von einigen Gramm wurde dann mit dem Gewicht des Lebens, der Seele gleichgesetzt. Ohne Lebenskraft ist weder Empfindung noch Bewegung noch Selbsterhaltung möglich, der Organismus zerfällt und verwest. Heute ist es etwa bei einer Nierentransplantation möglich, Organen wieder Funktion zu verleihen, sie wieder zu beleben, aber wiederum nur in einem lebenden Organismus. Freilich ist es dann notwendig, dem Empfänger des Organs einen Teil der Lebenskraft durch Immunsuppression zu rauben, damit seine eigene Lebenskraft, die, wie Samuel Hahnemann schreibt, „energisch, aber verstandlos und keiner Überlegung oder Fürsicht fähig ist“3, das übertragene Organ nicht wieder abstößt.
In der ihr innewohnenden Überheblichkeit maßt sich die Wissenschaft an, Leben zu erhalten oder gar zu erzeugen, wenn sie Zellkulturen entarteter Tumorzellen zu unsterblich erscheinenden Zelllinien züchtet oder hofft, aus pluripotenten Keimzellen demnächst Organe heranzuziehen. Der Homunkulus ist eine Vision des Menschen, seit er forschend tätig ist, aber seine Versuche sind rudimentär, und eher wird es einer künstlichen Intelligenz gelingen, sich selbst zu reproduzieren, als dem Menschen, einem Ding Leben einzuhauchen, einen lebendigen Organismus zu schaffen – so groß ist das Geheimnis des Lebens.
Die Lebenskraft wird bei Hippokrates (460–375 v. Chr.) als Physis, bei Paracelsus (1493–1541) als „Archaeus“ bezeichnet. Dieser Lebensgeist ist das dynamische Prinzip der Regulation, der „inwendige Arzt“ des Menschen. Die körperliche Lebenskraft ist bei ihm die „Mumie“, das „Arcanum“ des Menschen. Johan Baptista van Helmont (1579–1644) beschäftigte sich mit der spontanen Entstehung von Leben aus unbelebter Materie, auch Abiogenese genannt. Eingeführt wurde der Begriff der Lebenskraft durch Friedrich Casimir Medicus (1736–1808) im Jahr 17744 und durch die Vitalisten am Ende des 18. Jahrhunderts, ausdifferenziert besonders durch Christoph Wilhelm Hufeland, als Prinzip aller Lebensvorgänge, der Selbsterhaltung und der Regeneration. Samuel Hahnemann (1755–1843), der oft mit dem Begriff der Lebenskraft in Verbindung gebracht wird, bezog sich erst in seinem Spätwerk auf dieses Prinzip, wenngleich mit anderen Handlungskonzepten: denen der Homöopathie. Dessen ungeachtet hat Hahnemann sehr differenzierte und allgemeingültige Aussagen zur Lebenskraft publiziert: Er beschreibt sie in § 9 seines Organon 6 treffend wie folgt: „Im gesunden Zustande des Menschen waltet die geistartige, als Dynamis den materiellen Körper (Organism) belebende Lebenskraft (Autocratie) unumschränkt und hält alle seine Theile in bewundernswürdig harmonischem Lebensgange in Gefühlen und Thätigkeiten, so daß unser inwohnende, vernünftige Geist sich dieses lebendigen, gesunden Werkzeugs frei zu dem höhern Zwecke unsers Daseins bedienen kann.“5 Deutlich macht er hier, dass ein gesunder Körper kein Selbstzweck ist, sondern ein Werkzeug zu den höheren Zwecken unserer Existenz zu sein hat. Allerdings hat er keine besonders hohe Meinung von der Lebenskraft als „innerem Arzt“: So schrieb er: „Man sah in der gewöhnlichen Medicin die Selbsthülfe der Natur des Organisms bei Krankheiten, wo keine Arznei angewendet ward, als nachahmungswürdige Muster-Curen an. Aber man irrte sich sehr. Die jammervolle, höchst unvollkommne Anstrengung der Lebenskraft zur Selbsthülfe in acuten Krankheiten ist ein Schauspiel, was die Menschheit zum thätigen Mitleid und zur Aufbietung aller Kräfte unsers verständigen Geistes auffordert, um dieser Selbstqual durch ächte Heilung ein Ende zu machen.“6 Das Handlungsspektrum der Lebenskraft ist nur auf Dinge geprägt, die der Organismus kennt; auf Unbekanntes reagiert sie mit ihrem Repertoire, welches manchmal auch unangebracht ist und zu überschießenden oder Fehlreaktionen des Organismus führt.
Das Es und die Lebenskraft
In der Sprache der Psychoanalyse spielt das Es eine große Rolle. Gemäß dem Schichtmodell Sigmund Freuds gliedert sich die Persönlichkeit in drei Ebenen: das Es, das Ich und das Über-Ich. Ersteres ist das unbewusste, triebhafte, vegetative, animalische, selbsterhaltende, affektgesteuerte unkontrollierte Leben in uns, das zweite unsere gegenwärtige reale und selbstkritische Persönlichkeit, das dritte das verinnerlichte und von außen kulturell und biografisch vorgegebene Ich-Ideal. Bezogen auf Krankheit ist das Es das, was unkontrolliert in mir, in meinem Körper passiert, das Ich umfasst meine Wahrnehmung, Gefühle und Verarbeitung der Symptome, und das Über-Ich stellt die Kontrollinstanz dar, in der Rollen und Handlungsnormen festgeschrieben sind, die das Ich bewertet und die mir zum Beispiel „erlaubt“, krank zu sein. Ausdrücke wie „Mir ist schlecht“ machen deutlich, dass Beschwerden nicht dem „Ich“, sondern dem Es zugeordnet werden. „Mir geht es nicht gut“ bedeutet, dass es dem Es nicht gut geht, welches dem Ich ein Schnäppchen schlägt.
Das Es und die Seele
Rudolf Virchow (1821–1902) soll gesagt haben: „Ich habe Hunderte von Menschen operiert und nie eine Seele gefunden.“ Wir tun diesem großen Sozialmediziner Unrecht, wenn wir nur ebendieses Zitat herauspicken.
Wie und wo soll er sie auch gefunden haben? Die Seele ist etwas Immaterielles, aber wir wissen nicht, was. Griechisch psyche bedeutet „Hauch“, „Odem“, „Atem“, „Seele“, wovon sich Psychologie, die Lehre von der Seele, und auch Psychiater, der Arzt für die Seele, Psychotherapeut, der Behandler der Seele, ableitet. Der Seelsorger in engerem Sinne ist unerklärlicherweise der Theologie vorbehalten.
Das Atmen wird zu Recht als Zeichen des Lebens angesehen. Atemstillstand ist der Tod: Die Seele ist ausgehaucht. Früher wurde nach dem Tod eines Familienangehörigen das Fenster geöffnet, damit die Seele entweichen kann. Die Vorstellung, nach der die Seele dann woanders hinwandert, lebt weiter, ist die Grundlage für den Glauben an ein Weiterleben nach dem Tod, wie sie vielen Kulturen geläufig ist.
Zu allen Zeiten hat man sich Gedanken über die Seele gemacht. Für unseren westlichen Kulturkreis sind die griechischen Naturphilosophen maßgeblich: Für Platon (427–347 v. Chr.) war die Psyche, die Seele, geistartig und unsterblich: Sie lebt im Körper gefangen und wird durch den Tod befreit. Nun kann sie bis zur nächsten Wiedergeburt in die geistige Welt der Vorstellungen zurückkehren: Vorgeburtliches Seelenleben ist in diesem Denkmodell ebenso enthalten wie eine Wiedergeburt – die Reinkarnation. Nach Aristoteles (384–322 v. Chr.) hat die Psyche drei Facetten: Die vegetative Psyche, die Leben...