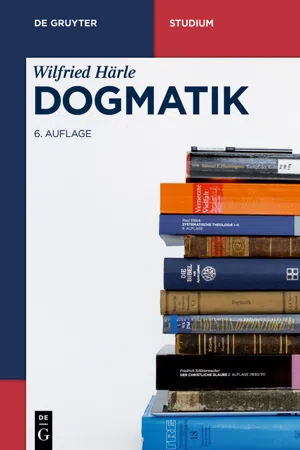
- 760 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Dogmatik
Über dieses Buch
Die Dogmatik stellt das Wesen des christlichen Glaubens dar und reflektiert das christliche Gottes- und Weltverständnis auf seinen Wahrheitsgehalt und seine Bedeutung hin. Wesentliche Anliegen dieser Dogmatik sind: Klarheit der verwendeten Begriffe, Anknüpfung an die biblische und kirchliche Tradition sowie Vermittlung mit der Erfahrung und dem Denken der gegenwärtigen Lebenswelt. 6., aktualisierte und korrigierte Auflage.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
Teil B: Das Weltverständnis des christlichen Glaubens
12 Die geschaffene Welt (Schöpfungslehre)
Die erste Bestimmung der Welt, die gemäß dem Verständnis des christlichen (wie des jüdischen und islamischen) Glaubens zu bedenken ist, lautet: Die Welt ist geschaffene Welt, genauer: sie ist Gottes Schöpfung. Damit wird eine zentrale Aussage aus der christlichen (und wiederum auch aus der jüdischen und islamischen) Gotteslehre aufgenommen: „Gott ist der Schöpfer der Welt” (s. o. 8.3.2) und nun daraufhin reflektiert, was sie über die Welt besagt. Es geht jetzt also nicht noch einmal darum, zu erläutern, was unter dem schöpferischen, daseinskonstituierenden Wirken Gottes zu verstehen ist. Die Aufgabe, die in diesem Kapitel vor uns liegt, besteht vielmehr darin, zu explizieren, welchen Sinn der Ausdruck „von Gott geschaffene Welt” bzw. „Welt als Schöpfung Gottes” hat (12.1) und was mit ihm über das Wesen und die Bestimmung der in der Welt existierenden Geschöpfe gesagt wird (12.2). Ferner ist zu prüfen, inwiefern diese Aussagen des christlichen Glaubens angesichts kritischer Anfragen, Einwände, ja massiver Bestreitungen aufrechterhalten werden können (12.3).
12.1 Der Sinn der Bezeichnung der Welt als „Schöpfung” oder als „geschaffen”
Auf die Frage, welchen Sinn die Bezeichnung der Welt als „Schöpfung” oder als „geschaffen” habe, scheint die Antwort nicht schwierig zu sein. Was könnte damit anderes gemeint sein, als daß Gott die Welt, also die Einheit und Gesamtheit alles Existierenden (s. o. 7.1.3) aus nichts hervorgebracht, also erschaffen habe. Gott wäre demnach so Schöpfer der Welt, wie ein Bildhauer der Schöpfer einer Statue oder ein Komponist der Schöpfer einer Sinfonie ist – mit dem einen entscheidenden Unterschied, daß Gott für seine Schöpfung kein ihm vorgegebenes Material (weder Stein noch Noten) brauchte. Sein Schaffen ist – als Schöpfung aus dem Nichts (creatio ex nihilo) – einzigartig. 1 Dementsprechend hieße „Welt als Schöpfung” oder „geschaffene Welt”: Sie ist das von Gott (aus dem Nichts) hervorgebrachte Werk, also die Wirkung und das Resultat seines Schaffens.
Wenn diese Antwort theologisch zutreffend und befriedigend wäre, dann wäre die Schöpfungslehre jedenfalls eine Alternative zu naturwissenschaftlichen Weltentstehungstheorien – möglicherweise auch zu naturwissenschaftlichen Weltentwicklungstheorien, also z. B. zur Evolutionstheorie. Sie wäre also selbst (jedenfalls auch) eine naturwissenschaftliche Theorie, die sowohl unvereinbar wäre mit der Annahme, die Welt sei „aus sich selbst” entstanden, als auch mit der Theorie, die Welt habe gar keinen Anfang, sei also anfangslos und in diesem Sinne „ewig”.
Als eine solche mit naturwissenschaftlichen Welterklärungstheorien konkurrierende Aussage ist die Bezeichnung der Welt als „Schöpfung Gottes” über lange Zeit hin verstanden worden – teilweise bis heute. Dabei macht es keinen grundlegenden Unterschied, ob jemand bei der Deutung der Welt als Gottes Schöpfung an der biblischen Vorstellung von einem Sechs-Tage-Werk 2 festhält oder sie zurücknimmt auf das Ingangsetzen der Evolution oder sie bloß als Auslösung des „Urknalls” versteht. Das Gemeinsame aller dieser Interpretationen besteht darin, daß die geschaffene Welt als Resultat einer Kausalbeziehung verstanden wird, deren Ursache Gott ist. Damit wird Gottes Wirken (und Sein) aber – vermutlich wider Willen – selbst zu einem Element welthafter Wirklichkeit erklärt, und demzufolge wird die Schöpfungsaussage zu einer Lehre, die mit naturwissenschaftlichen Theorien auf prinzipiell gleicher Ebene steht und darum mit ihnen konkurriert.3
Aber wie ist statt dessen die Relation zwischen Gott und Welt, Welt und Gott zu beschreiben, die dem angemessen ist, was die Begriffe „Schöpfung” oder „geschaffen” meinen? Um dem Begriff „Schöpfung” gerecht zu werden, kann es sich nicht um eine beliebige, verzichtbare Relation handeln, und es kann sich nicht um eine seitens der Welt gewählte Beziehung handeln, sondern es muß sich um ein mit dem Dasein der Welt gegebenes und für das Dasein der Welt konstitutives Bezogensein handeln. Was heißt das?
12.1.1 Geschaffensein als konstitutives Bezogensein der Welt auf Gott
Der Begriff „Schöpfung” kann sowohl den Akt des Erschaffens als auch dessen Resultat, also das Geschaffene als Geschaffenes bezeichnen. Auf dieses Letztere richtet sich hier, wo es um das Weltverständnis des christlichen Glaubens geht, vorrangig das Interesse. Es geht also um das eine Element (Relat) der Relation, die mit dem Begriff „Schöpfung” bezeichnet wird, nämlich: die geschaffene Welt. Freilich zeigte sich schon bei diesen ersten Vorüberlegungen, daß das, was mit „geschaffen” gemeint ist, nur hinreichend klar verstanden werden kann, wenn die Art der Relation, die mit dem Begriff „Schöpfung” bezeichnet werden kann, zutreffend beschrieben wird.4 In jedem Fall handelt es sich um eine Relation, ohne die die Welt nicht wäre, die also für das Dasein der Welt konstitutiven Charakter hat, und zwar handelt es sich um eine Relation zu einer Wirklichkeit, die ihrerseits nicht welthaft oder Teil der Welt sein kann, sondern göttlich, also Gott ist. Damit ist dreierlei zu denken aufgegeben:
- zunächst die wesensmäßige, kategoriale Verschiedenheit zwischen Welt und Gott, die mit der Kennzeichnung „geschaffene Welt” (und „Gott als Schöpfer der Welt”) ausgesagt wird (12.1.1.1);
- sodann die Verbundenheit der Welt mit Gott, die in dem Ausdruck „geschaffene Welt” (und „Gott als Schöpfer der Welt”) vorausgesetzt ist (12.1.1.2);
- schließlich die Einheit von Wesensverschiedenheit und Verbundenheit zwischen Welt und Gott, die in diesen Aussagen enthalten ist (12.1.1.3).
12.1.1.1 Die Wesensverschiedenheit zwischen Welt und Gott
Vergleicht man Schöpfungsvorstellungen anderer Religionen und Kulturen mit denen des Judentums, des Christentums und des Islam, dann zeigt sich, daß die grundlegende Unterscheidung zwischen Gott und Welt, wie sie in der biblisch-christlichen sowie in der islamischen Überlieferung durchgängig vorausgesetzt wird, in gewisser Hinsicht nicht selbstverständlich ist.5 Zwar setzt der Schöpfungsgedanke stets eine Unterscheidung zwischen Schaffendem und Geschaffenem, Schöpfer und Geschöpf voraus, aber diese Unterscheidung hat keineswegs immer den Charakter eines Wesensunterschiedes. „Schöpfung” ist in der Religions- und Philosophiegeschichte gelegentlich so gedacht worden, daß die Welt aus der Gottheit (oder aus den Göttern) hervorgeht. Dabei kann ganz konkret-materiell die Rede sein vom Zeugen der Gottheit oder vom Schoß der Gottheit, aus dem die Welt geboren wird, oder es kann davon gesprochen werden, daß die Welt aus dem Blut oder Leib der Gottheit(en) – u. U. nach einem Götterkampf – entstanden sei. Philosophisch reflektiert findet diese Vorstellung ihren Ausdruck im neuplatonischen Gedanken der Emanation (= Ausfluß, Ausströmen) aus dem einen göttlichen Urprinzip, durch das – vermittelt über mehrere Stufen – die Welt entsteht. Charakteristisch für alle diese Vorstellungen ist, daß Gott und Welt wesensgleich, ja wesenseins sind – wenn auch nicht in jedem Fall total, so doch partiell. Unter dieser Denkvoraussetzung ist es darum auch prinzipiell möglich, „Schöpfung” oder „Erschaffung” in umgekehrter Richtung zu denken als ein Hervorgehen der Gottheit(en) aus der Welt, also als Theogonie.
Die Vorstellung von einer Wesenseinheit zwischen Gott und Welt ist dem jüdisch-christlichen Glauben (ebenso dem Islam) fremd.6 Und deswegen ist auch der Gedanke, Gott könne ein Geschöpf der Welt sein, für Judentum, Christentum und Islam eine Absurdität oder Blasphemie. Und wo etwas Ähnliches in der Bibel als Gedanke auftaucht (z. B. Jes 44,9 – 20 u. Act 17,29), ist es Anlaß und Gegenstand des Spottes. Entscheidend ist dabei die Bestreitung der Grundvoraussetzung, zwischen Gott und Welt bestehe eine (zumindest partielle) Wesenseinheit. Demgegenüber unterscheidet der christliche Glaube auch zwischen der Welt, die geschaffen und deshalb nicht von Gott gezeugt oder aus Gott geboren ist, und dem ewigen „Sohn” oder Logos Gottes, von dem gesagt wird: Er ist von Gott „gezeugt” und „geboren”, aber eben insofern nicht geschaffen (s. o. 11.3.1).
Gegenüber vielen Schöpfungsmythen und anderen Schöpfungslehren ist dies eine „Säkularisierung” oder – wie Max Weber in Aufnahme einer Formulierung von Friedrich Schiller formuliert hat – eine „Entzauberung der Welt”7. Diese Entzauberung ist mit Händen zu greifen an der Kennzeichnung von Sonne, Mond und Sternen, die in der antiken – und gegenwärtigen! – Religiosität häufig als Gottheiten verehrt wurden und werden, als bloße Lampen oder Lichter, die der Orientierung anderer Geschöpfe dienen (Gen 1,14 – 19). Ob diese Entzauberung der Welt nicht auch etwas Gefährliches und Problematisches ist, weil damit zugleich ein rücksichtslos-ausbeuterischer Umgang mit der Welt vorbereitet, erleichtert oder gar in Gang gesetzt wurde, wird noch (s. u. 12.2.2.3) zu prüfen sein. Hier ist zunächst festzuhalten: Der christliche Glaube denkt Gott und Welt, Schöpfer und Schöpfung als voneinander unterschieden, und zwar – wie früher (s. o. 2.3.2.1) gezeigt – als kategorial verschieden. Aber gerade weil der Unterschied kategorial zu denken ist, darum schließt...
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Vorwort
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitungsteil
- Hauptteil I: Rekonstruktion des Wesens des christlichen Glaubens
- Hauptteil II: Explikation des christlichen Wirklichkeitsverständnisses
- Teil A: Das Gottesverständnis des christlichen Glaubens
- Teil B: Das Weltverständnis des christlichen Glaubens
- Bibelstellenregister
- Personenregister (ohne biblische Namen)
- Begriffsregister
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu Dogmatik von Wilfried Härle im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theology & Religion & Christian Theology. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.