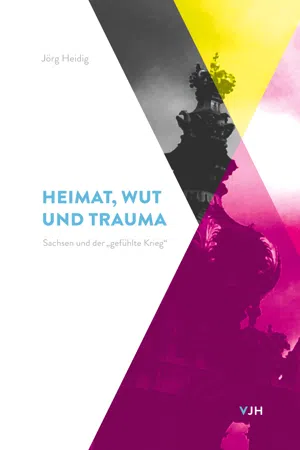
- 112 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Viele Sachsen sind dieser Tage sehr wütend. Erst das Thema Migration, jetzt Corona. Manche setzen sogar die heutigen Proteste mit denen des Jahres 1989 gleich und fühlen sich wie damals. Dieses Buch geht der Frage nach, wie es zu den aktuellen Polarisierungen kommen konnte und was daraus folgt. Das Fazit fällt nicht besonders optimistisch aus: Für den Modus "Zuhören und Reden" scheint es in Sachsen an vielen Stellen einstweilen zu spät zu sein.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Heimat, Wut und Trauma von Jörg Heidig im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politique et relations internationales & Politique. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information

ZU BEGINN EINE BÖSE FRAGE:
GING VIELLEICHT ALLES ZU SCHNELL?
Zur Wende wollten viele von uns ein anderes Leben. Was dann passierte, wurde aber „doppelt anders“. Das neue Leben ging zwar los wie gewünscht (bessere Autos, Reisen, besser einkaufen usw.). Aber jenseits des Reisens und Einkaufens wusste kaum jemand, wie die neuen Zeiten eigentlich funktionieren. Nur wenige haben vorhergesehen, dass eine schnelle Wiedervereinigung auch unerwünschte Ergebnisse zeitigen würde – und denjenigen hat man damals nicht zugehört.
Es ist ziemlich normal, dass man im Leben das eine will, mit der Zeit aber etwas anderes bekommt. Das mag uns zwar rational klar sein, emotional sind wir Ostdeutschen aber mehrheitlich auf Idealzustände konditioniert. Den Sozialismen war ja eigen, dass man als Teil der Volksgemeinschaft oder als real existierender sozialistischer Mensch auf dem Weg ins Paradies des gesellschaftlichen Idealzustands ist. Die Mühen auf diesem Weg hat man gern außer Acht gelassen – bekanntermaßen bis hin zum völligen Realitätsverlust.
Und ja, dieser Realitätsverlust wurde auch kollektiv zelebriert. Wir haben mitgemacht, mussten mitmachen, wurden so erzogen. Wir wussten ganz genau, was man wo sagen kann und was nicht – und was man sagen muss, wenn man in Hörweite der Offiziellen oder auch Inoffiziellen war oder an einer der öffentlichen Zelebrationen teilnehmen sollte.
Zurück zu dem, was wir vielleicht gewollt haben könnten: Schwierig kann das insbesondere dann werden, wenn man nur weiß, was man nicht möchte und von dem, was man möchte, nur ein unscharfes Bild hat. Am einfachsten hatten es deshalb vielleicht diejenigen Ostdeutschen, die wussten, was sie wollten – und weggegangen sind.
Die Frage ist, was unter denjenigen, die geblieben sind, passiert ist.
HEIMAT UND AFFEKT
Die DDR war ja keineswegs die „Heimat“, zu der sie gern verklärt wird. Bei diesem Heimatbegriff handelt es sich um die kollektive Projektion einer „Affektgemeinschaft“, die keineswegs alle Ostdeutschen, aber eben einen nicht geringen Teil umfasst.
Als Gegengift könnte man sich an die damaligen Tatsachen erinnern: Man stelle sich einen Wintermorgen in Görlitz in den späten Achtziger Jahren vor. Man muss früh das Haus verlassen. Der typische Geruch verbrannter Braunkohlenbriketts liegt in der Luft. Der Nachbar versucht, seine Pappe anzukriegen, was bei Minusgraden nicht immer einfach ist. Man läuft an entsetzlich verfallenen Fassaden vorbei zur Straßenbahnhaltestelle. Und so weiter.
Reicht das schon?
Es würde im Zweifelsfall helfen, sich reale Dokumentationen aus der Wendezeit anzusehen. Die DDR war schon länger pleite, als sie 1989 zusammenbrach. Aber die Mitglieder jener „Affektgemeinschaft“ verweigern sich an dieser Stelle, und jedes Argument, das mit „Tatsachen“ daherkommen möchte, wird zur empfundenen Belehrung, hilft also nicht.
WAS IST NACH DER WENDE PASSIERT?
Im Prinzip ließen sich seinerzeit vier wesentliche persönliche Reaktionsmuster auf die Wende und die Zeit danach beobachten:
Nichts wie weg hier: Wie bereits erwähnt gab es diejenigen, die weggegangen sind, um woanders entsprechend vielfältigere oder bessere Möglichkeiten zu haben.
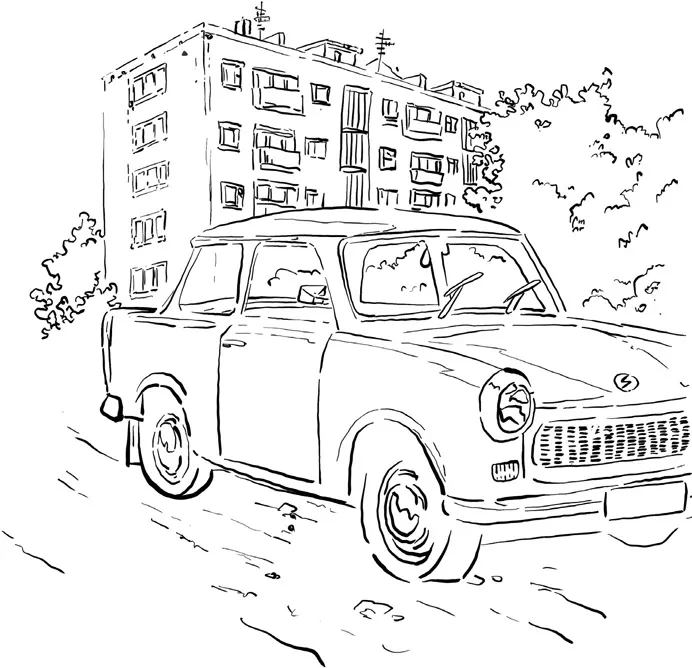
Neue Zeiten? Welche neuen Zeiten? Demgegenüber gab es eine ganze Reihe von Menschen, die sich mehr oder minder von vornherein abgewendet haben und mit den „neuen Zeiten“ nichts zu tun haben wollten. In vielen Befragungen sind diese „DDR-Nostalgiker“ lange als eine eher kleine, aber stabile Gruppe aufgetaucht. Die über Jahrzehnte hinweg recht hohen Wähleranteile der heutigen Linkspartei und ihrer Vorgängerpartei in den ostdeutschen Bundesländern sprechen ebenfalls für sich.
Zuletzt sind diese Wähleranteile signifikant eingebrochen, was als ein Zeichen dafür gewertet werden kann, dass diese Gruppe mittlerweile eher klein ist und irgendwann verschwindet – was nicht bedeutet, dass die romantischen Gefühle, die mit der DDR verbunden sind, ebenfalls verschwinden. Im Gegenteil: Aktuell wirkt manche Popularisierung von DDR-Produkten (bspw. Mopeds) wie eine Renaissance der DDR-Nostalgie. Allerdings haben sich hier, so fürchte ich, die Vorzeichen geändert.
DIE „TRANSZENDIERTE UNTERLEGENHEIT“
Was bei den einen eine harmlose Kultur-Renaissance sein mag (bspw. größere Gruppen vornehmlich recht junger S50-Fahrer an den Wochenenden), hat bei anderen eine tiefere, eher affektive und damit deutlich energischere oder im Extremfall auch aggressivere Bedeutung: An Ostdeutschland festzuhalten, erscheint im Extremfall, wie sich an einer Standarte festzuhalten, auf der steht, dass man lieber „stehend sterben“ als „kniend leben“ möchte.
Hier handelt es sich um die Reaktion auf eine „transzendierte Unterlegenheit“: Man deutet die Vergangenheit so um, dass sie zum positiven identitätsstiftenden Merkmal wird. Die DDR erscheint nun als etwas, das sie nie war – und man ist im gleichen Atemzug wütend auf das, was gerade ist.
WIE WÜTEND WÄREN SIE WOHL, WENN ES DIE REAL EXISTIERENDE DDR NOCH GÄBE?
Für die Vertreterinnen und Vertreter dieses Geistes wäre eine durchaus heilsame Frage diese: Wie wütend wären Sie wohl, wenn es die real existierende DDR noch gäbe? Wie groß wäre dann Ihre Sehnsucht nach dem, was wir jetzt haben? Aber freilich sind solche Fragen angesichts der gegenwärtigen Affektdynamik gerade in Sachsen weder stell- noch beantwortbar. ;-)
Quasi zwischen den beiden genannten Polen (weggegangen vs. nostalgisch zurückschauend) stehen drittens diejenigen, die die Wende als Anfang von etwas Neuem verstanden haben und geblieben sind.
Das klingt komisch, negativ irgendwie: „...und geblieben sind.“ Man sagt ja, wenn man etwas schreibt, auch etwas über sich: Ja, ich bin auch geblieben. Gern sogar. Oder wenn man es so will: Ich bin nach ein paar Jahren im Ausland wiedergekommen. Macht eine solche Rückkehr wirklich einen Unterschied in den Sichtweisen? Das müsste man tatsächlich einmal messen.
In jedem Fall sollte es sich bei dieser dritten Gruppe um die weitaus größte der bisher beschriebenen Gruppen handeln: diejenigen also, die wollten und endlich auch konnten. Diese Gruppe war keinesfalls homogen. Hier waren „irgendwie alle“ dabei – jung und alt, systemfern oder -nah, optimistisch oder pessimistisch, ausländerfreundlich oder ausländerfeindlich, fromm oder atheistisch, eher offen oder erstmal skeptisch...
ERFOLGREICH ODER ENTTÄUSCHT?
Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden (sinngemäß nach Sören Kierkegaard), und so hat sich diese große und heterogene Gruppe später geteilt, und zwar in die, die Hoffnung hatten und erfolgreich wurden, und jene, die zwar Hoffnung hatten, aber später enttäuscht wurden. Letztere bilden dann die vierte Variante der oben genannten Reaktionsmuster.
Aber was ist eigentlich „Erfolg“? Naheliegen würde, sich auf wirtschaftlichen Erfolg zu konzentrieren. War man also als Unternehmer, Mitarbeiter oder Führungskraft erfolgreich? Das war im Ostdeutschland der Neunziger Jahre tatsächlich eine existentielle Frage: Habe ich einen vernünftigen Job? An dieser Frage sind nicht wenige Biographien zerbrochen.
Das würde zu der Frage führen, ob man es geschafft hat, in der Nachwendewelt erfolgreich eine Rolle zu spielen – was über den wirtschaftlichen Erfolg hinaus bspw. auf die Felder der Kunst oder der Familie erweitert werden müsste. Man kann als Elternteil oder Künstlerin durchaus erfolgreich gewesen sein, ohne dass sich das wirtschaftlich spürbar niedergeschlagen haben muss.
OPTIMISTISCH ODER PESSIMISTISCH?
Das bedeutet, dass man nicht nur nach Erfolg fragen, sondern die Frage weiter fassen sollte. Die eigentliche Frage sollte meines Erachtens lauten, ob man in der Nachwendezeit optimistisch geblieben ist oder enttäuscht wurde oder irgendwie anders zum Pessimismus gekommen ist. Eine der großen Lebensfragen – im wissenschaftlichen Sinne: eine der wesentlichen Einflussvariablen in Bezug auf die Lebenszufriedenheit – lautet: Hat man in Bezug auf das eigene Leben Hoffnung oder nicht?
Hier spielen individuelle Erwartungen und entsprechende Prägungen ebenso eine Rolle wie gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Möglichkeiten. Die „Wahrnehmung der Möglichkeiten“ ist dabei eine eher individuelle Variable, während die „tatsächlich möglichkeitsbestimmenden“ Variablen eher gesellschaftlicher oder politischer Natur sind: Ich kann also zum Beispiel hohe oder niedrige Erwartungen an meinen Erfolg in einer freien Gesellschaft haben (zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika), oder ich kann ebensolche Erwartungen an meinen Erfolg in einem Staat haben, der nur wenige (zum Beispiel Bosnien-Herzegowina) oder gar keine freien Möglichkeiten bietet (bspw. Afghanistan).
Nehmen wir einmal an, dass entsprechende Erwartungen in Deutschland zum Erfolg führen können, dass die Möglichkeiten aber regional unterschiedlich verteilt sind (Stadt versus Land, und ja: auch West versus Ost).
GUTE ABSICHT SCHÜTZT NICHT DAVOR, DASS ES SCHIEF GEHT
Wenn wir jetzt noch annehmen, dass nach der Wende viele derjenigen mit hohen Erwartungen weggegangen sind, und wenn wir des Weiteren annehmen, dass es statistisch durch den Umstand, dass der Osten im Prinzip „gekauft“ und „übernommen“ wurde (hohe Sozialleistungen bei gleichzeitig hoher Übernahmerate ostdeutscher Wirtschaftsstrukturen durch Unternehmen aus dem Westen), zu einer signifikanten Unterrepräsentation Ostdeutscher in Führungsstrukturen gekommen ist, und wenn wir zudem annehmen, dass viele ostdeutsche „Mittelständler“ (was vor der Wende de facto gleichbedeutend mit Handwerkern oder Einzelhändlern war) die neuen Kulturtechniken (Angebote, Preisverhandlungen mit entsprechender Strategie und Taktik und nicht mehr vor allem über „Beziehung“ oder „Vertrauen“) erst einmal erlernen mussten, dann wird deutlich, wie groß die Lücke war – und wie schnell diese Lücke mit westdeutschen Führungskräften, Importbeamten usw. gefüllt wurde.
Aus einem von den meisten herbeigewünschten bzw. mindestens befürworteten politischen Traum wurde schnell ein Markt der wirtschaftlichen und politischen Möglichkeiten – zunächst in Konkurrenz mit denjenigen, die in den Startlöchern standen und im Westen keine so schönen Möglichkeiten bekommen hätten.
So ist das vielleicht, wenn man – mit guter Absicht – ein Land „kauft“ bzw. „übernimmt“: Man hilft kurzfristig, langfristig gibt es mindestens einen „Kater“ mit entsprechend schlechter Laune.
PROJEKTION UND WUT
Diese „schlechte Laune“ betrifft weniger diejenigen, die erfolgreich wurden und noch immer optimistisch sind, sondern mehr jene, die optimistisch gestartet sind und später enttäuscht wurden – wobei man eben anerkennen muss, dass eine Enttäuschung neben den personenbezogenen Ursachen auch durch von der betroffenen Person unabhängige Faktoren hervorgerufen werden kann. Manche können kaum etwas dafür und werden zum Opfer etwa mieser Vorgesetzter oder ungünstiger Umstände, bei anderen ist es umgekehrt, die meisten Fäl...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Sachsen und der „gefühlte Krieg“
- Heimat, Wut und Trauma
- Was wir eigentlich wollten und was daraus geworden ist
- Buchempfehlung: Die Kultur der Hinterfragung
- Hinweise
- Impressum