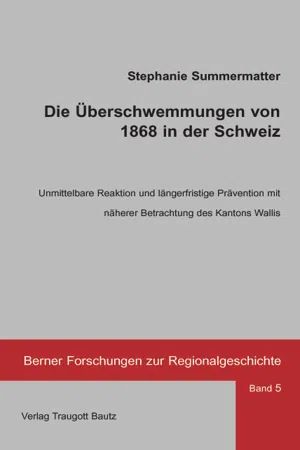
eBook - PDF
Die Überschwemmungen von 1868 in der Schweiz
Unmittelbare Reaktion und längerfristige Prävention mit näherer Betrachtung des Kantons Wallis
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - PDF
Die Überschwemmungen von 1868 in der Schweiz
Unmittelbare Reaktion und längerfristige Prävention mit näherer Betrachtung des Kantons Wallis
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
1 EINLEITUNG
1.1 Fragestellung
1.2 Die Fragestellung im Kontext der Umweltgeschichte
1.3 Quellenlage und offene Fragen
1.4 Forschungsstand
1.5 Aufbau
2 DIE ÜBERSCHWEMMUNGEN VON 1868 IN IHREM KONTEXT
2.1 Naturkatastrophen
2.1.1 Von der "Naturgefahr" zur "Naturkatastrophe" - ein Definitionsversuch
2.1.2 Katastrophenmanagement: Bewältigung und Vorsorge
2.2 Das Wallis im 19. Jahrhundert
2.2.1 Politische und wirtschaftliche Entwicklung des Wallis
2.2.1.1 Die politischen Wirren des 19. Jahrhunderts
2.2.1.2 Die wirtschaftliche Situation im 19. Jahrhundert
2.2.2 Naturgefahren, Naturkatastrophen und deren Bewältigung im Wallis des 19. Jahrhunderts
2.3 Das Ereignisjahr 1868
2.3.1 Die Naturereignisse des Jahres 1868 im Wallis
2.3.2 Die Relevanz der Überschwemmungen von 1868 für die betroffene Bevölkerung in der Schweiz
Teil I: Unmittelbare Reaktion: Spendensammlung & -verteilung
3 SOLIDARITÄT UND INTEGRATION
3.1 Solidarität
3.1.1 Der Begriff "Solidarität"
3.1.2 Definition und Anwendung auf die Hilfsaktionen 1868
3.2 Die drei Ebenen der Integration
3.3 Integration und Solidarität in der Schweiz des 19. Jahrhunderts
3.3.1 Integration im jungen Bundesstaat
3.3.2 Solidarität und Liebesgabensammlungen
4 DIE DARSTELLUNG DER ÜBERSCHWEMMUNGEN IN DER PRESSE UND DIE ORGANISATION DER SPENDENSAMMLUNG
4.1 Die Darstellung der Überschwemmungen von 1868 in der Presse
4.1.1 Die Bedeutung der Medien
4.1.2 Die Berichterstattung in der Schweizer Presse
4.1.3 Die Berichterstattung in der Walliser Presse
4.1.3.1 Einleitende Vorbemerkungen
4.1.3.2 Die Berichterstattung im Walliser Wochenblatt und im Le Confédéré
4.1.4 Differenzen in der Berichterstattung
4.1.4.1 Schweizer Presse versus Walliser Presse
4.1.4.2 Das Walliser Wochenblatt versus Le Confédéré
4.2 Schritte in Richtung organisierte Spendensammlung
4.2.1 Erste Reaktionen der Kantone und des Bundesrates
4.2.2 Die erste Konferenz der Kantonsdelegierten im Oktober 1868
4.2.2.1 Die Einberufung der Konferenz
4.2.2.2 Die Beschlüsse der Konferenz
4.2.3 Parallelen zur Organisation von 1834
4.3 Spendenaufrufe und Spenden
4.3.1 Die Spendenaufrufe und ihre Sprache
4.3.1.1 Die Aufrufe des Bundes und der Kantone
4.3.1.2 Die Aufrufe aus dem Ausland
4.3.2 Die Spenden
4.3.2.1 Methodische Vorbemerkung
4.3.2.2 Spenden und Spendenverlauf
4.3.2.3 Die geographische Herkunft der Spendengelder
4.3.2.4 Initianten und Spender
4.4 Das Eidgenössische Zentralhilfskomitee und seine Aufgaben
4.4.1 Die Instruktionen des Bundesrates
4.4.2 Die Tätigkeit des Eidg. Zentralhilfskomitees
4.4.2.1 Der administrative Aufbau der Hilfsorganisation
4.4.2.2 Die Zusammenarbeit mit den Geberkantonen: Verwaltung der Naturalien
4.4.2.3 Die Zusammenarbeit mit den betroffenen Kantonen
4.4.2.4 Schwierigkeiten im Umgang mit der Spendenflut
5 DIE SCHADENSCHÄTZUNGEN UND DIE VERTEILUNG DER SPENDEN
5.1 Die Erhebung der Schäden durch die Schätzungs- kommission
5.1.1 Die Instruktionen der Schätzungskommission
5.1.2 Die Verteilung der Schäden in den betroffenen Kantonen
5.1.3 Die Schätzungskommission Sektion Wallis und die Schäden im Kanton
5.2 Die Diskussion um die Verwendung der Spenden: Prävention versus Almosen
5.2.1 Die Vorschläge des Zentralhilfskomitees für die Verteilung der Spenden
5.2.1.1 Die Meinungsumschau zur Verteilung der Spenden
5.2.1.2 Die Vorschläge des Zentralkomitees
5.2.2 Die Konferenz vom 4. April 1869 und ihre Beschlüsse
5.2.2.1 Diskussion und Beschlüsse der Konferenz
5.2.2.2 Vergleich mit der Diskussion von 1834
5.2.3 Die Verteilung der Spenden unter den betroffenen Kantonen
5.2.4 Die Verteilung im Kanton Wallis
5.2.4.1 Das Kantonalkomitee und die Lokalkomitees
5.2.4.2 Die Verteilung der Spenden und ihre Verwendung
5.2.5 Beurteilung der Verwendung und Verteilung
6 FAZIT I
6.1 Die Akteure
6.1.1 Nationale Akteure
6.1.2 Betroffene
6.1.3 Nicht-Betroffene
6.2 Die Spendenflut von 1868 als Ausdruck von Solidarität
6.3 Die Spendenaktion als Ausdruck und Verstärkung nationaler Integration
Teil II: Längerfristige Reaktion: Prävention & Zentralisierung
7 LERNPROZESSE IM SCHWEIZERISCHEN HOCHWASSER- SCHUTZ
7.1 Lernen aufgrund von Katastrophen
7.1.1 Lernprozesse und Naturkatastrophen
7.1.2 Der Wandel im Umgang mit Gefahren und Risiken
7.2 Hochwasserschutzkonzepte im Wandel - Flusskorrektionen in der Schweiz
7.2.1 Die Organisation des Hochwasserschutzes bis ins 19. Jahrhundert
7.2.2 Flusskorrektionen in der Schweiz im 19. Jahrhundert
7.2.3 Ausblick: Hochwasserschutzkonzepte im Wandel der Zeit
8 DIE ERSTE RHONEKORREKTION (1860-1887)
8.1 Das Wuhrwesen im Wallis vor der ersten Rhonekorrektion
8.1.1 Die Wuhrbauten an der Rhone vor 1800
8.1.2 Erste Bestrebungen zur einheitlichen Regelung im 19. Jahrhundert
8.1.3 Die Kosten für die Rhonearbeiten in den Gemeinden
8.1.4 Positive und negative Folgen der Bestrebungen
8.2 Die erste Rhonekorrektion (1860-1887)
8.2.1 Die Überschwemmungen von 1860
8.2.2 Das Gesuch des Kantons Wallis und erste Vorschläge für eine einheitliche Rhonekorrektion
8.2.3 Das erste Projekt des Kantons Wallis vom 4. Dezember 1860
8.2.4 Die eidgenössischen Experten und ihre Berichte (1861-1862)
8.2.5 Das zweite Projekt des Kantons Wallis und das Dekret vom 29. November 1862
8.2.6 Die Entscheidung: Kommissionsberichte und Bundesbeschluss (1863)
8.2.7 Die Ausführung der ersten Rhonekorrektion
8.2.7.1 Die Kontrolle der Arbeiten und die finanzielle Belastung der Gemeinden
8.2.7.2 Die erweiterte Bundeshilfe von 1878 und 1884
8.3 Wirkung und Vollendung der ersten Rhonekorrektion
9 DIE URSACHENDISKUSSION VON 1868 UND DIE ENTWICKLUNG DER EIDGENÖSSISCHEN FORST- UND WASSERBAUPOLIZEI-GESETZGEBUNG
9.1 Die Entwicklung des "Abholzungsparadigmas" in der Schweiz
9.2 Die Ursachendiskussion in den 1860er Jahren
9.2.1 Die Berichte über die Hochgebirgswaldungen und die Wildbäche
9.2.1.1 Anregungen für eine Untersuchung
9.2.1.2 Elias Landolts Bericht über die Hochgebirgswaldungen (1862)
9.2.1.3 Carl Culmanns Bericht über die Wildbäche (1864)
9.2.2 Die Frage nach den Ursachen der Überschwemmungen von 1868
9.2.2.1 Die offiziellen Berichte über die Ereignissen von 1868
9.2.2.2 Weitere Beiträge zur Ursachendiskussion
9.2.3 Der Wandel der Forderungen in den 1860er Jahren
9.3 Die Verwendung der Wuhrmillion
9.4 Der Subventionsbeschluss von 1871
9.4.1 Das Ringen um finanzielle Unterstützung in den 1860er Jahren
9.4.2 Der erneute Vorstoss des Schweizerischen Forstvereins
9.4.3 Der Subventionsbeschluss von 1871 als Folge der Überschwemmungen und die Verwendung der Gelder im Kanton Wallis
9.5 Die Entwicklung der eidgenössischen Forst- und Wasserbaupolizeigesetzgebung in den 1870er Jahre
9.5.1 Die veränderte Stellung des Bundes und die Entwicklung, Interpretation und Umsetzung von Artikel 24 der Bundesverfassung
9.5.2 Das eidgenössische Forstpolizeigesetz von 1876
9.5.2.1 Der Inhalt des Forstpolizeigesetzes
9.5.2.2 Die Diskussion um den Geltungsbereich des Gesetzes und die Kompetenz des Bundes
9.5.3 Das eidgenössische Wasserbaupolizeigesetz von 1877
9.5.3.1 Der Inhalt des Wasserbaupolizeigesetzes
9.5.3.2 Die Diskussion um die Kompetenzen des Bundes
9.6 Die Umsetzung der Forderungen und die Wirkung der Gesetzgebung
10 FAZIT II
10.1 Die Akteure
10.1.1 Bundesrat und Parlament
10.1.2 Die Experten und der Schweizerische Forstverein
10.1.3 Kantonale Akteure
10.2 Politische Integration im legislativen Prozess nach 1868
10.3 Lernprozesse im präventiven Umgang mit Überschwemmungen vor und nach 1868
SCHLUSSBETRACHTUNGEN
11.1 Solidarität und die Verstärkung eines nationalen Wir-Bewusstseins
11.2 Der Prozess nach 1868 als Fortschritt in der politischen Integration
11.3 Lernprozesse vor und nach den Überschwemmungen von 1868
11.4 Katastrophenmanagement im 19. Jahrhundert?
VERZEICHNISSE
13 QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS
13.1 Quellen
13.2 Literatur
14 ANHANG
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Überschwemmungen von 1868 in der Schweiz von Stephanie Summermatter im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus History & World History. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
HistoryThema
World HistoryInhaltsverzeichnis
- Inhaltverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 2 Die Überschwemmungen von 1868 in ihrem Kontext
- 3 Solidarität und Integration
- 4 Die Darstellung der Überschwemmungen in der Presse und die
- 5 Die Schadenschätzungen und die Verteilung der Spenden
- 6 Fazit I
- 7 Lernprozesse im schweizerischen Hochwasserschutz
- 8 Die erste Rhonekorrektion (1860–1887)
- 9 Die Ursachendiskussion von 1868 und die Entwicklung der ei
- 10 Fazit II
- 11 Schlussbetrachtungen
- 12 Verzeichnisse
- 13 Quellen- und Literaturverzeichnis
- 14 Anhang