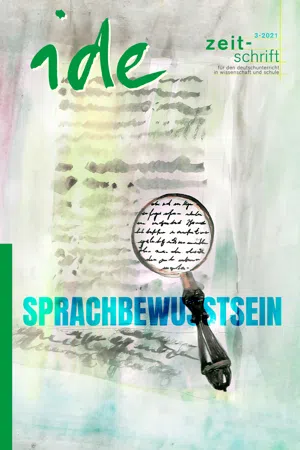![]()
Ann Peyer
Erfahrungsbezogene Zugänge zu Sprachbewusstsein
Die aktuelle fachdidaktische Diskussion betont, dass Sprachbewusstsein im Lernbereich »Sprachreflexion« ein zentrales Element ist. Kinder und Jugendliche sollen sich ihrer diesbezüglichen Ressourcen bewusst werden und im Unterricht ihre sprachbezogenen Erfahrungen und (Prä-)Konzepte formulieren und bearbeiten. Um diesen Anspruch zu realisieren, sind nicht nur geeignete Materialien, sondern auch methodische Konzepte wichtig, auch deshalb, weil viele Lehrerinnen und Lehrer aus eigener Erfahrung nur traditionellen, auf grammatische Fachbegriffe ausgerichteten Unterricht kennen. Anhand von erprobten Beispielen wird exemplarisch gezeigt, wie Jugendliche verschiedene Aspekte von Sprache (Gebrauch und System) so bearbeiten, dass sie sich reflexiv mit Sprache(n) auseinandersetzen und gleichzeitig ihr sprachliches Handeln gezielt gefördert wird.
Zwei Schülerinnen (9. Klasse) diskutieren einen längeren Instagram-Post1 und arbeiten heraus, warum der Text aggressiv wirkt:
Katy: […] zum Beispiel hier sieht man so »OK« und dann ganz groß geschrieben. Das zum Beispiel – wenn ich jemandem OK schreibe, dann bin ich komplett am Ausrasten.
Sina: ich hasse es, wenn jemand OK schreibt, denn dann weiß ich nie, ob die Person jetzt grad BÖSE auf mich ist oder genervt.2
Katy und Sina formulieren ihre Eindrücke von einer bestimmten Textstelle sehr konkret, und vor allem beziehen sich beide auf eigene Erfahrungen – sie sprechen also über etwas, das ihnen vertraut ist. Im vorliegenden Beitrag soll dieser Fokus leitend sein: »Sprachbewusstsein« (wie immer wir den Begriff genau fassen, siehe unten) ist auf Erfahrungen bezogen. Solche Zugänge sind eine wichtige Basis für stärker verallgemeinerndes Untersuchen und Reflektieren von Sprache und Sprachgebrauch. Wie kommen wir im Unterricht an den Punkt, dass Lernende regelmäßig und vertieft, über zufällige kurze Gespräche hinaus, solche Gedanken formulieren, austauschen und systematisieren können?
Im Folgenden wird zuerst geklärt, welche Rolle Sprachbewusstsein vor allem im Kompetenzbereich »Sprache und Sprachgebrauch untersuchen« spielt; anschließend werden methodische Perspektiven für die Förderung von Sprachbewusstsein entwickelt und mit Beispielen vor allem für die Sekundarstufe I illustriert.
1. Sprachbewusstsein im Unterricht: Warum ist es wichtig?
Sich der eigenen Sprache bewusst zu sein, ist eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Wenn wir die Förderung von Sprachbewusstsein im Unterricht fokussieren, müssen wir deshalb den Lernenden zeigen, dass ihre persönliche Auseinandersetzung mit Sprache wichtig ist und sie in der Schule von Austauschmöglichkeiten profitieren, indem sie ein Vokabular für Gespräche über Sprache aufbauen.
Curricular, bezogen auf schulische Bildung, sind Sprachbewusstsein und Sprachbewusstheit als Fundament für Grammatikunterricht zentral, denn im schulischen Grammatikunterricht wird nicht ein grundsätzlich neuer Zugang zu Sprache vermittelt. Vielmehr bildet (metalinguistische) Erfahrung die Basis für abstraktere, genuin schulisch geprägte Sprachreflexion und Vermittlung von begrifflichem Wissen über Sprache und sprachliches Handeln (Ossner 2014, S. 25 f.; Peyer 2020, S. 27 f.). Ein solcher erfahrungsbezogener Ansatz, der über klassisches Grammatikwissen hinausgreift, wird explizit in den aktuellen Bildungsstandards für Deutschland, Österreich und die Deutschschweiz3 vertreten. Da die entsprechenden Bereiche sich nicht gut testen lassen, besteht allerdings die Gefahr, dass sie im Unterricht zu wenig berücksichtigt werden (Oomen-Welke/Bremerich-Vos 2014, S. 217).
»Sprachbewusstsein«, »Sprachbewusstheit«, »Language Awareness« – der erfahrungsbezogene, subjektive, unsystematische Zugang zu Sprache wird begrifflich und terminologisch je nach Bezugsdisziplin unterschiedlich gefasst (vgl. Gornik 2014 und 2014a; Bredel 2013, S. 38–59, 93–130, 167–194).4 Wesentlich ist, dass es zu Sprache nicht nur kognitive und linguistische Zugänge mit expliziter Begrifflichkeit gibt, sondern auch Anteile von nicht-explizitem Wissen sowie affektive, soziale, kognitive und politische Perspektiven, bei welchen die Lernerautonomie viel Gewicht bekommt (Luchtenberg 2017, S. 151 f.). »Affektiv« meint, dass Interesse und Sensibilität für Sprache(n) eine Rolle spielen, »sozial«, dass Toleranz bezüglich anderer Sprachen wichtig ist, und »politisch« zielt auf eine sprachkritische Haltung, vor allem die Auseinandersetzung mit dem Manipulationspotential von Sprache (Gornik 2014a, S. 46). In ihrer oft nicht schulisch gesteuerten Auseinandersetzung mit Sprache(n) bilden Kinder und Jugendliche sogenannte Präkonzepte von Sprache und Sprachlernen; Interviewstudien zeigen, dass diese gerade bei mehrsprachigen Lernenden interessant und vielfältig sind (vgl. Oomen-Welke 2017, vor allem S. 502 f.).
»Erfahrung« bedeutet in diesem Kontext, Sprachen zu lernen, mit Sprachen zu handeln, Gesellschaft und Normen als stark sprachlich geprägt wahrzunehmen und sich mit teilweise widersprüchlichen, ambivalenten und oft impliziten Regeln des sprachlichen Handelns auseinanderzusetzen. Dabei geht es nicht nur um Strukturen, sondern auch um das Nebeneinander von verschiedenen Systemen: äußere und innere Mehrsprachigkeit (Sprachen, Dialekte und regionale Varietäten, soziale Varietäten wie Jugendsprache), Kontinua von Nähe-Distanz und Mündlichkeit-Schriftlichkeit in verschiedenen medialen Ausprägungen, Schreiben und Sprechen mit verschiedenen Funktionen etc.
Ob und wie Kinder und Jugendliche lernen, sich über solche Themen zu verständigen, hängt stark von ihrer Sozialisationssituation ab. Auf die Rolle von Sprachbewusstsein und Language Awareness beim Spracherwerb wird oft hingewiesen, dennoch gibt es wenig gesichertes Wissen über die Entwicklung und unterschiedliche Formen des ungesteuerten Aufbaus von Sprachbewusstsein und die nicht schulisch gesteuerte Sprachreflexion von Kindern und Jugendlichen (vgl. Neuland u. a. 2014, S. 194–197). Möglich ist, dass die Verläufe sich ebenso stark unterscheiden wie die Lesesozialisation in der Familie und später in der Peer-Gruppe.5 Es drängt sich deshalb auf, für den Bereich »Sprache und Sprachgebrauch untersuchen« ein Modell in Analogie zum Mehrebenen-Lesekompetenzmodell (Rosebrock/Nix 2020, S. 17–26) beizuziehen, in welchem nicht nur kognitive Dimensionen (z. B. Wissensformen) verortet werden können, sondern auch das Selbstkonzept einer Person und ihre Fähigkeit zur Anschlusskommunikation als Teil der Kompetenz, die in der Schule gefördert werden kann (ein entsprechender Vorschlag auf der Basis von Lischeid 2014; zit. nach Peyer 2020, S. 14–22). Sprachbewusstsein ist so gesehen nicht nur kognitiv zu verstehen, sondern gehört wesentlich zum Selbstkonzept einer Person, die Beobachtungen zu Sprache und Sprachgebrauch macht, diese einordnet und sich entsprechend in den sozialen und gesellschaftlichen Austausch einbringen kann.
Für den vorliegenden Beitrag ist ein offenes Verständnis von »Sprachbewusstheit« bzw. »Sprachbewusstsein« leitend – diese bilden das Fundament, auf welchem systematischere oder wissenschaftspropädeutische Formen der Sprachreflexion aufbauen können.6 Wie auch immer die Begriffe genauer gefasst werden, es »heben alle Forscher hervor, dass – in der Terminologie von Andresen und Funke (2003) – die ›Zugänglichkeit von Sprache‹ entwickelbar und zu entwickeln ist« (Gornik, 2014, S. 49). Wie finden wir diese Zugänge, wie schaffen wir im Unterricht Gelegenheiten für die erfahrungsbezogene Auseinandersetzung mit Sprache(n)? Und wie gehen wir damit um, dass die Erfahrungen der Lernenden vielfältig sind und diese nicht alle auf dem gleichen Abstraktionsniveau reflektieren?
2. Sprachbewusstsein im Unterricht fördern: methodische Perspektiven
Die Anregung, über den engeren Bereich des traditionellen Grammatikunterrichts hinauszugehen und beim spontanen, erfahrungsbezogenen Nachdenken der Lernenden anzusetzen, ist in der fachlichen Diskussion schon lange präsent. Als »Reflexion über Sprache« werden seit den 1970er Jahren Ziele und Gegenstandsbereiche des Grammatikunterrichts erweitert (vgl. Riegler 2006, S. 25–52), und im Rahmen der kognitiven Wende wurde das Sprachbewusstsein der Lernenden fokussiert (vgl. ebd., S. 53–91, vor allem S. 59 f., 87, mit Hinweis auf Neuland 2002). Wie ein solcher Unterricht allerdings konkret aussehen soll, wird kaum ausdifferenziert (vgl. Riegler 2006, S. 75–80). Standard scheint das klassische, von der Lehrperson gesteuerte Unterrichtsgespräch zu sein.7 Natürlich spricht nichts dagegen, im Unterricht ungeplant sprachbezogene Fragen aufzugreifen. Abgesehen davon, dass ein vertiefendes Gespräch viel Fachwissen voraussetzt, ist es jedoch anspruchsvoll, die ganze Lerngruppe aktiv einzubeziehen. Außerdem reagieren ältere Lernende (ab der Sekundarstufe I) nicht mehr so spontan wie jüngere Kinder (vgl. Oomen-Welke/Bremerich-Vos 2014, S. 235).8
Der Unterricht will deshalb methodisch gut durchdacht sein, wobei »Methode« umfassend verstanden wird – es geht um das Grundverständnis von Lehr-Lern-Situationen (vgl. Decker-Ernst/Oomen-Welke 2017, S. 440 f. und 451–455; Peyer i. V.). Von Erfahrungen und Überlegungen der Lernenden auszugehen, impliziert ein genuin konstruktivistisches Konzept von Unterricht. Das Formulieren und Zugänglich-Machen eigener Gedanken und der Austausch darüber münden in das Aush...