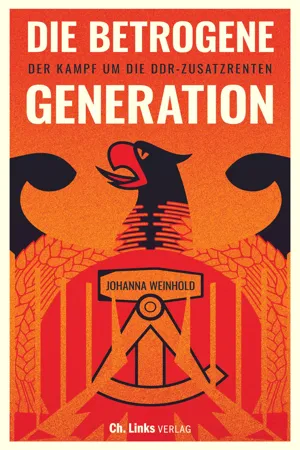![]()
1 Die Balletttänzerin
»Die Gerichte wollten einfach nicht positiv entscheiden«
Hadmut Fritsche machte zu DDR-Zeiten Karriere als Tänzerin beim Fernsehballett. Eine Karriere, die von vornherein zeitlich begrenzt war. Denn nach 20 Jahren täglichen Trainings und Auftritten kommen die Körper von Tänzerinnen und Tänzern an ihre Grenze. Eine gesonderte Versorgung nach Beendigung des Tänzerberufs sollte finanzielle Sicherheit geben. Doch 1992 wurde die »berufsbezogene Zuwendung« für Balletttänzerinnen gestrichen.
Im Haus hängen keine Fotos. Es gibt Bücher über Bücher, Landschaftsgemälde, Spiegel, aber kein überlebensgroßes Porträt im Tutu. Das überrascht mich. Immerhin ist Hadmut Fritsche eine ehemalige Balletttänzerin und nicht irgendeine »Hupfdohle« – wie sie selbst sagt –, sie war die erste Tänzerin des DDR-Fernsehballetts. Doch sowohl Haus als auch Besitzerin sind sehr bescheiden. Es gibt nichts, was überflüssig wäre. Außer ich: Denn während ich mich umschaue, fällt mir auf, dass ich wohl im Wohnzimmer vergessen wurde, und mache mich auf die Suche. Ich finde Hadmut Fritsche in der Garage, wo sie kopfüber in der Tiefkühltruhe hängt und kramt. Es ist einer der ersten heißen Tage im Sommer 2020, und es soll Eiskaffee geben. Den Kaffee dafür habe sie gestern schon gekocht. Aber das Eis müsse sie noch suchen, das müsse hier irgendwo sein.
Die Garage übrigens ist gar nicht so unbedeutend für Fritsche. »Als ich Probleme mit der Hüfte hatte, da kam ich nicht mehr aus dem Auto. Ich konnte das Bein nicht mehr richtig anwinkeln, und die Garage war zu schmal, um mit einem steifen Bein ein- und auszusteigen«, erzählt sie. »Ich habe dann einige Handwerker angerufen, ob die mir die Garage breiter bauen können. Die Gauner verlangten ein Vermögen. Da habe ich mir lieber die Hüfte operieren lassen, obwohl ich das erst gar nicht wollte.« Die Garage blieb, wie sie war. Die Hüfte ist wieder ganz, und die ehemalige Balletttänzerin scheint eher zu schweben, als dass sie läuft.
Wie man an der Geschichte mit der Garage sieht: Hadmut Fritsche kann durchaus bockig sein. Sie lacht und sagt: »Ja, bockig, das kann man so sagen. Früher wurde das aufmüpfig genannt.« Aber die Bockigkeit sei einer der Gründe dafür, dass sie bis heute bei »dieser Rentensache so dabei« ist. Seit fast 30 Jahren kämpft Hadmut Fritsche gemeinsam mit Monika Ehrhardt-Lakomy für die Weiterzahlung der berufsbezogenen Zuwendung (bbZ) für die ehemaligen Balletttänzerinnen und -tänzer der DDR. Diese wurde 1976 eingeführt und sollte später die schmale Tänzerrente aufstocken. Denn das Arbeitsleben von Balletttänzerinnen war zeitlich begrenzt.
»Es ist ein Ost-West-Thema«
Sieben bis neun Jahre Ausbildung, tägliches Training und mit Mitte 30 schon wieder raus aus dem Beruf: Balletttänzerin ist und war ein Ausnahmeberuf. Neben der hohen physischen und psychischen Belastung brachte der Beruf wenig Freizeit und viele Einschränkungen des Familienlebens mit sich. Die Gagen standen dem Ganzen diametral entgegen: Tänzerinnen und Tänzer verdienten monatlich rund 600 Mark, Spitzentänzerinnen in Ausnahmefällen bis zu 1000 Mark. Und im Schnitt war nach 15 bis 20 Arbeitsjahren die Karriere vorbei. Im Westen federte ein Versorgungswerk die schmalen Renten ab, in der DDR gab es ab 1976 eine staatliche Ballettrente. Bis zu 400 Mark monatlich bekamen diejenigen zusätzlich, die bis zu 15 Jahre durchgetanzt hatten. Dazu garantierte die gesetzliche Rentenversicherung je nach Anzahl der Berufsjahre eine Mindestrente zwischen 330 und 470 Mark, der Höchstsatz lag bei 510 Mark. Dass die soziale Absicherung für die Tänzerinnen nicht ausreichend war, erkannte auch der Ministerrat der DDR und erließ 1976 die »berufsbezogene Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen der DDR«. Diese betrug 50 Prozent der monatlichen Vergütung von fünf zusammenhängenden verdienstgünstigsten Jahren.
Und diese Regelung wurde 1992 von der Bundesregierung gestrichen, obwohl im Staatsvertrag vom 18. Mai 1990 und auch im Einigungsvertrag vom 31. August 1990 den Mitgliedern des staatlichen Balletts die Ansprüche auf Zahlung aus der berufsbezogenen Zuwendung »ohne Schmälerung« garantiert worden waren. Die Streichung der Tänzerrenten basierte, so erzählen es Fritsche und ihre Tänzerkolleginnen und -kollegen, auf einer Fehlinterpretation der im Einigungsvertrag enthaltenen Passage: »Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen vom Juni 1983 mit folgenden Maßgaben: Die Anordnung ist bis zum 31. Dezember 1991 anzuwenden.«1 Allerdings findet sich im Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) keine Regelung für die Zeit ab 1. Januar 1992 – was bei Gerichtsverhandlungen immer wieder die Frage aufwarf: Was galt nach dem Stichtag? Denn die Tänzerinnen, die danach in den Ruhestand gingen, erhielten keine berufsbezogene Zuwendung. Das machte sie oft genug zum Sozialfall. Wenn man davon ausgeht, dass einer Tänzerin ab 1992 ihre berufsbezogene Zuwendung zustand, wären das bis 2021 etwa 71 000 Euro gewesen. Mehr als 700 Tänzerinnen klagten ab 1993 gegen die Liquidierung ihrer Ansprüche und zogen bis weit in die 2000er-Jahre vor die Arbeits- und Sozialgerichte auf Landes- wie auch auf Bundesebene.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nahm 2002 die Klage nicht zur Entscheidung an, es bestätigte aber immerhin: Die Formulierung des Einigungsvertrages »noch nicht geschlossene Versorgungssysteme [sind] bis 31. Dezember 1991 zu schließen«, bedeutet nicht, dass »die in diesem Versorgungssystem erworbenen Ansprüche und Anwartschaften […] zum Erlöschen gebracht werden«.2 Ein Minierfolg. Allerdings wies das Gericht darauf hin, dass eine entsprechende Andersregelung durch die Bundesregierung geschaffen werden müsse. Was bis zum Frühjahr 2021 nicht geschehen ist. In der Nichtannahmeerklärung des BVerfG heißt es, »die Beendigung der bbZ an Ballettmitglieder der DDR [verletzt] weder das Grundrecht auf Eigentum, auf Gleichheit noch die Grundsätze rechtsstaatlichen Vertrauensschutzes«.3
Die Tänzerinnen zogen weiter bis vor den Europäischen Gerichtshof. Der wies die Klage 2007 ab, weil es sich um eine »innerdeutsche Angelegenheit« handele. »Und damit haben sie recht. Es ist ein Ost-West-Thema«, sagt Tänzerin Fritsche. Nicht nur das. Es gebe eine ganz klare Haltung, die Fritsche und ihre Mitklägerinnen immer wieder zu spüren bekommen: Warum sollten denn die Ossis eine Extrarente bekommen? Doch darum geht es in Fritsches Augen gar nicht, denn zum einen erhalten die Westtänzer ebenfalls einen Versorgungsausgleich im Alter, zum anderen: »Es geht einfach darum, dass es nicht einmal den Versuch seitens Politik oder Justiz gab, einen Fehler einzugestehen. Nach drei Jahrzehnten sitzen die immer noch das Problem aus.«
Wer in der DDR beim Ballett war, gehörte zu einer Elite. Den Beruf konnten nur die ergreifen, die einen Platz bekamen und auch die körperlichen Voraussetzungen erfüllten. Der Tanz nahm »im ostdeutschen Prozess der Nationenbildung eine umstrittene Position ein. […] Als eine Kunstform, die nicht auf gesprochener oder geschriebener Sprache aufbaute, wurde er als vieldeutig und somit als nicht unbedingt für die didaktische Propaganda geeignet betrachtet. Dennoch wurde er zu einem besonderen Anliegen der DDR-Regierung, da er in zahlreiche Ebenen des sozialen Lebens hineinreichte.«4 Die Ausbildung an einer der staatlichen Ballettschulen in Dresden, Leipzig und Ost-Berlin dauerte zunächst fünf Jahre, ab 1963 sieben und später sogar neun Jahre.
»Ich wollte als Kind eigentlich Artistin werden«, erzählt Hadmut Fritsche. »Aber meiner Mutter war das zu gefährlich. Das sei ein halsbrecherischer Beruf, sagte sie.« Ein Schlüsselerlebnis für Hadmut Fritsche war, dass sie nach dem Krieg in Berlin-Karow Camilio Mayer und seine Artistentruppe mit der Camilio-Mayer-Stratosphären-Schau sah. »Da ist einer auf dem Seil bis in den Kirchturm balanciert. Das fand ich sehr irre«, erinnert sich Fritsche, als wir im Garten sitzen. »Ich sagte zu Mutti: ›Ich will Artistin werden.‹ Und die sagte: ›Nein, aber Ballettunterricht geht.‹«
Die berühmte Tatjana Gsovsky war von 1945 bis 1952 Ballettmeisterin an der Berliner Staatsoper und betrieb eine Kinderballettschule am Kurfürstendamm. »Die hat meine Beine genommen und mir das Bein vorne an den Kopf gedrückt, seitlich und hinten. Das ging prima. ›Die ist begabt‹, sagte sie und wollte mich übernehmen. Aber als wir zurückfuhren, sagte Mutti: ›Hadmut, 50 Mark kann ich nicht zahlen.‹« Fritsches Vater war drei Wochen nach Kriegsende gestorben, nachdem er todkrank heimgekehrt war. Um über die Runden zu kommen – die Witwenrente war schmal –, nähte die Mutter aus drei alten Kleidern ein neues. Für das neue Kleid gab es im Tausch ein Brot.
Als Hadmut Fritsche acht Jahre alt war, tat sich eine neue Gelegenheit auf: Jean Weidt, der »rote Tänzer«, hatte 1948 eine Ballettschule mit Schwerpunkt »dramatisches Ballett« gegründet. Hier wurde Fritsche aufgenommen, tanzte, bis sie 14 Jahre alt war. Nach der achten Klasse hätte sie gern Ballett studiert. Der Mangel an Ausbildungsplätzen machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Außerdem wurde das Schulgesetz damals novelliert, sodass nun alle Schüler in Berlin neun Jahre zur Schule gehen mussten. »Ich hatte so eine Wut, und die habe ich auch offen ausgelebt. Ich musste jeden Tag zum Direktor. Ich war damals richtig aufmüpfig. Ich weiß noch, Stalin starb in der Zeit. Die ganze Klasse musste fünf Minuten stillstehen und ruhig sein – und ich kicherte in der hintersten Reihe. Das hallte über den ganzen Schulhof – und gab richtig Ärger.«
Doch im Herbst 1953 konnte Fritsche ihre Ausbildung an der Ballettschule in Berlin beginnen. Monatlich bekamen alle Tänzerinnen und Tänzer 150 Mark Stipendium. 50 Mark wurden für die Verpflegung abgezogen. Die Ausbildung war sehr streng. Denn durch gut ausgebildete Tänzer wollte die DDR dem »kapitalistischen Westen vor Augen führen, wie leistungsstark und erfolgreich das Ballett und die Institutionen der Tanzausbildung in der DDR waren«.5 Fritsche hielt die fünf Jahre durch und war gut. Am Ende des Studiums kamen die Meister aus Dresden und Leipzig und sahen sich die Tänzerinnen und Tänzer an, um sie an ihre Häuser zu holen. »Ich tanzte damals, 1958, bei der Staatsoper vor. Die Tänzerinnen der Staatsoper waren immer ein Team. Da kamen welche aus West-Berlin und manche aus Ost-Berlin. Aber es war für unsere Arbeit nie wichtig, wer woher kam.«
»Es wird niemandem schlechter gehen …«
Vor dem Mauerbau war es weitgehend egal, aus welcher Besatzungszone man kam. Später, erinnert sich Fritsche, verglich man sich immer mit dem Westen und versuchte sich abzugrenzen. Und nach dem Mauerfall war es plötzlich nicht mehr egal, woher man kam. Plötzlich sei man als Ossi in eine Bittstellerposition geraten, weil man um den Erhalt und die Wahrung seiner bekannten Lebenswelt und seine Ansprüche – wie im konkreten Fall der Renten – kämpfte. Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) erklärte am Tag der Unterzeichnung des Staatsvertrages 1990: »Den Deutschen in der DDR kann ich sagen, was auch Ministerpräsident de Maizière betont hat: Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor – dafür vielen besser.«6 Und er verkündete, dass Verlässlichkeit und Worthalten einen hohen Stellenwert haben. Das wiederholte Bundesarbeits- und -sozialminister Norbert Blüm (CDU) nach dem 3. Oktober 1990 und ging davon aus, dass der Angleichungsprozess der Lebensverhältnisse binnen fünf Jahren vollzogen sei. Dass nicht nur er, sondern auch alle anderen politischen Akteure sich irrten und aus dieser falschen Annahme heraus Entscheidungen getroffen wurden, die den Menschen, die bis heute um die Anerkennung und Auszahlung ihrer Zusatzrente kämpfen, immer noch Unrecht tun, schrieb er 2003 an Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) mit den Worten: »Wir [sind] seinerzeit davon ausgegangen, dass die Rentenangleichung Ost und West in 5 Jahren abgeschlossen sein würde.«7
Unser Eiskaffee ist inzwischen ausgetrunken. Fritsche, die aufgehört hat zu rauchen, als das Westgeld kam (»Ich werde nicht eine Westmark in Zigaretten stecken, habe ich mir geschworen«), raucht nun doch eine, »aber nur weil Besuch da ist«. Ihr Haus ist nur wenige Meter entfernt von dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist. Was heute kaum noch bezahlbar ist, war in den 70er-Jahren für wenig Geld zu haben. Das Haus habe ihr Mann so gestaltet und renoviert, wie es heute noch sei. Auf dem Weg zur Toilette gehe ich durchs Wohnzimmer und entdecke doch ein Foto auf einem kleinen Tisch: ihr Mann. Er trägt eine Baskenmütze, hat einen Bart und lacht. Auf dem Foto ist er bestimmt schon 60. Inzwischen lebt er nicht mehr.
Anders als anderen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen geht es Hadmut Fritsche gut. Das liegt auch daran, dass sie nach ihrer aktiven Tänzerkarriere direkt eine Anstellung als Leiterin des Klubs des Deutschen Fernsehballetts fand, für das sie viele Jahre getanzt hatte. Sie setzt sich für ihren Berufsstand und die Auszahlung der bbZ ein, weil sie weiß, dass nicht alle ehemaligen Tänzerinnen und Tänzer so viel Glück hatten. Denn nach dem Karriereende mit Mitte 30, Anfang 40 fanden nicht alle eine neue Anstellung. Nur die wenigsten werden Ausbilder oder Lehrer.
Die berufsbezogene Zuwendung ist aus Fritsches Sicht unerlässlich für eine würdige Altersversorgung. »Das hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun«, sagt sie. Für die Tänzerinnen gibt es die vom Ministerrat erlassene Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen in der DDR (bbZ-AO) vom 1. September 1976. Sie gilt für »alle Tänzerinnen und Tänzer […], die ihre Tätigkeit aus alters-, berufsbedingten oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können und die sich in einem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis zu einem Theater, staatlichen Ensemble bzw. zum Fernsehen der DDR befinden«.8 Da die gesonderte Versorgung nicht über Sozialabgaben der DDR-Tänzerinnen erfolgen konnte, deren Gagen 600 bis 1000 DDR-Mark betrugen, sodass – in Kombination mit wenigen aktiven Arbeitsjahren – nur Mindestrenten erreicht wurden, regelte § 4 Satz 4, dass »die weitere Zahlung der berufsbezogenen Zuwendung die Staatliche Versicherung der DDR« übernimmt. Damit handele es sich – zumindest nahmen die Tänzerinnen das an – bei der bbZ um eine sozialstaatliche Leistung. Doch das Bundessozialgericht wies die eingereichte Klage 1994 zurück an die Arbeitsgerichte der Länder, »da es sich [bei der bbZ] nur um Ansprüche aus der Nachwirkung des Arbeitsverhältnisses handeln könne«.9 Doch die konnten nirgendwo mehr geltend gemacht werden, weil es die DDR-Betriebe nicht mehr gab. Theoretisch. Doch im Fall der Balletttänzerin gab es sie noch: das Fernsehballett und die Staatsoper.
Drei Jahre bevor Hadmut Fritsche 1958 an der Staatsoper vortanzte, hatte Lieselotte Gruber als Ballettmeisterin und Choreografin hier angefangen. »Die hat sich einen großen Teil der Tänzer aus Leipzig mitgenommen. In der Staatsoper brodelte es. Sie war da nicht unbedingt willkommen.« Die Antipathie beruhte offensichtlich auf Gegenseitigkeit. Lilo Gruber hielt wohl nicht viel von Hadmut Fritsche. »Ich habe vorgetanzt und war mir sicher, dass ich eine Stelle bekomme. Drei andere aus meiner Klasse wurden ja genommen. Da sagt sie zu mir: ›Hadmut, wir können dich nicht nehmen.‹ – ›Warum?‹, frage ich. – ›Du passt figürlich nicht in unsere Gruppe.‹ Das war Unsinn. Die Gruber wollte mich einfach nicht. Ich bin wieder nach Hause, und in dem Moment klingelt das Telefon und die Staatsoper ist dran: Ich könne doch dort anfangen, wenn ich will. Die Gruber habe es sich doch anders überlegt.«
Das Ballett von damals, erzählt Fritsche, sei in ihren Augen wie die Gemäldegalerie: beachtenswert, gut – aber nicht Ausdruck der gegenwärtigen Zeit. »Ich bin der Meinung, dass die Staatsoper Ende der 50er-Jahre einfach nicht zeitgemäß getanzt hat. Also bin ich zur Gruber und hab gesagt: ›Können wir nicht mal was Modernes machen?‹ Die hat geantwortet: ›Hadmut, wir sind das erste Haus am Platz und kein Experimentiertheater.‹« Das Verhältnis zwischen der Chefchoreografin Gruber und der Elevin Fritsche wurde nie ein gutes.
»Dass ich von der Oper weggegangen bin, hatte was mit dem 13. August 1961 zu tun. Im Herbst 1960 wurde ich schwanger. Bis zum fünften Monat habe ich Schwanensee getanzt, dann bekamen die wohl Angst, dass ich das Kind auf der Bühne bekomme, und legten mir nahe, nicht mehr zu arbeiten«, erzählt Fritsche. Ihr Sohn kam im Juli 1961 auf die Welt. Hadmut Fritsche hatte nicht genügend Milch und ging zur Kinderfürsorge, weil dort, aber nur im Westteil der Stadt, die Säuglingsnahrung Humana ausgegeben wurde. Dann kam der 13. August, ein Sonntag. »Wir hörten vom Mauerbau früh im Radio. Und wie so viele Berliner meinte ich nur: Das geht doch gar nicht. Da fährt doch die S-Bahn durch. Der nächste Gedanke war dann: Die Milchnahrung reicht nur bis morgen früh. Montag früh bin ich dann gleich zur Kinderfürsorge in Ost-Berlin, und die meinten: ›Ach du lieber Gott, Frau Fritsche. Ich kann Ihnen keine Scheine mehr für Humana-Milch geben. Sie müssen Ihrem Kind jetzt Brei geben.‹ Ich hatte bei jedem Löffel Angst, der Kleine erstickt.«
Noch am 13. August bekam Fritsche ein Telegramm aus der Staatsoper, ob sie nicht doch schon wieder tanzen könne. »Da habe ich gedacht: Sind die bescheuert? Normalerweise blieben die Tänzerinnen mit Kind ein halbes Jahr zu Hause.«10 Drei Tage später fuhr sie in die Staatsoper, die nicht spielfähig war. Nach dem Mauerbau fehlte die Hälfte des Tanzensembles, beim Orchester waren es zwei Drittel, beim Chor etwa 60 Prozent. Um die Künstler zu halten oder in den Ostsektor zu holen, wurde ihnen versprochen: »Wenn Sie in die DDR ziehen, bekommen Sie sofort eine Wohnung.« Da also Notstand herrschte, fing Fritsche vier Wochen nach der Entbindung wieder an zu tanzen. Die Stimmung im Haus war angespannt. Lilo Gruber war nervös. Sie musste ein Tanzensemble leiten, das teilweise aus Tänzerinnen bestand, die noch in Ausbildung waren, und dieses zu einer Ballettkompanie aufbauen, die das gewohnte hohe Niveau auf die Bühne brachte.
Bei einer Probe 1962 krachte es zwischen Gruber und Fritsche endgültig: »Die G...