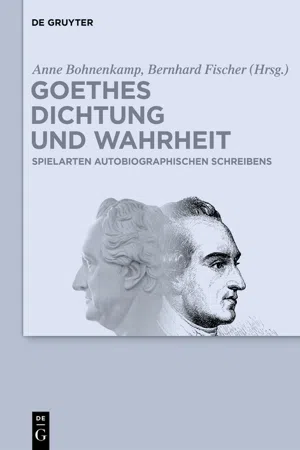Im Achten Buch von Dichtung und Wahrheit erzählt Goethe von seinem ersten Besuch der Dresdner Gemäldegalerie, den er vermutlich Ende Februar/Anfang März 1768 als 18jähriger unternommen hat. Der sechs bis sieben Druckseiten umfassende Bericht des Dresdner Aufenthalts zeichnet sich durch episodischen Anschauungsreichtum aus, dies insbesondere im Zusammenhang mit dem ungewöhnlichen Quartier, das Goethe bei dem Schuhmacher Johann Gottfried Haucke, einem Verwandten und Korrespondenzpartner seines Leipziger Zimmernachbarn Johann Christian Limprecht, bezogen hatte, und jenem sonderbaren Zechabend, welcher der „Mystifikation“ eines „vorlauten, anmaßlichen“ jungen Mannes diente,1 aber auch durch die genaue Erinnerung an Gespräche mit Haucke sowie dem Generaldirektor der Kunstsammlungen Christian Ludwig von Hagedorn und dem Galerieinspektor Johann Anton Riedel. Nicht zuletzt die in diesen Episoden zum Ausdruck gelangte Anschaulichkeit und Präzision von Goethes Erinnerungen sichern dem Bericht über seinen ersten Besuch der Dresdner Gemäldegalerie seinen hohen Quellenwert in der Forschung zur Entwicklung seiner Kunstauffassung.
Allerdings unterliegt nicht allein der feucht-fröhliche Abend in dessen Mitte, sondern Goethes gesamte Reise nach Dresden einer Strategie der „Mystifikation“. Goethe gesteht dies zu Beginn seines Berichts auch offen ein: Sein „grillenhaftes Wesen“ habe ihn damals dazu veranlasst, seinen „Vorsatz vor Jedermann geheim“ zu halten, „weil ich die dortigen Kunstschätze ganz nach eigner Art zu betrachten wünschte und, wie ich meinte, mich von Niemand wollte irre machen lassen.“2 Diesen Vorsatz zur Geheimhaltung seiner Reise hat er mit solcher Konsequenz und solchem Erfolg eingehalten, dass es über den Bericht in Dichtung und Wahrheit hinaus nur ein einziges Zeugnis gibt, das Goethes Besuch in Dresden dokumentiert; wenn es dieses Dokument nicht gäbe, könnte es sich, quellenkritisch gesehen, also bei Goethes gesamtem Bericht über seine Dresden-Reise um eine Mystifikation handeln. Es ist dies ein Brief an Ernst Wolfgang Behrisch, dem er schon am 24. Oktober 1767 vage angekündigt hatte, er werde „mit dem Märzen, etwas nach Dreßden“ reisen.3 In einem Brief vom März 1768 ohne Tagesangabe bestätigt er Behrisch, dass die Reise mittlerweile stattgefunden habe, wobei er den Freund zunächst von dessen Brüdern in Dresden grüßt und dann fortfährt:
Nichtwahr das hättest du nie vermuhtet, ich binn in Dreßden gewesen, auf zwölf Tage, die Gallerie zu sehen, die habe ich gesehen, was man gesehen heisst. Deine Brüder sind wohl, und haben mich wohl bewirthet. Dresden ist ein Ort, der herrlich ist, und wenn mir's erlaubt wäre ein kleines Supplement daran zufügen, so wünschte ich mich nie heraus.4
Dem Brief lassen sich, über die Bestätigung der Faktizität der Reise hinaus, insgesamt drei Informationen entnehmen, die sich nicht in Dichtung und Wahrheit finden:
-
der ungefähre Zeitraum der Reise, der sich aus der Datierung des Briefes auf den März 1768 ergibt: also hat die Reise Ende Februar/Anfang März 1768 stattgefunden;
-
die Dauer der Reise: sie wird „auf zwölf Tage“ veranschlagt, wobei unklar bleibt, ob die in der Kutsche verbrachte Reisezeit darin eingerechnet ist; man darf jedenfalls mit einer Aufenthaltsdauer in Dresden von mindestens zehn Tagen rechnen, während in Dichtung und Wahrheit nur unbestimmt von „wenigen Tagen meines Aufenthalts in Dresden“5 die Rede ist;
-
schließlich der enge Kontakt zu Behrischs Brüdern, die in Goethes Autobiographie keine Erwähnung finden; dort ist von ganz anderen sozialen Kontakten in Dresden die Rede.
Diese dem Brief an Behrisch, der Goethe bei der Niederschrift von Dichtung und Wahrheit sicher nicht vorlag, zu entnehmenden präzisen Informationen geben einen deutlichen Hinweis darauf, dass Goethe beim Diktat seiner Erinnerungen an seinen ersten Dresden-Besuch weitgehend auf die Daten angewiesen war, die ihm sein Gedächtnis im Hinblick auf Ereignisse überlieferte, die mittlerweile 44 Jahre zurücklagen.
Dass Goethe die Lückenhaftigkeit seines Gedächtnisses durch erzählerische Absichten und Darstellungsstrategien, denen der Dresden-Bericht auch seine erstaunliche Anschaulichkeit verdankt, ausglich und überspielte, ergibt sich bereits aus der Divergenz zwischen den im Brief genannten zwölf Reisetagen, die Goethe dem Besuch Dresdens gewidmet hat, und den „wenigen Tagen“, von denen die Autobiographie berichtet. Wer die zahlreichen Berichte von Reisenden der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts über ihre Besuche der Dresdner Galerie durchsieht,6 wird feststellen, dass eine Dauer von zehn Besichtigungstagen höchst ungewöhnlich war; die meisten Reisenden haben sich wie die heutigen Touristen mit sehr viel kürzeren Besuchszeiträumen zufriedengegeben (und von Exklusivführungen durch Riedel und Hagedorn ist ohnehin nur ganz selten die Rede). Die Schrumpfung der Aufenthaltsdauer auf „wenige Tage“, also aufs touristische Normalmaß, gibt die Absicht des Autobiographen zu erkennen, die Bedeutung seines ersten Dresdner Aufenthalts für die Entwicklung seines künstlerischen Geschmacks und seiner kunsthistorischen Kenntnisse entschieden herunterzuspielen. Der Opulenz der Dresdner Sammlung stellt die Autobiographie deshalb die Kürze der Besichtigungsdauer gegenüber, und überdies wird dort die Erinnerung an die Gemälde selbst verdrängt und überlagert durch Erinnerungsbilder an die pittoreske Alltagswirklichkeit der Schusterwohnung, die der Erzähler nach dem Muster von Adriaen van Ostade am Mittag und von Godfried Schalcken in der Nacht wahrgenommen haben will, oder gar an Kneipenszenen im Stil von Auerbachs Keller. Ich zitiere exemplarisch das Bild, als welches sich die Schusterwohnung dem Blick des um Mitternacht heimkehrenden Gastes darbietet: „alles war zu Bette und eine Lampe erleuchtete den enghäuslichen Zustand, wo denn mein immer mehr geübtes Auge sogleich das schönste Bild von Schalken erblickte“.7 Das klingt nun so, als habe er seinen Blick am Tage auf der Galerie an Bildern Schalckens „geübt“ – merkwürdig nur, dass der zeitgenössische Katalog der Dresdner Galerie kein einziges Gemälde verzeichnet, das damals Godfried Schalcken zugeschrieben wurde.8
Dem Autobiographen ist jedenfalls alles daran gelegen, dem jungen Besucher der Galerie ein Bildungserlebnis zu bescheren, für das er offensichtlich noch nicht reif war. Deshalb verwehrt er seinem 18jährigen Ich in der Galerie jeden Erkenntnisschritt, der über dessen Leipziger Denkhorizont hinausführt, und jede Erweiterung seiner künstlerischen Erfahrungen durch ästhetische Einsichten, die der Erzähler erst für spätere Entwicklungsphasen seines Ich eingeplant hat. Erzählerisch ergibt sich daraus die spannungsvolle Konstellation, dass das kunsthistorische Bewusstsein des Autobiographen erheblich abweicht von demjenigen seines jugendlichen Helden und eifersüchtig darüber wacht, dass dieser vor den Bildern zu keinen künstlerischen Einsichten finden darf, die der Erzähler selbst erst in weiteren Jahrzehnten seiner Ausbildung und nach einem längeren Umweg über Italien gewonnen haben will.
Der Autor des Berichts über seinen ersten Besuch in der Dresdner Galerie hat überdies mit dem Problem zu kämpfen, sich an diesen 44 Jahre später schon deshalb kaum noch erinnern zu können, weil er derweil weitere vier Mal in Dresden und dabei immer auch auf der Galerie gewesen war: im Sommer und...