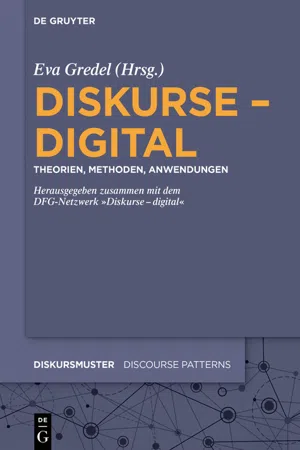
- 318 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Die Diskurslinguistik als relativ neue Teildisziplin der germanistischen Linguistik beschäftigt sich mit der Frage, wie soziale Wirklichkeiten in transtextuell organisierten Einheiten konstruiert werden. Bisher finden dabei noch kaum Texte aus digitalen Medien (z.B. aus Twitter) Berücksichtigung. Ziel ist es, das Programm und das Methodeninventar der Diskurslinguistik in zwei Richtungen zu erweitern: Zum einen sollen die spezifischen Beschreibungskategorien und Analysewerkzeuge für Diskurse in digitalen Medien systematisiert werden. Zum anderen sollen Methoden und Instrumente der Korpuslinguistik und Digital Methods im Hinblick auf die Anforderungen der Diskurslinguistik evaluiert und ausgebaut werden. Die Publikation thematisiert Spezifika digitaler Medien und Plattformen aus diskurslinguistischer Sicht und beschreibt, welche charakteristischen Muster sich aus diesen Spezifika in digitalen Diskursen ergeben. Zudem werden ethische und rechtliche Aspekte bei der Analyse digitaler Diskurse (z.B. Anonymisierung digitaler (Sprach-)Daten) thematisiert. In einem umfassenden Methodenkapitel geben die Autor/-innen zudem einen Überblick über relevante Methoden für digitale Diskursanalysen, deren Einsatz an Fallbeispielen illustriert wird.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Teil III: Methoden, Verdatung und Anwendungen
Techniken und Praktiken der Verdatung
1 Einleitung
2 Datenerhebung und Datentransformation
- Projekt 1. Forschungsfrage: Ermöglicht die Analyse des Briefwechsels zwischen A und B Rückschlüsse auf Werke/Werkentscheidungen von A und B? – Material: In verschiedenen Bibliotheken wurden mehrere hundert historische Briefe von A und B gefunden (ca. 500 Seiten). Der überwiegende Teil ist mit einer Schreibmaschine verfasst – es gibt händische Anmerkungen (z. B. A macht Anmerkungen in Briefen von B). Zu vergleichbaren Untersuchungssettings siehe Neuber, Bernauer & Miller 2020, Neumann & Fauck 2008 und Rettinghaus 2021.
- Projekt 2. Forschungsfragen: Wie wird das Thema T in einem Diskurs D semantisch besetzt oder (um-)gedeutet? Wie reagieren die Diskursakteure A und B auf ein Ereignis E? – Material: Mit Hilfe eines Web-Crawlers (siehe Weisser 2019, Suchomel & Pomikálek 2012 und Barbaresi 2021) werden massenhaft Zeitungsartikel zum Diskurs D gesammelt, die insbesondere (gefiltert) das Thema T und das Ereignis E repräsentieren. Zu vergleichbaren Untersuchungssettings siehe Schabus, Skowron & Trapp 2017, Korpus Berliner Zeitung 2014 und ZEIT-Korpus (ZEIT & ZEIT online) 2014.
- Projekt 3. Forschungsfragen: Im Sozialen Netzwerk N findet die Skandalisierung eines Ereignisses E statt. Im Zentrum der allgemeinen Empörung stehen die Nutzerkonten A, B, C und D. Da das Soziale Netzwerk N nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen pro Nachricht zulässt, greifen A, B, C und D auch auf eingebettete Grafiken, Videos und Verlinkungen zurück (zu anderen Netzwerken, Blogs, etc.). Analysiert werden soll der multimodale Diskurs zum Ereignis E – primär zwischen den Nutzerkonten A, B, C und D – aber auch anderen Konten, die besonders aktiv sind (Netzwerkanalyse). Zu vergleichbaren Untersuchungssettings siehe Beißwenger et al. 2021, Stark et al. 2018 und Kissling 2020.
Planspiel – Die erste Hürde der Datenerhebung: Die Digitalisierung
Planspiel – Wichtige Punkte für Spaß an den Daten
Primäre und sekundäre Daten
- Zerteilung der Texte in einzelne Sätze und Token,
- automatische Lemmatisierung der Token (Token: Häuser > Lemma: Haus),
- automatische Zuordnung der Wortart (Token: Berge > Wortart: Nomen),
- Annotation von Phrasen (Token: Das wundersame Fest > Phrase: Nominalphrase).
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Einleitung
- Teil I: Grundbegriffe und Grundlagen
- Teil II: Ethische und rechtliche Aspekte
- Teil III: Methoden, Verdatung und Anwendungen
- Sachregister