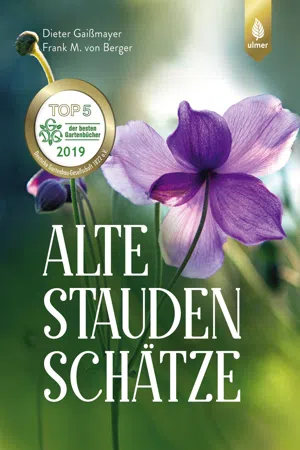
eBook - ePub
Alte Staudenschätze
Bewährte Arten und Sorten wiederentdecken und verwenden
- 288 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Alte Staudenschätze
Bewährte Arten und Sorten wiederentdecken und verwenden
Über dieses Buch
Rediscover and utilise tried-and-true species and varieties
Would you like to know all about historic perennial herbs, and are you thinking about growing them in your garden? In this standard reference work, the well-known perennial herb expert Dieter Gaissmayer and the successful gardening journalist Frank M. von Berger share their decades-long experience. In a comprehensive profile section, they present numerous historic perennial herbs and give you valuable tips on buying them and maintaining them properly.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Alte Staudenschätze von Dieter Gaißmayer,Frank M. von Berger im PDF- und/oder ePub-Format. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Verlag
Verlag Eugen UlmerJahr
2018eBook-ISBN:
9783818604646Thema
BiowissenschaftenDIE STAUDEN IM PORTRÄT
In diesem Kapitel treffen Sie gewiss auf einige altbekannte Gartenstauden, vielleicht aber auch auf zukünftige Lieblingspflanzen. Erfahren Sie hier interessante Hintergründe über die Geschichte und kulturelle Bedeutung dieser Pflanzen.

UNGARISCHER AKANTHUS, BALKAN-BÄRENKLAU
> Wild, schön und von archaischer Eleganz ist diese Staude, die viel zu selten in unseren Gärten zu finden ist. Die klassisch anmutenden, majestätischen Blütenstände der im Volksmund auch Bärenklau genannten Pflanze sind im Sommer ein echter Blickfang im Staudenbeet. <

Acanthus hungaricus
Bärenklaugewächse, Acanthaceae
Heimat: Südosteuropa (Balkan).
Wuchsform: Aufrecht, büschelige Horste bildend.
Blatt: Eiförmig, dunkelgrün, gelappt, bis 35 cm lang.
Blüte: Zylinderförmige Ähren mit weißen bis blassrosa Lippenblüten und purpurfarbenen Hochblättern.
Blütezeit: Juli bis August.
Frucht: Kapsel.
Wuchs-/Blütenhöhe: 60–100 cm.
Standort: Sonnig bis halbschattig in nährstoffreichem, tiefgründigem, durchlässigem, kalkhaltigem Boden.
Pflege: Vor Winter- und Staunässe schützen.
Vermehrung: Durch Aussaat oder Teilen im Herbst.
Besonderes: Auch gut geeignet als Schnittblume und für die Trockenfloristik.
Der Name der Gattung leitet sich vom altgriechischen akanthos („der Dornige“) ab und bezieht sich auf die gelappten, bei vielen Acanthus-Arten tatsächlich bedornten Blätter. Den Trivialnamen Bärenklau teilt sich die Pflanze mit dem Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum, Syn. Heracleum giganteum). Dieser riesenwüchsige Doldenblütler ist jedoch botanisch nicht mit dem Akanthus verwandt.
Der Akanthus war bereits bei Griechen und Römern eine beliebte Gartenpflanze. Die markanten Blätter bildeten in der Antike das Vorbild für den Schmuck korinthischer Säulenkapitelle. Der österreichische Pfarrer und Staudenfreund Johann Theophil Zetter schrieb 1837: „Diese schönen Pflanzen spielten einst in der grauen Vorzeit eine bedeutende Rolle, und haben deswegen eine historische und artistische Wichtigkeit, weil sie den uralten Baumeistern zu Modellen bei Verzierung der Kapitäler der korinthischen Säulen dienten. Man sollte sie deshalb aus dem lieblichen Kreise ihrer Grazienschwestern nicht verweisen.“ Die frühen Berichte über Akanthus in Gärten beziehen sich meist auf zwei Arten: Pracht-Akanthus (A. mollis), auch als Weicher Bärenklau bezeichnet, sowie Stacheligen Akanthus (A. spinosus). Der Weiche Bärenklau wurde vom griechischen Arzt Dioskurides im 1. Jh. n. Chr. als Heilmittel bei Brüchen und Krämpfen empfohlen. Noch Ende des 17. Jahrhunderts riet der Engländer John Evelyn dazu, die Pflanze im Heilkräutergarten anzupflanzen. Obwohl man der Pflanze einst auch eine nervenberuhigende Wirkung nachsagte, ist diesbezüglich ein kurativer Effekt wissenschaftlich nicht belegt. Der Stachelige Akanthus ist eine robuste, durch Ausläufer dichte Bestände bildende Staude mit dornenbewehrten Blättern. Diese beiden Acanthus-Arten sind nur in klimatisch begünstigten Regionen winterhart und kommen auch nur dort zuverlässig zur Blüte.
Wir empfehlen daher für unser Klima den robusten Ungarischen Bärenklau (A. hungaricus,). Dieser ist hierzulande ausreichend winterhart.
Er steht in der Staudengärtnerei Gaißmayer seit mehr als 15 Jahren am gleichen Platz, weshalb wir ihn auch guten Gewissens empfehlen können. Er ist nachweislich seit 1869 in England in Kultur. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurde er vom ungarischen Botaniker Vincze von Borbás beschrieben, jedoch erst Jahrzehnte später, im Jahr 1896, vom deutschen Botaniker Karl Gabriel Baenitz in die heute gültige Systematik eingeordnet.

Pracht-Akanthus (Acanthus mollis).
Trotz der mangelnden Winterhärte waren die beiden oben genannten Arten um die Mitte des 16. Jahrhunderts in mitteleuropäischen Gärten weit verbreitet, wie John Gerard in seinem 1597 erstmals erschienenen Buch „The Herball or General History of Plants“ schrieb. Im Jahr 1754 empfahl der Botaniker Philip Miller sie in seinem „Gardener’s Dictionary“ jedoch nur noch für Sammlergärten und warnte vor ihrem Ausbreitungsdrang – eine Empfehlung, die übrigens bis heute ernst zu nehmen ist. Der irische Gärtner und Gartenjournalist William Robinson riet in seinem 1870 erschienenen Buch „The Wild Garden“ zur Pflanzung von Akanthusarten im Naturgarten. „Vilmorin’s illustrirte Blumengärtnerei“ empfahl 1879 die Art für die Pflanzung in Töpfen als Zimmerschmuck, als Vorpflanzung für Gehölzgruppen oder als Solitär auf Rasenplätzen. David Stuart und James Sutherland schlugen in ihrem Buch „Plants from the Past“ aus dem Jahr 1989 etwas ironisch vor, Akanthus am besten vor ein georgianisches Haus zu pflanzen, das mindestens zwei korinthische Säulen oder Pfeiler besitzt.
Gut, wenn man eine solche Immobilie gerade sein Eigen nennen kann …
SUMPF-SCHAFGARBE
> Eine Staude, die vom Frühsommer bis in den Herbst ununterbrochen und zuverlässig blüht, ist der traum jedes Gärtners. Mit dieser gefüllt blühenden Schönheit in reinem Weiß scheint der Wunsch in Erfüllung gegangen zu sein – und das schon vor mehr als 130 Jahren! <

Achillea ptarmica
Korbblütler, Asteraceae
Heimat: Die Wildform ist in Europa und Westasien heimisch.
Wuchsform: Aufrecht, Ausläufer treibend.
Blatt: Lanzettlich, ungeteilt, am Rand fein gezähnt, dunkelgrün.
Blüte: Weiße, gefüllte Körbchenblüten, in Schirmrispen.
Blütezeit: Juni bis Oktober.
Frucht: Steril.
Wuchs-/Blütenhöhe: 70 cm.
Standort: Sonnig bis halbschattig in feuchtem Boden.
Pflege: Der Boden darf nicht austrocknen. Nach einem Rückschnitt remontiert die Staude.
Vermehrung: Durch Stecklinge im Sommer und Teilen im Herbst.
Besonderes: Die gefüllte Sorte ‘Schneeball’ ist auch unter dem Namen ‘Boule de Neige’, ‘The Pearl’ und ‘Perle’ im Handel.
Die Wildform, im Volksmund auch Wilder Bertram oder Weißer Dorant genannt, ist eine wertvolle Beetpflanze, ein schöner Rosenbegleiter und zudem eine haltbare Schnittblume. Früher galt die an feuchten Standorten vorkommende Wildstaude als Zauberpflanze. Sie sollte – in welcher Form auch immer – zur Abwehr von Hexen und Teufeln dienen. Getrocknet wurde die Sumpf-Schafgarbe einst als Niespulver verwendet. Darauf verweisen die alten englischen Bezeichnungen Old Man’s Pepperbox und Sneezewort (Nieswurz), nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen, botanisch nicht verwandten, auch Lenzrose genannten Art (Helleborus). Im „Hortus Eystettensis“, einem bebilderten Pflanzenverzeichnis aus dem Jahr 1613, wird auf Tafel 288 die ungefüllte Wildart unter dem Namen Ptarmica vulgaris abgebildet. Ihren Weg als Zierpflanze in unsere Gärten fand die Staude erst, als Ende des 16. Jahrhunderts eine gefüllte Varietät in England entdeckt wurde, die Carolus Clusius im Jahr 1601 als Ptarmica vulgaris, flore pleno beschrieb. Kultiviert hat man die gefüllte Form der Sumpf-Schafgarbe, die auch Bertramsgarbe genannt wird, anfangs nur in Botanischen Gärten und fürstlichen Anlagen. Nachweislich pflanzte man sie 1646 im Botanischen Garten von Altdorf bei Nürnberg. Der Naturforscher Johann Sigmund Elsholtz verzeichnete sie im Jahr 1663 in seiner „Flora Marchica“ unter dem von Caspar Bauhin geprägten Namen Dranunculus pratensis, flore pleno („Wiesen-Dragone mit gefüllten Blüten“). Schließlich eroberte sie aber auch die Bauerngärten, wo man sie liebevoll „Hemdenknöpfchen“ oder „Silberknöpfchen“ nannte. In England verwendete man die Pflanze einst auch beim Bierbrauen.
Es gibt mehrere gefüllte Sorten im Handel, darunter A. ptarmica ‘Nana Compacta’, die nur 30 cm hoch wird. Die noch vor 1879 von Victor Lemoine in Nancy gezüchtete Sorte ‘Boule de Neige’ (‘Schneeball’) ist ein bewährter Klassiker, der nicht nur uns mit Standfestigkeit, großen Einzelblüten und Robustheit bis heute überzeugt. Ein Autor in „Möller’s Deutscher Gärtner-Zeitung“, übrigens einem Quell historischer Zitate über Pflanzenschätze, schwärmte im Jahr 1894 von den Qualitäten dieser Sorte: „Eine weiße Schnittblume, die ohne besondere Kultur ununterbrochen, ja ununterbrochen, vom Mai bis zum Winter blüht (…) Die neue Sorte ist in allen Teilen robuster und im Wuchse üppiger; die einzelnen Blumen sind ganz bedeutend größer, so groß wie ein Zehnpfennigstück, reinweiß gefüllt und in lockeren, langstängeligen Dolden stehend. Die Hauptsache aber ist, dass die Pflanze, je mehr sie geschnitten wird, fortwährend neue Blütenstängel nachtreibt, also vollständig remontierend ist.“ Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.

Gefüllte Bertramsgarbe (Achillea ptarmica ‘Schneeball’).
Carolus Clusius
Charles de l’Écluse (1526–1609) war ein flämischer Botaniker, der seinen Namen zu Carolus Clusius latinisierte. Er studierte Jura, Philosophie und Medizin. Letzteres beinhaltete botanische Studien. Clusius unternahm im Jahr 1564 mit dem Augsburger Bankierssohn Jakob III. Fugger eine Exkursion auf die Iberische Halbinsel, wo er zahlreiche neue Pflanzenarten entdeckte. Von 1573 bis 1576 war er Hofbotaniker Kaiser Maximilians II. in Wien, wo er einen Medizinalgarten und das ers...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Inhalt
- Vorwort
- DIE GESCHICHTE DER STAUDENZÜCHTUNG
- DIE STAUDEN IM PORTRÄT
- DIE VERWENDUNG HISTORISCHER STAUDEN IN GÄRTEN
- SERVICE