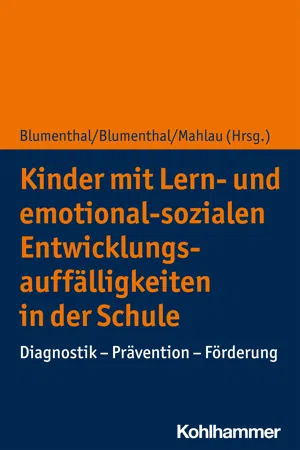
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Kinder mit Lern- und emotional-sozialen Entwicklungsauffälligkeiten in der Schule
Diagnostik - Prävention - Förderung
- 252 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Kinder mit Lern- und emotional-sozialen Entwicklungsauffälligkeiten in der Schule
Diagnostik - Prävention - Förderung
Über dieses Buch
Lern- und emotional-soziale Entwicklungsauffälligkeiten bei Schülerinnen und Schülern treten häufig gemeinsam auf und werden von Lehrkräften als besondere Herausforderung wahrgenommen. Mit Fachbeiträgen und Kommentaren renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie anhand von Interviews mit schulischen Akteurinnen und Akteuren werden in diesem Buch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse im Hinblick auf grundlegendes Praxiswissen für die Gestaltung von Unterricht und Schule beschrieben. Der Fokus liegt auf den Themenschwerpunkten problembezogene Grundlagen, Trends in der Diagnostik, Trends in Prävention und Intervention sowie Ableitungen für die Lehrkraftprofessionalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Kinder mit Lern- und emotional-sozialen Entwicklungsauffälligkeiten in der Schule von Stefan Blumenthal, Yvonne Blumenthal, Kathrin Mahlau, Stefan Blumenthal,Yvonne Blumenthal,Kathrin Mahlau im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Bildung & Lernschwierigkeiten. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
III Trends in Prävention und Förderung
Interview III: Chancen und Herausforderungen inklusiver Beschulung – Das Rügener Inklusionsmodell aus sonderpädagogischer Sicht
Anna Hensen & Ricarda Bethke-Köhler
Liebe Frau Hensen, liebe Frau Bethke-Köhler, mit Prof. Dr. Bodo Harke verbindet Sie beide eine mehrjährige berufliche Zusammenarbeit. Sie beide unterstützten insbesondere das große Schulprojekt »Rügener Inklusionsmodell«, oder – wie es in der praktischen Umsetzung auf Rügen heißt – die »Präventive und Integrative Schule auf Rügen«, als Koordinatorinnen und Sonderpädagoginnen.
Was war und ist jetzt aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung in der Implementation?
Anna Hensen & Ricarda Bethke-Köhler: Die größte Herausforderung für uns war, dass die bisherige Berufserfahrung kritisch hinterfragt und grundlegende Standpunkte auf den Prüfstand gestellt wurden, Dies war nicht für alle einfach. PISaR erforderte hohes fachliches und diagnostisches Verständnis in den sonderpädagogischen Förderbedarfen Verhalten, Lernen und Sprache und in den pädagogischen Bereichen Rechnen, Lesen und Rechtschreibung. Wir wurden mit umfangreichen und teilweise neu entwickelten Testverfahren im Rahmen von mehrjährigen, wissenschaftlich fundierten Fortbildungskursen konfrontiert. Die Erwartungen aller an den Sonderpädagog*innen waren und sind »auf jedem Gebiet Experte« zu sein.
Mit welchen Unterstützungssystemen haben Sie die Herausforderungen meistern können?
Anna Hensen & Ricarda Bethke-Köhler: Die inhaltliche, wissenschaftliche Unterstützung erfolgte durch die Universität Rostock im Rahmen des Rügener Inklusionsmodells (RIM). Bei der Umsetzung der vorgegebenen Theorie in die Praxis hilft die Regionale Lenkungsgruppe (RLG) mit Beratung vor Ort an den Schulen und mit inhaltlichen Anpassungen an die Praxis, strukturellen Vorgaben wie beispielsweise Zeitschienen, Qualitätsstandards und Kernaufgaben. Die Schulleiter*innen unterstützten die Akzeptanzbildung der sonderpädagogischen Arbeit in den Einsatzschulen. Ohne dieses Engagement der Schulleitungen ist Teamarbeit mit den Kolleg*innen im Rahmen von PISaR nicht möglich. Auch der regelmäßige fachliche und persönliche Austausch unter allen in PISaR tätigen Sonderpädagog*innen in Fachkonferenzen trägt zur Entwicklung und den Erhalt des hohen fachlichen Niveaus der sonderpädagogischen Arbeit bei.
Was ist aus Ihrer Sicht der zentrale Baustein von PISaR? Welche Faktoren sind relevant?
Anna Hensen & Ricarda Bethke-Köhler: PISaR hat viele wichtige Bausteine. Als zentraler Baustein hat sich für uns die Teambesprechung herauskristallisiert. Es hat sich gezeigt, dass diese Form der Kommunikation Voraussetzung für die Umsetzung einer passgenauen, individuellen Förderung in allen drei Förderebenen ist. Der regelmäßige, datenbasierte Austausch ermöglicht konkrete Zielsetzungen und Anpassungen für das einzelne Kind – auch für den regulären Unterricht in der Förderebene I.
Was hat PISaR in den beteiligten Schulen bewirkt?
Anna Hensen & Ricarda Bethke-Köhler: Der Einzug der Sonderpädagogik in den schulischen Alltag der Regelschule hat einen veränderten Blick auf das einzelne Kind bewirkt. Vor PISaR war die sonderpädagogische Förderung punktuell und begrenzt. Die Zuständigkeit für die Schüler*innen lag ausschließlich bei den Sonderpädagog*innen. Hier hat PISaR ein großes Umdenken ausgelöst. Alle am Kind arbeitenden Lehrkräfte und Pädagog*innen empfinden es als ihre gemeinsame Aufgabe jedes Kind individuell zu fördern.
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erfolge?
Anna Hensen & Ricarda Bethke-Köhler: Die Öffnung der Schulen für die Arbeit der Sonderpädagog*innen führte zu einer Akzeptanzbildung für Integration bei Eltern, Schüler*innen und Kolleg*innen. Ein großer Erfolg ist auch die datenbasierte Arbeit am Kind. Sie ermöglicht eine wirksame und vor allem effektive Förderung. Die Verständigung auf eine einheitliche Auswahl von Lehr- und Lernmitteln, Fördermitteln, diagnostischen Verfahren und Möglichkeiten der Dokumentation vereinfacht die Arbeit aller Beteiligten. Aus unserer Sicht ist der mittlerweile selbstverständliche Umgang mit Schüler*innen und ihren sonderpädagogischen und pädagogischen Förderbedarfen bei Mitschüler*innen, Eltern und Kolleg*innen der größte Erfolg von PISaR. Die erfolgreiche Beschulung fast all dieser Kinder ist dafür ein deutlicher Beleg.
PISaR steht für …
Anna Hensen & Ricarda Bethke-Köhler: … Akzeptanz, Integration, Kooperation, Beratung, Teamarbeit, Kommunikation, datenbasiertes Arbeiten, Evaluation und hohe Fachlichkeit.
14 Mehrebenenmodelle im inklusiven Unterricht: Trojanische Pferde oder zukunftsfähige Innovationen?
Franz B. Wember
Wer sich in den letzten Jahren in der deutschsprachigen Fachliteratur über aktuelle Forschung zur Entwicklung des inklusiven Unterrichts informiert hat, ist über kurz oder lang auf das von Bodo Hartke 2010 auf den Weg gebrachte Rügener Inklusionsmodell (RIM) und das Praxisprojekt Präventive und Integrative Schule auf Rügen (PISaR) gestoßen. Beide Projekte ergeben ein groß angelegtes Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur prototypischen Entwicklung eines inklusiven Systems der effektiven schulischen Förderung für alle Lernenden, das in einer Region insgesamt implementiert und zugleich beforscht und auf diese Weise sukzessiv verbessert werden soll (Hartke, 2017). Ein »gemäßigtes Inklusionsverständnis« (S. 13) leitet alle Aktivitäten. Einerseits werden für das gemeinsame Lernen aller Schüler*innen miteinander und voneinander größtmögliche »Teilhabe, Wertschätzung, Anerkennung und Chancengerechtigkeit … als ideelle Zielsetzungen akzeptiert« (ebd., Hervorhebung i. O.), andererseits geht es »in der Praxis … vor allem um ein höheres Maß an Teilhabe von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen und auch um deren optimale Förderung … [durch] eine fachlich hochwertige schulische Förderung, die so angemessen wie möglich vorrangig in der allgemeinen Schule realisiert werden soll« (S. 14, Hervorhebungen i. O.). Um beides, das gemeinsame Lernen und die besondere Förderung, im Schulalltag verwirklichen zu können, entwerfen Hartke und sein Team als »Kernstück« (Voß et al., 2016, 19) ein Mehrebenenmodell, das den organisatorischen Rahmen vorgibt. Was sind Mehrebenenmodelle, welchen theoretischen Hintergrund haben sie und mit welchen pädagogischen Hoffnungen werden sie verknüpft? Im Folgenden werden diese Fragen aufgegriffen, ausgesuchte Daten zur empirischen Bewährung vorgestellt und abschließend einige Kritikpunkte vorgetragen.
Die grundlegende Idee kommt aus den USA und hat eine lange Vorgeschichte. Bereits 1962 hatte Reynolds vorgeschlagen, die vielfältigen, in den Schulen des Landes existierenden Varianten der sonderpädagogischen Förderung nach dem Grad ihrer Spezialisierung, nach dem Grad der Beeinträchtigung der Kinder und Jugendlichen, nach der Häufigkeit ihres Vorkommens und nach dem Ausmaß von Restriktionen zu ordnen, die bestimmte Hilfsangebote mit sich brachten. Reynolds (1962) unterschied 10 Varianten, die er in einem sog. Kaskadenmodell ordnete: Dessen große Basis bildeten Regelschulklassen ohne Hilfen und Regelschulklassen mit Beratung oder sogar zeitweiligem Förderunterricht durch Sonderpädagogen, in denen vor allem Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltensstörungen betreut wurden. Den mittleren Bereich bildeten Regelklassen mit kooperierenden Förderklassen und Integrationsklassen mit Zwei-Pädagogen-System bis hin zu kooperativ arbeitenden Förderklassen, in denen Lernende mit Lernbehinderungen und persistierenden Verhaltensstörungen gefördert wurden. Die Spitze bildeten die Sonderklassen und Sonderschulen, in einigen Fällen sogar geschlossene Heimsonderschulen für geistig, körperlich oder im Erleben und Verhalten erheblich beeinträchtigte junge Menschen. Reynolds empfahl, diese Vielfalt zu erhalten, schließlich müssten die intensiven Angebote nur für relativ wenige Lernende bereitgehalten werden und die große Zahl der Lernenden mit Lern- und Verhaltensstörungen sei in den weniger intensiven Varianten erfolgreich zu fördern. Die Entscheidung, wer an welchem Ort und in welcher Weise beschult wird, so Reynolds (1962), solle jedoch unbedingt in Abhängigkeit vom Ausmaß der individuellen Beeinträchtigungen getroffen werden und immer wieder sei zu prüfen, ob ein Kind oder eine Jugendliche/ein Jugendlicher in eine weniger spezielle und vor allem weniger restriktive Maßnahme zurückkehren könne.
Reynolds Vorschläge waren folgenreich, sie prägten die nächsten 40 Jahre und führten in den USA zu einem gesetzlich verbrieften Anspruch auf sonderpädagogische Förderung, falls eine Behinderung amtlich festgestellt wurde. Dies bewirkte eine erheblichen Zunahme sonderpädagogischer Förderung und zugleich eine Ausweitung integrativer Schulangebote (mainstreaming), verbunden mit der gesetzlich verbindlichen Norm der least restrictive environments, gemäß der jede besondere Fördermaßnahme zu begründen und daraufhin zu prüfen ist, ob ein Kind in einer individuell passenden, aber möglichst normalen und wenig eingeschränkten schulischen Umwelt lebt und möglichst oft und lange mit allen anderen Kindern gemeinsam lernt, statt in eigens ausgesuchten Kleingruppen. Es zeigten sich jedoch auch gravierende Nachteile des Kaskadenmodells. Dieses war an den historisch gewachsenen Organisationsformen und Orten schulischer Förderung orientiert, die Reynolds erhalten wollte, statt an den Inhalten und Methoden des Unterrichts, die einer Revision bedurft hätten. Das Modell führte zu einem extrem hohen diagnostischen Aufwand, der zu betreiben war, um die Bedürftigkeit einzelner Lernender und damit verbunden deren Anspruch auf besondere Förderung festzustellen. Diese Bedarfsfeststellungsdiagnostik konzentrierte sich auf die Defizite eines Kindes und nicht auf seine Kompetenzen, zementierte die Existenz von zwei getrennten Systemen der allgemeinen und der sonderpädagogischen Förderung und legitimierte Ungleichheit der schulischen Bildungschancen, denn Förderung wurde nicht allen Lernenden eröffnet, sondern nur »behinderten« Kindern und Jugendlichen (Sailor et al., 2018).
Der Begriff Mehrebenenmodell, engl. multi-tiered system of support, wurde knapp 50 Jahre später von Horner und Sugai (2009) vorgeschlagen, um einige Probleme des alten Modells zu beheben und zwei programmatische Entwicklungen in die Schulentwicklungsdiskussion einzuführen, die parallel entstanden waren: Response to Intervention (RtI) und Positive Behavior Interventions and Supports (PBIS). Horner und Sugai (2009) sprechen von Mehrebenenmodellen dann, wenn ein offenes Kontinuum von pädagogischen Angeboten zunehmender Spezifität und Intensität allen Lernenden zugänglich ist. Sie begründen diese nicht defizitorientiert von individuellen Beeinträchtigungen, sondern kompetenzorientiert von Art und Umfang des pädagogischen Förderbedarfs her. Sie sehen das schulische Leben und Lernen aller Schüler*innen in der Verantwortung der gesamten Schule und insbesondere aller Lehrpersonen, unabhängig von der Art des Lehramts. Sie wollen die kategorische Diagnostik zur Bedarfsfeststellung durch eine dynamische, am Unterricht orientierte, curriculumbasierte Diagnostik ersetzen:
• In Mehrebenenmodellen koordinieren die Lehrkräfte verschiedene, an einer Schule angebotene Hilfen, indem z. B. allgemeinpädagogische und sonderpädagogische Angebote, Leistungen des schulpsychologischen Dienstes und der Schulsozialarbeit miteinander verknüpft werden.
• In Mehrebenenmodellen arbeiten alle Beteiligten evidenzbasiert, indem sie vorrangig empirische bewährte Methoden und Programme praktisch anwenden.
• In Mehrebenenmodellen entwickeln Schulen auf drei oder mehr Ebenen ein offenes Kontinuum von pädagogischen Angeboten, die grundsätzlich allen Lernenden zur Verfügung stehen, während zugleich auf übergeordneten Ebenen die Quantität und vor allem die Intensität der pädago...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Vorwort
- Inhalt
- I Problembezogene Grundlagen
- II Trends in der Diagnostik
- III Trends in Prävention und Förderung
- IV Ableitungen für die Lehrkraftprofessionalisierung