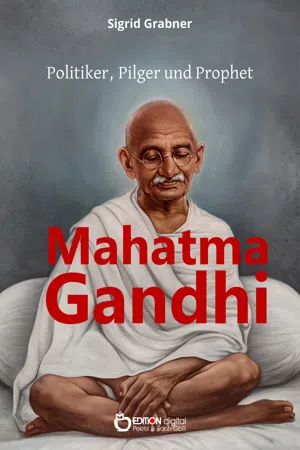![]()
Das Schwert der Gewaltlosigkeit
„Nur derjenige, der den Gesetzen zu gehorchen vermag, besitzt die Fähigkeit, ihnen nicht zu gehorchen. Nur wer aufbauen kann, darf zerstören.“
![]()
Die Phoenix-Farm
Wenige Tage nach seiner Ankunft in Durban zu Anfang des Jahres 1903 trug Gandhi dem Staatssekretär für die Kolonien, Chamberlain, die Beschwerden der Inder vor. Vor dem Burenkrieg konnte jeder Inder frei in den Transvaal einreisen. Jetzt bedurfte es dazu der Genehmigung des neu geschaffenen Asiatic Departement. Die Inder waren empört. Sie hatten im Krieg nicht die Briten unterstützt, um danach härter diskriminiert zu werden als je zuvor. Doch Mister Chamberlain hatte andere Sorgen. Er war gekommen, um Briten und Buren miteinander zu versöhnen. Die Inder störten ihn nur dabei. Mit den scheinheiligen Worten: „Sie wissen, dass die Königliche Regierung wenig Einfluss auf die sich selbst regierenden Kolonien hat“ speiste Chamberlain Gandhi ab. Aber der gab sich nicht geschlagen. Er reiste dem britischen Staatssekretär nach Pretoria nach. Die Behörden strichen seinen Namen von der Empfangsliste. Mister Chamberlain war für ihn nicht mehr zu sprechen.
Diesmal brauchte niemand Gandhi zu überreden, in Südafrika zu bleiben. Er ließ sich in Johannesburg nieder. Johannesburg war eine junge Stadt und verdankte ihre Existenz den Goldfunden am Witwatersrand. Die Einwohnerzahl stieg rasch an. Den Hügel über der Stadt krönte die Festung, die als Gefängnis diente. Gandhis Büro lag in einem Haus an der Rissik-, Ecke Andersonstraße. Über Mangel an Arbeit brauchte sich Gandhi nicht zu beklagen. Das Asiatic Departement, das die Asiaten schützen sollte, tat genau das Gegenteil. Ohne Widerspruch duldete es, dass Polizisten und Beamte von indischen und chinesischen Geschäftsleuten Gelder erpressten. Gandhi spürte solche Fälle auf und brachte sie vor Gericht. Hartnäckig verfolgte er das Ziel, die Inder in Südafrika in den Stand „echter Bürger des Empire“ zu versetzen.
Gandhi bewohnte ein einfaches Zimmer in der Nähe seines Büros. Die Freizeit verbrachte er mit Freunden bei langen philosophischen und religiösen Gesprächen. Er las Werke von Vivekananda und Patanjali über die Jogalehre. Nach wie vor beschäftigte ihn die Bhagavadgita. Während der morgendlichen Toilette lernte er alle achtzehn Gesänge des Lehrgedichts auswendig. Gandhi machte sich dessen Lehre zu eigen, ganz zweckfrei zu handeln und jedem Verlangen nach Erfolg zu entsagen; nicht um dieser Welt zu entfliehen, sondern um ihr im höchsten Maße zu dienen.
Anfang des Jahres 1904 ging ein ungewöhnlich starker Regen über Johannesburg nieder. Siebzehn Tage lang hingen schwere Wolken über der Stadt. Die Straßen wurden zu reißenden Bächen. Gandhi forderte die Behörden auf, der drohenden Seuchengefahr vorzubeugen. Seine Mahnung traf auf taube Ohren. Am 18. März erfuhr Gandhi, dass indische Arbeiter aus den Bergwerken an Lungenpest erkrankt waren. Noch ehe die Behörden überhaupt den Ernst der Lage begriffen, hatte Gandhi die Erkrankten bereits in einem leerstehenden Laden isoliert, sich um Geld, einen Arzt und Medikamente gekümmert. Er selbst half bei der Krankenpflege. Die Pest in Johannesburg kostete einhundertdreizehn Menschen das Leben, davon fünfundfünfzig Inder. Dass die Zahl der Opfer nicht höher war, verdankte die Bevölkerung von Johannesburg nicht zuletzt dem Rechtsanwalt Gandhi.
Als die Seuche gebannt war, reiste Gandhi nach Durban. Dort erschien seit einiger Zeit die Wochenschrift „Indian Opinion“ in Englisch, Tamil, Gujarati und Hindi. Da die meisten Inder die englische Sprache gar nicht oder nur mangelhaft beherrschten, war diese Zeitung ein wichtiges Informationsmittel für sie. „Indian Opinion“ bezog mehr Inder als je zuvor in den Kampf um ihre bürgerlichen Rechte ein. Gandhi verwandte den größten Teil seines Einkommens darauf, die Zeitung zu finanzieren. Dennoch überstiegen die Unkosten beständig die Einkünfte. Nun stand die Zeitung vollends vor dem Bankrott. Gandhi wollte retten, was noch zu retten war. Während der vierundzwanzigstündigen Reise von Johannesburg nach Durban las er das Buch des englischen Kunstkritikers John Ruskin „Unto this last“ („Diesem Letzten“), das ihm ein Freund auf dem Bahnhof zugesteckt hatte.
Ruskin griff das herrschende englische Industriesystem an und stellte der entwürdigenden Jagd nach Profit ethische Forderungen entgegen. Nicht der Gewinn sei das Ziel aller Arbeit, sondern der Dienst an der Gesellschaft, schrieb er. Der seelischen und physischen Verkrüppelung des Menschen durch den Kapitalismus müsse man mit körperlicher Arbeit begegnen und eine soziale Hierarchie aufbauen, die sich nicht auf Geld, sondern auf Verdienste gründe.
Obwohl das Buch Gandhi nichts grundlegend Neues sagte, las er es mit wachsender Erregung. Als er in Durban den Zug verließ, war er entschlossen, Ruskins Ideen in die Tat umzusetzen. Vor Freunden in Durban entwickelte er einen Plan, wie man vernünftiger leben und damit gleichzeitig die „Indian Opinion“ retten könne. Gandhi wollte eine Farm gründen, auf der ein jeder körperliche Arbeit verrichtete und sich in der Freizeit daran beteiligte, die „Indian Opinion“ zu drucken. Doch er redete nicht lange über das Projekt. Der Zustimmung seiner Freunde sicher, ging er sogleich daran, es zu verwirklichen. Schon nach wenigen Tagen hatte er ein geeignetes Stück Land ausfindig gemacht und käuflich erworben. Obstbäume und eine Quelle sicherten den Siedlern fürs Erste bescheidene Lebensmöglichkeiten. Gandhi und seine enthusiastischen Mitstreiter kümmerte es wenig, dass das Gelände verwildert war und ganze Mückenschwärme über sie herfielen. Sie besaßen ihre Hände, viele Ideen und einen grenzenlosen Optimismus. Zuerst wohnten sie in Zelten. Als sie für die Druckerpresse eine wetterfeste Behausung gebaut hatten, lernten sie Typen setzen und die Presse bedienen. Nach einem halben Jahr angestrengter Arbeit erschien am 24. Dezember 1904 auf der Phoenix-Farm – so genannt wegen der nahe gelegenen Bahnstation Phoenix – die erste Nummer der „Indian Opinion“. Sie bestand aus nur einem Blatt, aber ihr Erscheinen war von nun an gesichert. Sie konnte weiter ihre Aufgabe erfüllen, „die europäischen und indischen Untertanen von König Eduard näher zueinander zu bringen, zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen, Gründe für Missverständnisse auszuräumen, den Indern ihre Fehler bewusst zu machen und sie auf ihre Rechte und Pflichten hinzuweisen“.
Unermüdlich feuerte Gandhi die Fantasie und Energie seiner Mitarbeiter an. Er bearbeitete wie sie den Boden, setzte Typen, druckte, schrieb Artikel und kümmerte sich um den Vertrieb der Zeitung. Feste Unterkünfte wurden gebaut. Bald finanzierte die Farm sich selbst. Als die Rechtsanwaltspraxis Gandhi nach Johannesburg zurückrief, wusste er die Phoenix-Farm und die „Indian Opinion“ in den besten Händen. Er wäre gern länger geblieben, aber die Inder in Johannesburg brauchten ihren Anwalt. Vielfältig waren die Klagen, und Gandhi übernahm jeden Fall, dessen Rechtsanspruch ihn überzeugte. Von den Armen verlangte er keine Bezahlung oder nur so viel, wie sie geben konnten.
Die Hoffnung, bald nach Indien heimkehren zu können, hatte Gandhi längst aufgegeben. Also musste die Familie zu ihm kommen. Anfang des Jahres 1905 traf Kasturba mit den drei Söhnen Manilal (zehn), Ramdas (acht) und Devadas (fünf) in Johannesburg ein. Harilal, der Älteste, war bei der Familie in Rajkot geblieben. Die Gandhis bezogen ein zweistöckiges Haus in einem Außenbezirk von Johannesburg. Mit ihnen zusammen lebten das befreundete englische Ehepaar Polak und die Frau eines englischen Freundes. Gandhi war das Oberhaupt dieser großen Familie. „Bapu“ (Vater) nannte man ihn. Das einfache Leben von Phoenix zog auch in Gandhis neuem Haushalt ein. Jeder verrichtete körperliche Arbeit. Der Weizen wurde selbst gemahlen, das Brot im Hause gebacken. Jeden Morgen gegen sieben Uhr dreißig verließ Gandhi das Haus und legte die neun Kilometer zu seinem Büro zu Fuß zurück. Oft begleiteten ihn die Kinder. Unterwegs lehrte er sie Gujarati, ihre Muttersprache. Englisch lernten sie nebenbei. Gandhi war der Meinung, dass intellektuelle Studien zwar notwendig, aber nicht das Wichtigste seien. Die Kinder sollten sich selbst und ihre Möglichkeiten erkennen, gemäß diesen Erkenntnissen leben und nicht ihre Zeit damit verbringen, totes Wissen anzuhäufen. Bücher haben nur geringen Wert, wenn ihre Leser über sie die Welt vergessen, bemerkte Gandhi. In der klugen Beschränkung der eigenen Studien sah er keinen Mangel, sondern Stärke. Er opponierte damit gegen das englische Bildungssystem, das den Verstand des Schülers einseitig entwickelte, seinen Charakter und seine praktischen Fähigkeiten hingegen vernachlässigte. Kinder, so meinte Gandhi, sollten nicht auf eine Karriere, sondern auf das Leben vorbereitet werden.
Von neun Uhr morgens bis fünf Uhr abends arbeitete Gandhi in seinem Büro und bei Gericht. Nach einem zweistündigen Fußmarsch erreichte er wieder sein Heim, wo alle gemeinsam das Abendessen einnahmen: hartgebackenes Brot, Nussbutter, Gemüse, Rohkostsalate. Die folgenden Stunden gehörten der Bhagavadgita. Gandhi rezitierte einzelne Verse, sein Freund Polak las sie in der englischen Übersetzung vor. In der nachfolgenden Diskussion, an der alle, auch die Kinder, teilnahmen, sprach man über das eben Gehörte und verband es mit den Problemen des täglichen Lebens. Diese Stunden gemeinsamen Nachdenkens mochte niemand missen.
![]()
Zölibat
Im April 1906 erhoben sich die Zulus gegen die Engländer. Nach langen erbitterten Kämpfen gegen die Buren und Briten hatten sie ihre Unabhängigkeit verloren und waren nun britische Untertanen. Als sie sich weigerten, Steuern zu zahlen, gingen die Engländer erbarmungslos gegen sie vor. Wie schon während des Burenkrieges bot Gandhi den Behörden an, ihnen mit einem Ambulanzkorps zu helfen. Diesmal ließ die zustimmende Antwort der Briten nicht so lange auf sich warten. Gandhi brachte seine Familie auf die Phoenix-Farm und sammelte vierundzwanzig Freiwillige. Die Abteilung ging sofort an die Arbeit. Was Gandhi während des Zulu-Aufstandes erlebte, erschütterte ihn. Dies war kein Krieg, sondern Mord. Die Briten weigerten sich, den Zulus medizinisch zu helfen. Die Inder nahmen sich der verwundeten Zulus an. Selten waren es Kämpfer, sondern meist unschuldige Dorfbewohner, die von den englischen Soldaten schwer misshandelt worden waren. Sechs Wochen dauerte der Einsatz. Dann wurden die Inder in Ehren entlassen.
Während des Zulu-Aufstandes fasste Gandhi einen Entschluss, der in keinem Zusammenhang mit dem zu stehen schien, was sich an Schrecklichem vor seinen Augen abspielte. Er wollte fortan sexuell enthaltsam leben. Schon nach der Geburt des vierten Sohnes, Devadas, hatte er versucht, sexuelle Enthaltsamkeit zu üben. Kasturba kränkelte, und sie wollten keine Kinder mehr haben. Jetzt ging es Gandhi um mehr als um Empfängnisverhütung. Die frühe Ehe, der Tod seines Vaters, während er bei Kasturba weilte, seine jähzornige Leidenschaftlichkeit in den Liebesbeziehungen zu seiner Frau belasteten ihn seit langem mit einem Schuldkomplex. Sich davon zu befreien war sicher ein wichtiger Grund für Gandhis Entschluss, aber nicht der wichtigste. Wie Tolstoi quälte ihn der Widerspruch zwischen der Hinwendung zur eigenen Familie und dem Dienst an der Gesellschaft. Diesen Widerspruch konnte Gandhi für sich nur auflösen, indem er die Gemeinschaft als Familie betrachtete. Befreit von den Fesseln der Leidenschaft, der Eifersucht und des Besitzanspruches, öffnete sich ihm der Weg zu einer tieferen Bindung. Stand nicht in der Bhagavadgita: „Was man Entsagung nennt, das erkenne als Hingabe, o Pandu-Sohn! Denn wer den Wünschen nicht entsagt, kann (auch) nicht Hingabe üben. Für den zur Vereinigung (mit der Weltseele) emporstrebenden Weisen gilt die Tat als Element.“
Hinzu kommt ein weiteres Moment. Nach dem Hinduglauben durchläuft der einzelne im Idealfall vier Lebensphasen: die des Schülers; die des Hausvaters; die des Asketen, der sich auf die Suche nach seinem Selbst begibt, und die des wandernden heiligen Bettlers, der im Einklang mit seinem Selbst lebt. Gandhi sah sich auf der dritten Stufe angekommen. Entsagung bedeutete ihm uneingeschränkte Hingabe an die Tat, in der sich das Selbst des Menschen erst offenbart.
Frauen übten auf Gandhi zeitlebens eine große Anziehungskraft aus. Er schätzte ihre Sensibilität, ihren Mut und ihre Opferbereitschaft, bewunderte ihre Schönheit und Grazie. Er liebte Kasturba. Sexuelle Enthaltsamkeit zu üben fiel ihm schwer. Doch sie ermöglichte es ihm, die an die Sexualität gebundene Lebenskraft für höhere Zwecke freizusetzen. So wurde ihm der Verzicht nicht Opfer, sondern ein Quell innerer Freude. Er brachte ihn in Einklang mit dem, was er für gut und richtig hielt. Wie wenig ihm das Zölibat Selbstzweck war, geht aus einem Brief Gandhis hervor. Darin vergleicht er sich mit der Mutter, die „niemals freiwillig in einem feuchten Bett schlafen“ würde, „aber sie wird es nur zu gern tun, wenn sie dadurch ihrem Kind ein trockenes verschafft“. Nur wer seine Ich-Bezogenheit aufgebe, könne das Leben anderer ändern.
Nach Phoenix zurückgekehrt, sprach Gandhi mit Kasturba über seinen Entschluss. Kasturba begriff wohl am besten, wie schwer ihm das Gelübde fiel. Er war ein Mann von siebenunddreißig Jahren. Sie kannte seine Sinnlichkeit, aber auch seine Charakterstärke. Krank und des mehr als zwanzigjährigen Liebeslebens wohl auch müde, erleichterte sie der Entschluss ihres Mannes mehr, als dass er sie betrübte. Gandhi sollte Jahre später sagen, seine wahre Liebe zu Kasturba hätte da begonnen, wo seine Begierden aufhörten.
Das Gelübde der sexuellen Enthaltsamkeit entsprang der tief im Hinduglauben verwurzelten Überzeugung, dass Energien, die in eine bestimmte Richtung gelenkt werden müssen, nicht gleichzeitig einem anderen Ziel zufließen können. Angesichts des Elends und der Ungerechtigkeit wuchs in Gandhi der leidenschaftliche Wunsch, alle seine Energien in den Dienst der Rechtlosen und Unterdrückten zu stellen.
![]()
Die Kraft der Wahrheit und der Liebe
Der Ruf nach Gandhis Diensten ließ nicht lange auf sich warten. Am 22. August 1906 veröffentlichte das Regierungsblatt von Transvaal ein Meldegesetz (Black Ordinance), nach dem sich jeder Asiate über acht Jahre mit Fingerabdrücken und Personenkennzeichen registrieren lassen musste. Den daraufhin ausgestellten Meldeschein hatte er ständig bei sich zu tragen und auf Verlangen der Polizei vorzuweisen. Wer sich innerhalb einer festgesetzten Frist nicht registrieren ließ, sollte das Recht verlieren, in Transvaal zu wohnen, und zu einer Geldstrafe von hundert Pfund oder zu drei Monaten Gefängnis oder Deportation verurteilt werden.
Dieses diskriminierende Gesetz empörte die indische Gemeinschaft. Gandhi ließ es in vollem Wortlaut in der „Indian Opinion“ veröffentlichen und rief zum Widerstand auf. Am 11. September trafen sich im Jüdischen Empire Theatre in Johannesburg mehr als dreitausend Inder aus Transvaal. Sie schworen, das Gesetz nicht zu befolgen und alle sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen. Gandhi sagte: „Ich habe alle antiasiatischen Gesetze in Südafrika studiert, aber niemals ist mir etwas begegnet wie dieses Gesetz. Ich fühle, dass wir mit diesem Schritt das Richtige getan haben. In all unseren Aktionen sind wir voller Loyalität. Für mich gibt es nur einen Weg: eher zu sterben, als mich diesem Gesetz zu unterwerfen …“ Aber Denkschriften und Proteste blieben erfolglos. Der ehemalige Burengeneral Smuts erklärte auf einer Wahlversammlung im Oktober 1906: „Der asiatische Krebsschaden, der sich schon so tief in Südafrikas lebenswichtige Organe eingefressen hat, muss nun entschlossen ausgerottet werden.“ Ihm sekundierte der künftige Regierungschef der Südafrikanischen Union, Botha: „Wenn meine Partei ans Ruder kommt, werden wir die Kulis binnen vier Jahren aus dem Land getrieben haben.“ Da Transvaal britische Kronkolonie und damit London für alle Gesetze verantwortlich war, beschloss die indische Gemeinschaft, eine Delegation nach England zu entsenden. Vor der Abreise im Oktober 1906 sagte Gandhi: „Wir werden natürlich unser Bestes tun, aber ich habe wenig Hoffnung, dass sich unser Verlangen erfüllt.“ – Wie recht er mit seiner düsteren Prognose hatte, sollte sich bald zeigen. Dabei ließ sich alles günstig an. Der Staatssekretär für die Kolonien empfing die Inder freundlich und versprach zu helfen. Der Staatssekretär für Indien, der liberale Premierminister Bannermann, und zahlreiche Parlamentsmitglieder schienen beinahe ebenso entrüstet über das neue Gesetz wie die Inder selbst. Die „Times“ veröffentlichte einen Brief Gandhis zu dieser Frage, die „Daily News“ unterstützte ihn in einem Leitartikel, andere Zeitungen interviewten ihn. Auf der Rückreise nach Südafrika erfuhr Gandhi, dass sich der Staatssekretär für die Kolonien außerstande sah, dem König ohne weitere Prüfung eine Zustimmung zum Gesetz anzuraten. Die Inder schienen gesiegt zu haben. Doch ihre Freude war nur von kurzer Dauer.
Am 1. Januar 1907 erhielten Transvaal und der Oranje Free State die Selbstregierung. Sie unterstanden nicht mehr dem Staatssekretär für die Kolonien und der liberalen Regierung in London. Ihre Gesetze bedurften nur noch der formellen Zustimmung des Königs. Deshalb also die vielen freundlichen Gesichter in London, die so großzügig gespendeten Sympathieerklärungen! Die britische Regierung hatte es – vor allem mit Blick auf die Stimmung in Indien – für taktisch klüger gehalten, dem Meldegesetz die Zustimmung zu versagen, da die Regierung von Transvaal es binnen kurzer Zeit ohnehin aus eigener Macht rechtskräftig werden lassen konnte.
Auf der ersten Sitzung des Parlaments von Transvaal nach dem 1. Januar 1907 wurde quasi eine Kopie des Meldegesetzes von 1906 eingebracht. Am 1. Juli 1907 trat es in Kraft. Bis zum 31. Juli 1907 sollten sich alle Inder registrieren lassen. Gandhi rief eine Assoziation des passiven Widerstandes ins Leben. Er sprach auf zahllosen Versammlungen unter offenem Himmel, erklärte die Situation und beschwor das gemeinsame Gelübde, sich diesem Gesetz nicht zu beugen. Inder gingen von Haus zu Haus und sprachen mit ihren Landsleuten über den Sinn dieses Widerstandes, dabei immer der Worte Gandhis eingedenk: „Jeglicher Zwang widerspricht dem Geist unseres Kampfes.“ In den Straßen von Pretoria erschienen Plakate mit der Aufforderung, die Meldebüros zu boykottieren. Bis Ende Juli hatten sich von den eintausendfünfhundert Indern in Pretoria nur hundert registrieren lassen.
Die Regierung warnte, drohte mit Deportation und Entzug der Handelslizenzen. General Smuts fand starke Worte: „Die Regierung hat sich vorgenommen, dieses Land zu einem Land des weißen Mannes zu machen, und wie schwer diese Aufgabe für uns auch sein mag, wir haben unseren Fuß niedergesetzt, und dort bleibt er.“
Die Inder ließen sich nicht beeindrucken. Sie schöpften Kraft und Zuversicht aus den Artikeln Gandhis in der „Indian Opinion“. Die Auflage der Zeitung stieg sprunghaft an, sie wurde zum Sprachrohr des passiven Widerstandes. „Satyagraha“ nannte Gandhi diesen passiven Widerstand. Satyagraha ist „die Kraft, geboren aus der Wahrheit und der Liebe oder Gewaltlosigkeit.“ Die Regierung verlängerte die Meldefrist bis Ende November. Vergeblich. Von den dreizehntausend Indern in Transvaal ließen sich nur fünfhundertelf registrieren.
Innenminister Smuts riss die Geduld. Hier half nur noch Gewalt. Er ließ Gandhi am 27. Dezember ins Marlborough House bestellen und ihm mitteilen, dass er und vierundzwanzig weitere Führer der Satyagraha-Bewegung verhaftet würden. Gandhi versprach, dass sich alle am nächsten Morgen punkt zehn Uhr vor den für sie zuständigen Richtern einfinden würden. Bei den Behörden hatte es sich herumgesprochen, dass man diesem Mann unbedingt vertrauen konnte. Gandhi wusste die Frist zu nutzen. An diesem Freitagabend erläuterte er in einer Versammlung vor über tausend Indern die neue Situation, klar, nüchtern, illusionslos. Er beschuldigte die Engländer, selbst die Saat der Revolution zu legen, und griff die unchristliche Haltung der Regierung in Transvaal an: „Wenn Jesus Christus nach Johannesburg und Pretoria käme und die Herzen von General Botha, General Smuts und der anderen prüfte, würde er etwas dem christlichen Geist Fremdes, sehr Fremdes bemerken.“ Gandhi verschwieg nicht die Entbehrungen und Leiden, die die Kämpfer erwarteten. Dennoch sei es besser, den ohnehin kärglichen Lebensunterhalt zu verlieren als die Selbstachtung. Jeder der Zuhörer wusste, dass dieser Mann meinte, was er sagte. Sie vertrauten ihm bedingungslos.
Am 28. Dezember 1907 wurden der Rechtsanwalt Gandhi und seine vierundzwanzig Gefährten dazu verurteilt, die Kolonie innerhalb von zwei Wochen zu verlassen. Grund: Verletzung des Meldegesetzes. Die Regierung wollte damit ein Exempel statuieren. Nach der Verhandlung erklärte Gandhi: „Wir kämpfen weiter, was mir oder jemand anderem auch passieren mag.“ Vierzehn Tage später standen Gandhi und seine Freunde erneut vor Gericht, weil sie die Aufforderung, die Kolonie zu verlassen, nicht befolgt hatten. Es war ein seltsames Gefühl für Gandhi, als Angeklagter in dem überfüllten Gerichtssaal zu sitzen, in dem er so oft als Rechtsanwalt aufgetreten war. Aber er fand sich schnell in die ungewohnte Rolle, die er als „ehrenvoller als die eines Rechtsanwalts“ bezeichnete. Das Gericht verurteilte Gandhi zu zwei Monaten Gefängnis. Die Inder demonstrierten mit schwarzen Fahnen gegen das Urteil, bis die Polizei sie auseinandertrieb. Ende Januar saßen einhundertfünfundfünfzig Inder aller Kasten und Glaubensbekenntnisse in den Gefängnissen Transvaals.
In Südafrika gab es zwei Klassen von Gefangenen – farbige und weiße. Die Inder teilten die viel zu eng gewordenen Zellen mit Afrikanern. Ihr Verhalten erstaunte die Gefängniswärter. Die Satyagrahis, wie sie sich selber nannten, unterwarfen sich widerspruchslos allen Gefängnisregeln, soweit sie durch sie nicht diskriminiert wurden. Obwohl es niemand von ihnen verlangte, trugen sie Gefängniskleidung. Gandhi kümmerte sich um seine Mitgefangenen, setzte sich für besseres...