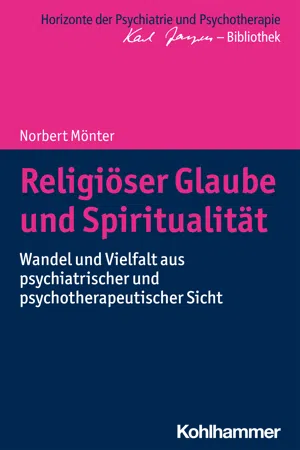![]()
1 Definitorische Vorbemerkungen zu Religion, Glauben und Spiritualität
Die Welt des religiösen Glaubens und der Weltanschauungen, der religiösen Gemeinschaften und Kirchen, der Religiosität und Spiritualität, der Sekten und des Aberglaubens ist vielgestaltig und facettenreich. Zur Vermeidung grober Missverständnisse erscheinen einige definitorische Vorbemerkungen, wie die Begriffe in diesem Buch verwandt werden, unverzichtbar. Einleitend geht es um die Abgrenzung der Begriffe Religion, religiöser Glauben, Religiosität und Spiritualität. Es ist von Bedeutung, dass es eine allgemeinverbindliche Definition von »Religion« seitens der Religionen selbst und auch seitens der unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen nicht gibt; das macht deutlich, dass es bei der Religion und verwandten Begriffen um einen standpunkt- und kontextabhängig unterschiedlichen Verständigungsprozess und um Deutungen geht. Gut geeignet für eine in diesem Buch oft vergleichende resp. übergreifende Sicht der Religion resp. der Religionen erscheint die Definition von Peter Antes, dem langjährigen Präsidenten der International Association for the History of Religions. Antes begleitet den Berliner »Arbeitskreis Religion & Psychiatrie« seit erster Tagung in 2006. In seiner Definition von Religion weist Antes auf die Provenienz seiner aus dem christlich geprägten Kulturkreis hin und schreibt: Religion sei »seit der Aufklärungszeit eine übliche Bezeichnung für Weltanschauungen […], die verschiedene Dimensionen umfassen« (Lexikon des Dialogs 2016, S. 367). Es geht – so Antes – um
a. »eine kognitive (z. B. Vorstellungen vom Universum und von der Welt, Wertesystem, Glauben an die Existenz des Übernatürlichen),
b. eine affektive oder emotionale (d. h. religiöse Gefühle, Einstellungen und Erfahrungen),
c. eine instinktive oder verhaltensmäßige (z. B. Riten und soziale Bräuche wie Opfer, Gebete, Zauberformeln, Anrufungen),
d. eine soziale (z. B. Existenz einer Gruppe) und
e. eine kulturelle (z. B. Abhängigkeit der Religion von Zeit und Raum, von dem ökologischen, sozialen und kulturellen Umfeld)« (ebd., S. 367, Hervorhebung im Original).
Die von Prof. Mehmet Kalayci (Islamisch-theologische Fakultät der Universität Ankara) in dem schon genannten Lexikon des Dialogs gegebene Definition von din (Religion) greift konkret auf Korantexte zurück; Kalayci schreibt: »Gott hat die Religion (din), auf die hin der Mensch von Natur aus angelegt ist […], in vollendeter Form geoffenbart […] und dabei den Gläubigen weder unlösbare Aufgaben noch Zwang auferlegt […]« (ebd., S. 368, Hervorhebung im Original). Din wird abgegrenzt von den Scharias, die die praktische Umsetzung der grundlegenden metaphysisch-ethischen und unveränderbaren Prinzipien von din in je Gemeinschaft unterschiedlicher und veränderbarer Weise vorgeben (vgl. ebd., S. 368–369).
Die hier deutlich werdende starke Kontextabhängigkeit der Definitionen gilt grundsätzlich auch für das Selbstverständnis anderer Religionen. Dies ist ebenso für den Begriff »Glauben« zu berücksichtigen. Darauf weist der Berliner Religionswissenschaftler Hartmut Zinser kritisch hin, »wenn wir außereuropäische nichtchristliche Religionen Glauben nennen, auch wenn in diesen von Glauben nicht die Rede ist, sie sich selber vielmehr als Einsicht in Wahrheiten (Buddhismus) oder als Erfüllung der Pflichten gegenüber den Göttern (römische Religion) oder als Unterwerfung unter Gottes Willen (Islam) ansehen« (Zinser 2000, S. 5).
Aufgrund unterschiedlicher Definitionen bestehen anhaltend unterschiedliche Auffassungen, welcher Bewegung, welchem geschichtlichen, gesellschaftlichen Phänomen überhaupt die Zuschreibung »Religion« zugestanden wird; markantestes Beispiel ist wohl der Konfuzianismus, der ohne Gottesvorstellung und ohne Jenseits auskommt. Unter dem nicht nur ökonomisch wichtigen Aspekt der rechtlichen Stellung und staatlicher Privilegien religiöser und weltanschaulicher Gemeinschaften ist in Deutschland die staatliche Anerkennung der Bezeichnung »Religionsgemeinschaft« auf Antrag (also entsprechend der Selbsteinschätzung) hin bedeutsam; Voraussetzung einer Anerkennung ist u. a., dass Kriterien wie »Einheit des Bekenntnisses«, »geistiger Gehalt«, »Gefügtheit« u. ä. erfüllt sind (vgl. hierzu Rademacher 2003, S. 603 ff.). Das ist nicht ganz konfliktfrei, da die grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit eine inhaltliche Prüfung ja untersagt, worauf hier nur hingewiesen sei.
»Der religiöse Glaube« dient diesem Buch als Titelgeber auch als inhaltliche Ausrichtung, da er auf den persönlichen Glauben als psychologisches Phänomen fokussiert. Er korrespondiert mit der formalen oder auch nur inneren Zugehörigkeit zu einer Religion in der oben wiedergegebenen Definition von Antes. Unterschieden wird, wie in
Kap. 8 näher ausgeführt, u. a. zwischen dem persönlichen und dem kollektiven religiösen Glauben.
Spiritualität, früher im Christentum oftmals als »Frömmigkeit«, im Islam und anderen Religionen u. a. auch als »Geistigkeit« verstanden, hat seine Herkunft nicht nur in den traditionellen großen Religionen, sondern auch in vielen religiösen Bewegungen der letzten Jahrzehnte. So wird Spiritualität von esoterischen Spezialanschauungen als Inhalt in Anspruch genommen wie der Begriff auch als Marketingprodukt auf dem Sinngebungsmarkt fungiert. Eine humanistische Spiritualität ohne Transzendenzbezug, die z. B. der Dalai Lama vertritt (mit grundlegenden menschlichen Werten wie Güte, Freundlichkeit, Mitgefühl und der liebevollen Zuwendung) sowie eine säkularisierte Spiritualität wie sie der Philosoph Thomas Metzinger mit seinem Konzept von »Spiritualität und intellektuelle Redlichkeit« (Metzinger 2014) propagiert, erweitern den Begriff hin zu einem Sammelbegriff, dessen Aussage zunehmend unspezifisch erscheint.
Andererseits hat der Begriff mit diesem sehr weit gefassten Verständnis aber Eingang auch in Resolutionen der Weltgesundheitsorganisation gefunden. »Für die Weltgesundheitsorganisation (WHO 1998) ist dagegen jeder Mensch spirituell, weil er sich spätestens angesichts des Todes existenziellen Fragen stellen muss. […] Heute wird das Konzept Spiritualität weltweit als wichtiger Faktor für gesundheitliches Wohlbefinden angesehen und dient als anthropologische Kategorie, um die existenzielle Lebenshaltung insbesondere in Grenzsituationen zu beschreiben. Spiritualität kann als die Bezogenheit auf ein größeres Ganzes definiert werden, die inhaltlich entweder religiös (›Gott‹), spirituell (›Energie‹) oder säkular (›Natur‹) gefüllt wird« (Utsch 2020a, S. 53). Dieses Verständnis korrespondiert mit einem Statement von Albert Einstein zur Religiosität, was nun wiederum die begrifflichen Überschneidungen spiegelt, aber inhaltlich ob der poetischen Dimension dieses Genies der Naturwissenschaft zitiert sei: »Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es liegt der Religion sowie allem tieferen Streben in Kunst und Wissenschaft zugrunde. Wer dies nicht erlebt hat, erscheint mir, wenn nicht wie ein Toter, so doch wie ein Blinder. Zu empfinden, dass hinter dem Erlebbaren ein für unseren Geist Unerreichbares verborgen sei, dessen Schönheit und Erhabenheit uns nur mittelbar und in schwachem Widerschein erreicht, das ist Religiosität. In diesem Sinne bin ich religiös« (Einstein 1932).
Die beschriebene Unschärfe der Definitionen und ausdrückliche Kontextbindung kann nicht als Spezifikum des religiösen Bereichs angesehen werden; offenkundig ist sie auch als Ausdruck kategorial eben nicht unumstößlich präzise erfassbarer Phänomene der existenziell-essenziellen Wirklichkeit des Menschen anzusehen. So sollte sie nicht als Unzulänglichkeit oder gar Fehler missinterpretiert werden; bei allem wichtigen Bemühen um präzise Sachverhaltsbeschreibungen sollte das Verständnis von Unschärfe gerade als Ausdruck adäquater und souveräner Situationserfassung angesehen werden. Auch im Psycho-Bereich geht es nicht viel anders, wenn man auf die unterschiedlichen Verstehenskonzepte der Psychotherapie mit kaum noch vollständig erfassbarer Differenzierung der verschiedenen Psychotherapierichtungen wie auch der Psychiatrie und Psychosomatik mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln (biologisch, sozial, ethnologisch, kulturell, neurobiologisch, somatopsychisch u. a. m.) schaut. Auf die unterschiedlichen Standpunkte aus psychotherapeutischer und psychiatrischer Perspektive und die Konzeptunterschiede der unterschiedlichen psychotherapeutischen Schulen wird nicht explizit eingegangen; sie werden vielmehr als sich in ihren Perspektiven ergänzend und weniger als konkurrierend verstanden.
![]()
2 Überlegungen zur Entstehung religiösen Glaubens
2.1 Primus in orbe deos fecit timor
Die Frage nach dem Anfang, dem Ur-sprung und der frühesten Entwicklung von Religion ist wie die Frage nach der Entstehung (der »Schaffung«), dem Anfang und der frühen Entwicklung der ersten Menschen unverändert herausfordernd und hochspannend. »Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?« so beginnt Thomas Mann seine berühmte Tetralogie »Joseph und seine Brüder« und nennt sein Vorspiel mit dem Abriss babylonischer, ägyptischer und biblischer Geschichte »Höllenfahrt«. Seine erklärte Absicht: »im Geist der Ironie das Wesen des Menschen in seinen mythischen Anfängen zu erkunden« (Mann 1954, S. 5). Es sind die großen Mythen der Menschheit, die sich – zumeist verknüpft mit der Entstehung der Welt und des Menschen – auch mit der Entstehung der Religionen befassen. Gründungsmythen haben über alle Zeit hinweg als sinnstiftende, das Menschheitswissen komprimierende und transportierende Erzählungen gesellschaftlich eine nicht zu ersetzende Bedeutung und behaupten ihre Wirkmächtigkeit in den unterschiedlichen Kulturen und Erdteilen bis heute.
Hier geht es erstmal um einige historische Fakten; denn der Nebel um den Auftritt des Homo sapiens vor gerademal ca. 200.000, nach neuesten Funden und Einschätzungen 300.000 Jahren (Djebel Irhoud, Marokko) in unserem viele Milliarden Jahre alten Kosmos beginnt sich seit etwa 200 Jahren zu lichten. Mit Charles Darwins Evolutionslehre über die Entstehung der Arten im 19. Jahrhundert und der nachfolgenden u. a. molekulargenetischen Forschung des 20./21. Jahrhunderts kann wissenschaftlich bekanntermaßen heute nicht mehr bestritten werden: Im Zusammenspiel mit umweltinduzierten Selektionsprozessen vergrößerte sich das Gehirn unserer affenähnlichen Vorfahren über Millionen von Jahren bis hin zur Fähigkeit des aufrechten Ganges (»homo erectus«). Mit der immer differenzierteren Nutzung der Hände wie auch der Ausbildung eines differenzierten Kommunikationsorgans, des Kehlkopfs, zeigte sich – nach weiteren Entwicklungsstufen – schließlich in Afrika »Homo sapiens«, der wissende Mensch. Nicht wenige Details der Entwicklung sind weiter Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und Diskussion. Belegt ist ein migrantischer Grundzug des Homo sapiens, wenngleich er später sesshaft wurde. Allein die Schnelligkeit seiner Besiedlung der aus afrikanischer Sicht restlichen Welt ist beeindruckend. Diese ersten Wanderungsbewegungen der modernen Menschen von Afrika nach Europa und Asien, später dann auch in alle weiteren Kontinente, sind mittlerweile relativ klar, da sie durch genetische Marker im Y-Chromosom heute lebender Menschen rekonstruiert werden können.
Menschheitsgeschichtlich ist davon auszugehen, dass gemeinsame Vorstellungen von der eigenen Person, dessen Lauf von Geburt bis zum Tod sowie von der Belebtheit der umgebenden Welt und damit verknüpfter Bedeutungskonstruktionen an zumindest basale Formen sprachlicher Verständigung und an soziale Strukturen gebunden waren. Überhaupt ist die Entstehung religiöser Vorstellungen und kultischer Handlungen nur als ein soziales und nicht individuelles Phänomen denkbar. Dies gilt für die Bedeutungssetzung wie natürlich die sich daraus ergebenden frühen gemeinschaftlichen Handlungsweisen wie z. B. Bestattungen. Diese liegen zeitlich zwischen 120.000 v. u. Z. und 37.000 v. u. Z. und werden als die ältesten bekannten, kultisch-religiös motivierten Handlungen zusammengefasst. Die Erforschung des sozialen, kulturellen Lebens der frühen Menschen beruht vor allem auf klassisch archäologischen Funden, die mit modernster, vor allem radiologischer Technik auf Alter, Herstellungsmodus, (Ab-)Nutzung untersucht werden. Auch tragen entwicklungspsychologische, kognitionswissenschaftliche oder auch neurobiologische Forschungen zu immer komplexer werdenden Vorstellungen von der Entwicklung der Religion bei. Simple Analogieschlüsse aufgrund von Vergleichen mit heutigen Naturreligionen bzw. ethnischen Religionen, die zuvor aufgrund ihrer angeblichen »Primitivität« lange für die ältesten Formen von Religion gehalten wurden, werden heute von den meisten Religionswissenschaftlern abgelehnt; diese schriftlosen Religionen sind aufgrund der nicht vorhandenen Dogmen und ihrer großen Anpassungsfähigkeit allesamt jünger als Schrift-Religionen. Andererseits gehen jede Befundinterpretation und spekulative Theorieformulierung auch von der motivationalen, emotional-affektiven wie kognitiven Gegebenheit aus, wie wir sie heute bei uns Menschen in den unterschiedlichen sozial-kulturellen Kontexten anfinden. Allerdings fehlen für diesen frühen Prozess der Menschheitsgeschichte die theoriebelegenden Texte.
Mit dieser Einschränkung erscheint die Feststellung, dass mit verfeinerten Bestattungsformen in der jüngeren Altsteinzeit (ca. 40.000–11.500 v. u. Z.) erste Jenseitsvorstellungen verknüpft sind, relativ belastbar, wie auch die in dieser Zeit entstandenen Höhlenmalereien (Funde bis dato vor allem in Südfrankreich, Nord-Spanien sowie Indonesien, Australien, auch Afrika) religiöse Interpretationen zulassen. Dies gilt auch für die Skulpturen; sehr häufig sind Frauenskulpturen, die Interpretationen als (Mutter-)Göttinnen und als Symbole von Fruchtbarkeit und des Kreislaufs des Lebens gefunden haben. Zu den komplexen Diskussionen in der Religionswissenschaft inkl. der unterschiedlichen Interpretationsmodelle vorliegender Befunde sei verwiesen auf die ausführliche interdisziplinäre Darstellung »Götter, Gene, Genesis« (Wunn et al. 2015). Als eine zentrale Botschaft unterstreichen die Autoren, dass »die Religionsentwicklung durch das Paradox gekennzeichnet ist, dass ihr Verhaltensmuster zugrunde liegen, die verhaltensbiologisch teils sehr viel älter sind als der Mensch« (ebd., S. VII). Sie führen u. a. die Verteidigung des eigenen Territoriums als Lebensgrundlage an. Die Allgegenwärtigkeit des Todes und eine bedrohliche Umwelt sind zudem der Hintergrund für die »kulturgenerierende Bedeutung von Angst und Angstbewältigung« (ebd., S. 22). Sie verweisen auf die »Notwendigkeit existentielle Ängste zu bewältigen, als Motor für die Entstehung von Religion« (ebd. S.26) und zitieren den berühmten Ethnologen Bronislaw Malinowski (1884–1942): »Von allen Ursprüngen der Religion ist das letzte Grundereignis – der Tod – von größter Wichtigkeit« (ebd., S. 26). Bereits 1988 wies der Religionswissenschaftler Hartmut Zinser auf die religionspsychologisch viel zu wenig berücksichtigte »bereits in der Antike bekannte Überlegung, primus in orbe deos fecit timor1« (Zinser 1988, S. 105) hin, die ja auf Psychisches verweist, »indem in dieser Überlegung die Angst, sowohl de facto die Angsterzeugung, als auch das Versprechen der Angstbewältigung ins Zentrum der Religion gerückt ist« (ebd., S. 105).
2.2 Entstehung und Bedeutung des Ritus – der sakrale Komplex I
Angst und Angstbewältigung stehen auch am Beginn der Entwicklung ritueller Handlungen und den damit korrespondierenden Narrativen, den Mythen. Die Fülle der Literatur zu diesem Thema ist geradezu unübersehbar. Aufgrund seiner umfassenden und in seinen Schlussfolgerungen für einen Psychiater/Psychotherapeuten der Praxis gut nachvollziehbaren kulturgeschichtlichen Analyse wird nachfolgend immer wieder auf das zweibändige große Alterswerk Jürgen Habermas’ »Auch eine Geschichte der Philosophie« Bezug genommen; Habermas bezieht sich mit seinem klaren philosophisch-kulturanthropologischen Anspruch häufig auf Karl Jaspers und setzt sich mit seinen Thesen kritisch auseinander. Im 1. Band »Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen« seines grundlegenden Werkes (Habermas 2019) hat er umfänglich die »sakralen Wurzeln« und die prähistorischen Weltbilder und den »Weg zur achsenzeitlichen Transformation des religiösen Bewusstseins« (ebd., S. 175–306) untersucht; von ihm stammt auch der Begriff des sakralen Komplexes. Habermas fragt, worin das »exclusiv Eigene der Religion« besteht (ebd., S. 189), und konstatiert: »Das nachmetaphysische Denken neigt dazu, das der Religion eigentümliche, für ein religiöses Weltverständnis konstitutive Moment zu verfehlen, solange es nur die kognitiven Strukturen in den Blick nimmt […]. Diesem Blick entgleitet der sakrale Komplex, der sich keineswegs nur aus […] Lehrinhalten zusammensetzt, sondern eben auch aus dem gemeinschaftlichen rituellen Vollzug der existenziell gelebten Glaubensinhalte« (ebd., S. 192).
Dem Ritus schreibt Habermas einen »nachvollziehbaren intrinsischen Sinn« für die beteiligten Gläubigen zu, »ganz unabhängig davon, welche Funktion ihm aus Beobachterperspektive zugeschrieben werden kann« (ebd., S. 192). Er nimmt eine »Durkheim’sche Beobachtung, dass alle bekannten Kulturen unmissverständlich zwischen sakralen und profanen Handlungsweisen und entsprechenden Lebensbereichen unterscheiden« (ebd., S. 194) auf und formuliert als Entstehung...