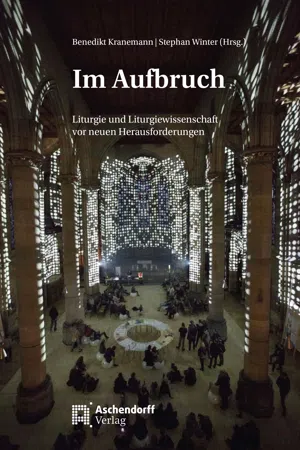
eBook - ePub
Im Aufbruch
Liturgie und Liturgiewissenschaft vor neuen Herausforderungen
- 240 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Im Aufbruch
Liturgie und Liturgiewissenschaft vor neuen Herausforderungen
Über dieses Buch
Die Liturgiewissenschaft steht als theologische Disziplin vor besonderen Herausforderungen. Sie hat in der Konzils- und Nachkonzilszeit ihre spezifische Ausformung erfahren, die lange Zeit prägend war. Aber Kirche, Liturgie sowie das weitere Umfeld haben sich stark verändert: In sechs Jahrzehnten sind die Weisen, in denen der christliche Glaube gelebt und gefeiert wird, vielfältiger geworden. Neben die Pfarrgemeinde sind eine Fülle anderer Orte des Gottesdienstes und des Gebets getreten – stabilere, aber auch zeitgebundenere. Für ihre Gestaltung spielen teilweise ökumenische Aspekte eine Rolle und die Beziehungen zu anderen Religionen, ebenso die Einbettung in das gesellschaftlich-kulturelle Umfeld, das mittlerweile eine Vielzahl anderer Rituale kennt.– Damit stellen sich Fragen rund um die Liturgiefähigkeit des Menschen und die Menschenfähigkeit der Liturgie anders und neu. Zudem muss das Verständnis der Liturgiewissenschaft im Zusammenhang der Diskussion über die zukünftige Gestalt universitärer Theologie und im Blick auf ihr interdisziplinäres Profil weiter geklärt werden.
Stimmen aus der Liturgiewissenschaft, aus anderen theologischen Disziplinen und aus der evangelischen Praktischen Theologie sowie aus verschiedenen kirchlichen Arbeitsfeldern gehen in diesem Buch der Frage nach: Was ist in näherer Zukunft Aufgabe und Beitrag der Liturgiewissenschaft in Theologie, Wissenschaft insgesamt, in Kirche und Gesellschaft?
Die Essays in diesem Sammelband richten sich an ein kirchlich und theologisch interessiertes Publikum. Entscheidungsträger*innen in Kirche und Gesellschaft werden ebenso angesprochen wie Fachwissenschaftler*innen, aber auch Studierende. Der Sammelband möchte eine Diskussion über das zukünftige Profil der Liturgiewissenschaft als basaler Disziplin katholischer Theologie anstoßen.
Mit Beiträgen von Harald Buchinger (Regensburg), Alexander Deeg (Leipzig), Peter Ebenbauer (Graz), Birgit Jeggle-Merz (Chur/Luzern), Thomas Jürgasch (Tübingen), Martin Klöckener (Freiburg/Ue.), Julia Knop (Erfurt), Benedikt Kranemann (Erfurt), Lisa Kühn (Osnabrück), Andreas Odenthal (Bonn), Johannes Pock (Wien), Thomas Schärtl (München), Hildegard Scherer (Chur) Kim Schwope (Dresden), Stephan Wahle (Freiburg/Br.), Martin Stuflesser (Würzburg), Stephan Winter (Tübingen), Alexander Zerfaß (Salzburg).
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Im Aufbruch von Benedikt Kranemann, Stephan Winter, Benedikt Kranemann,Stephan Winter im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theology & Religion & Christianity. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
Theology & ReligionThema
ChristianityDie Liturgie als Basis der Pastoral
Pastoraltheologische Anmerkungen zur brisanten Notwendigkeit einer gnadentheologisch orientierten Liturgie und Liturgiewissenschaft
Ottmar Fuchs
Wie Liturgie bzw. Liturgiewissenschaft und Pastoral bzw. Pastoraltheologie miteinander in die Zukunft gehen, könnte aus methodologischer Perspektive betrachtet werden: mit Blick darauf, wie sich beide Wissenschaften beispielsweise empirisch auf die für sie besonders relevanten Ausschnitte der Wirklichkeit beziehen, welche Humanwissenschaften sie beanspruchen und wie sie sich gegenseitig um wichtige Fragestellungen, Wahrnehmungen und die Identifizierung von Handlungsnotwendigkeiten bereichern. Das alles ist wichtig genug und wurde mittlerweile auch in entsprechenden Diskursen angedacht und hat bereits vielfältige Kooperationen möglich gemacht, die notwendig weiter vertieft werden müssen.
Hier darf ich mich auf eine zentrale inhaltliche Frage konzentrieren. Mir geht es dabei konkret darum, wie das Verhältnis zwischen Liturgie und Pastoral, zwischen Liturgiewissenschaft und Pastoraltheologie auf Zukunft hin zu profilieren ist, und zwar insofern, als diese Beziehung überhaupt zentral ist für das Christentum und für die künftige Gestalt von Kirche, aber auch weit darüber hinaus für die Konstitution von Religion und die Bedeutung von Religion für eine solidarische Gesellschaft sowie für humanisierende interreligiöse und interkulturelle Beziehungen.
Die Grundfrage lautet: Was können Liturgie und Pastoral dazu beitragen, dass Menschen dazu befähigt werden und sich dazu ermächtigt fühlen, mit anderen Menschen und Völkern zu teilen, die genau das Geteilte für ihr eigenes Wohlergehen nötig haben? Und für diejenigen, die eine solche Solidarität nötig haben, gilt die Grundfrage: Wie sind Liturgie und Pastoral zu gestalten, dass Menschen daraus Kraft gewinnen, zu überleben und zu widerstehen und ihre Rechte einzuklagen? Es geht in beiden Fällen um die wertvollste Ressource jedes Menschen, nämlich die Erfahrung von Geliebt-Sein, und um die daraus erwachsende Kraft, aus dieser Erfahrung heraus das Leben und Handeln empathiefähig zu gestalten. Primär und dominanzmäßig (sich nicht gegenseitig ausschließend) verhalten sich Liturgie und Pastoral dabei wie Gnade und Lebensgestaltung. Die dem entgegenstehenden Kräfte sind schnell genannt: Moralisierung, Fundamentalismus, Hegemoniestreben und identitäres Ausschlussverhalten. Demgegenüber brauchen wir einen Aufbruch zum Durchbruch bedingungsloser Gnade, damit die Welt nicht in Gnadenlosigkeit versinkt.
Die für die angesprochene Option normativen biblischen Texte geben dabei das Geleit: Texte, in denen gottbezogene Rituale Ressourcen freisetzen, um die Benachteiligten nicht aus dem Blick zu verlieren und sich für sie zu verausgaben bzw. die Situation auszuhalten und die Hoffnung nicht aufzugeben. In der Normativität der Bibel selbst ist die entsprechende Normativität der Liturgie für die Pastoral verwurzelt und begründet.
Es geht mir folglich darum, die Liturgie als einen theologischen Ort für die Entfaltung der Pastoral zu entdecken und von der Pastoral her den liturgischen Vollzug zu vertiefen. Auf der Basis der Geistbegabung der vergangenen und gegenwärtigen Gläubigen gibt es nicht nur zwei Quellen der Theologie und der Pastoral, sondern drei : Es gibt die normative Quelle der Bibel, es gibt die konstitutive Quelle der Traditionen der Kirche und es gibt die Quelle der Vorgegebenheit der Liturgien. Entsprechend wäre eine Hermeneutik zu entwickeln zwischen liturgischem Vollzug, dessen theologischer Reflexion und pastoraler Realität wie auch pastoraler Theologie. Dieser Gedanke legt sich bereits biblisch nahe: Denn in der Bibel gibt es eine vielfältige Beziehung zwischen Liturgie und Erzählung, zwischen Ritual und Lebensgestaltung. Einige solcher Beziehungen sollen hier in den Blick kommen in der Hoffnung, dass diese bedeutsam sein können auch für heutige Verhältnisse zwischen Liturgie und Pastoral und wie sie gestaltet werden. Sie sind aber auch bedeutsam für eine intensivere Zusammenarbeit von Liturgiewissenschaft und Pastoraltheologie, die sich von der Sache her nahelegt. Wenn deshalb im Folgenden von »Liturgie« gesprochen wird, ist Liturgiewissenschaft immer mitzudenken.
1. RITUALE UND PASTORAL IN DER BIBEL:
EIN ERSTER ZUGANG ÜBER EX 15
Ich beginne mit dem Blick auf das erste Mose-/Mirjamlied in Ex 15,1–21. Es unterbricht in der Erzählung den Erzählverlauf, indem die Erzählung den Moses und die Israeliten ein Lied singen lässt, in dem die Ereignisse der Erzählung in einem Lobpreis eingesammelt werden und zum hymnischen Ausdruck kommen. Es ist ein Sprechakt, der die Erzählung anhalten, der innehalten lässt, und der offensichtlich auf eine schon bestehende kultisch geprägte Form zurückgreift: geprägt vermutlich in den jüdischen Gemeinden bzw. Familien des Exils, dem sich ein Gutteil der Verschriftlichung der Tora verdankt. Die Einleitung »Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied« klingt so, als wäre das Gebet längst bekannt. Und am Ende, nicht genug damit, das Lied einmal zu singen, wird es nochmals aufgenommen und antiphonal von Mirjam und den Frauen gesungen, ja im Tanz verstärkt (Ex 15,20ff.).
1 Ich singe dem Herrn ein Lied, /
denn er ist hoch und erhaben. /
Rosse und Wagen warf er ins Meer.
2 Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, /
er ist für mich zum Retter geworden. /
Er ist mein Gott, ihn will ich preisen; /
den Gott meines Vaters will ich rühmen. […]
6 Deine Rechte, Herr, ist herrlich an Stärke; /
deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind […].
13 Du lenktest in deiner Güte /
das Volk, das du erlöst hast, /
du führtest sie machtvoll /
zu deiner heiligen Wohnung […].
Texte wie das Mose-/Mirjam-Lied sind Leuchttürme, die ein besonderes Licht auf die anderen Texte werfen und ihr Verständnis prägen. Man könnte auch, analog zur Archäologie, von einer Tektonik sprechen, insofern hier so etwas wie ein Schnitt durch die Texte geschieht, in dem die unterschiedlichen, narrativ variablen Motive der erzählten Zeit auf einen invariablen Blick der besprochenen Zeit gehoben werden. Man kann auch ein Bild aus der Pflanzenwelt nehmen: Solche Texte vernetzen aus verschiedenen Richtungen der anderen Texte das, was das glaubensbezogene Wurzelwerk für all diese Texte ausmacht.
Solche »Passagen« zwischen den Erzählungen und zwischen der Erzählung und der Rezeption sind bedeutungs- und handlungsgenerative, oder – ungleichzeitig formuliert – »pastorale« Unterbrechungen des Textes, worin das im Text, meist narrativ, Vorhergehende und Nachfolgende einer ganz bestimmten Wahrnehmung aufgegeben wird: nämlich der Perspektive jenes Glaubens, der im Volk Israel bezüglich des Exodus vorhanden ist, und jener Rituale, die damit verbunden sind. Diese »Senkrechttexte«, die quer zum Erzähltext stehen, bedeuten intersituativ sehr viel: insofern sich bereits im Text die Begegnung zwischen zwei Welten, der vergangenen »andersortigen« mit der jeweils jetzigen an ihrem Ort, ereignet und ähnliche Prozeduren in der Gegenwart der Lektüre anregen will.
Man muss die Bibel kennen, um an verschiedenen Stellen die Konturen solcher Texte zu entdecken und miteinander in Begegnung zu bringen, wie voneinander (auch weit) entfernte liturgische Texte sich berühren. So bringt auch Psalm 135, Vers 5 ein ähnliches Gotteslob mit der Formulierung »Ja, ich habe erkannt, dass JHWH groß ist und dass unser Herr größer ist als alle Götter«, und eine weitere Anspielung findet sich bei Jithro in Ex 18,11 »Jetzt weiß ich: Jahwe ist größer als alle Götter. Denn die Ägypter haben Israel hochmütig behandelt, doch der Herr hat das Volk aus ihrer Hand gerettet.«
Indem solche Texte als Lied und Gebet formuliert sind, wird das Erinnerte zum Moment in der aktuellen Gottesbeziehung. So sind Erzähltexte flankiert bzw. unterbrochen von Textteilen, »die einerseits auf anamnetische Vergegenwärtigung und andererseits auf doxologische Performanz der Erzählung zielen.« (Scoralick 114) Egbert Ballhorn spricht hinsichtlich Ex 15 davon, dass sich die Bedeutung des Exodus nicht in der Handlung erschöpft, sondern dass hier die Hermeneutik dieses Ereignisses in einer zeitübergreifenden Metaphorik (Ballhorn 149) zum Ausdruck kommt. Die Verbindung unterschiedlicher Situationen im Modus eines pastoralliturgischen Innehaltens in der Doxologie macht deutlich, dass die Bibel selbst pastoralliturgisch verwurzelt ist.
Selbstverständlich gehen die Erzählungen dem entsprechenden Ritual voraus und ermöglichen dieses: Ohne die Exoduserzählung gäbe es auch nicht das Ritual des Mose-/Mirjamliedes. Ist aber einmal ein solches Ritual etabliert, dreht sich das Verhältnis von Ereignis und Ritual um, denn die folgenden Generationen kommen zuerst mit dem Ritual in Kontakt und fragen dann nach dem, was an Erzählung dahinter ist, was geschehen ist. So stellt der jüngste Sohn am rituell geprägten Seder-Abend des jüdischen Pessachfestes die Frage, was denn im Zusammenhang mit der Feier des Rituals damals geschehen und im Ritual gegenwärtig ist. In der Rezeption also ist das Ritual ontogenetisch vorgängig, die Generationen nehmen biographisch immer zuerst am Ritual teil, bevor sie die Hintergründe erfahren können. Derart kann man sagen: Es gibt eine Vorgegebenheit des Rituals, die von einer Normativität des Rituals sprechen lässt, insofern von ihm narrative und spirituelle Bedeutung zu erwarten ist – eine Bedeutung, die dazu führt, den Glauben und das Leben entsprechend zu gestalten. Bereits die Vorgegebenheit als solche hat einen inhaltlichen Aspekt, nämlich die gnadentheologische Auswirkung, das hier Erlebbare nicht selbst herstellen zu müssen, sondern als Gabe erleben zu dürfen. In unserem Sprachspiel: Die Liturgie geht der Pastoral voraus. Sie ist ein entscheidendes »extra nos« (außerhalb von uns) für die Gestaltung von Glauben und Leben. Dies beginnt in den Bundesschlüssen Gottes mit Israel, dies setzt sich eindrucksvoll fort in den neutestamentlichen Riten der Taufe und des Abendmahls.
Das extra nos bedeutet auch, dass das Ritual durch die Zeiten relativ konstant bleibt, denn wird es im Kern verändert, verliert es seine Gegenüberqualität zur Jetztzeit. Die gnadentheologisch motivierte Preisgabe der Rituale für möglichst viele Menschen bedeutet nicht, dass die Rituale im Kern entsprechend angepasst werden könnten oder müssten. So ist es unmöglich, zuzulassen, dass z. B. Eltern im Taufgespräch verlangen, dass die Taufformel gefälliger formuliert wird und überhaupt die Ritualteile nach dem Wunsch der Eltern verändert werden. Nicht das Sakrament, sondern die allgefällige Veränderung des Sakraments ist zu verweigern!
2. BIBLISCH BEGRÜNDETE RITUELLE PRAXIS:
KREATORISCH UND KONTRAFAKTISCH
Indem dies in einer Doxologie geschieht, wird auch die spirituelle Qualität dieses Textes deutlich. Gesang und Tanz Mirjams und das Lied des Mose verarbeiten nicht nur das erzählerisch gegebene Ereignis, sondern begründen und realisieren zugleich für Gegenwart und Zukunft, was hier erzählt wird, in der aktuellen Gottesbeziehung. Solche Zwischentexte heben den (Verlaufs-)Zeitindex auf und formulieren im Kult des Gotteslobes die Kriteriologie des gegenwärtigen und zukünftigen Lebens. Dies geht bis zum Paradox in Ps 137, dass in der Nichtbesingbarkeit der Situation, die eindrücklich benannt wird, dann doch im Vollzug das Lied gesungen wird, das Lied von Schöpfung und Rettung, das demnach kontrafaktisch erklingt:
1 An den Strömen von Babel, /
da saßen wir und weinten, / wenn wir an Zion dachten.
2 Wir hängten unsere Harfen /
an die Weiden in jenem Land.
3 Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder, /
unsere Peiniger forderten Jubel: /
»Singt uns Lieder vom Zion!«
4 Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, /
fern, auf fremder Erde? […]
6 Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, /
wenn ich an dich nicht mehr denke, /
wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe […]
Das Ritual, die Besingung Gottes, ereignet sich hier in der Paradoxie: Es wird die Nichtbesingbarkeit der Situation besungen. Derart kann man, ungleichzeitig formuliert, von einer gewissen Sakramentalität dieses Psalms sprechen. Gottes Rettung ist gegeben, noch bevor sie erfahren wird. Was das Sakrament bzw. so ein Textstück vergegenwärtigt, ist immer zugleich ein Versprechen, eine Verheißung, die jetzt in vielerlei Hinsicht in den Erfahrungen der Menschen noch nicht zuhause ist, sondern auf Hoffnung hin und oft genug wider alle Hoffnung (vgl. Röm 8,24) als etwas erfahren werden darf, was gleichwohl bereits in einer bestimmten Weise gegenwärtige Wirklichkeit ist, repräsentiert allein durch den Text und sein Ritual – ganz im Sinne des »Anitani« (»Du antwortest mir«) im Vers 22 des Psalms 22: Wo sich im Ritual dieses Gebets (und eines möglichen Heilsorakelrituals am Tempel) jene Antwort Gottes ereignet, die in Gott beschlossen und damit wirklich, aber jetzt noch nicht vollkommen erfahrbar ist. Derart wird der Glaube an die Rettung gegen jeden Augenschein lebendig.
Im Vollzug des Textes konstituiert sich die Wirklichkeit, die besungen und für die gedankt wird. So spricht der Dankpsalm 136 nicht nur von der Schöpfung durch Gott, sondern im antiphonalen »denn seine Huld währt in ewig« ereignet sich im Beten selbst ein performativer Schöpfungsakt, in dem das darin Ausgedrückte Realität »ist«. Und zwar nicht nur Realität für die Betenden, sondern, im Modus der Stellvertretung, für die ganze Welt.
1 Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, /
denn seine Huld währt ewig! […]
4 Der allein große Wunder tut, /
denn seine Huld währt ewig,
5 der den Himmel geschaffen hat in Weisheit, /
denn seine Huld währt ewig,
13 der das Schilfmeer zerschnitt in zwei Teile, / […]
denn seine Huld währt ewig, […]
14 und Israel hindurchführte zwischen den Wassern, /
denn seine Huld währt ewig,
25 der allen Geschöpfen Nahrung gibt, /
denn seine Huld währt ewig.
26 Dankt dem Gott des Himmels, /
denn seine Huld währt ewig.
Vor diesem Hintergrund wird umso einsichtiger, dass auch die liturgische Praxis ein ureigener theologischer Ort ist, mit entsprechend normativer Valenz, »normativ« im doppelten Sinn, nämlich von der Vorgegebenheit der Gnade (Ritual) her und von da aus als entsprechende Aufgabe (Pastoral). Zugleich wird hier deutlich, dass die Güte Gottes, die in Ewigkeit währt, durchaus unterschiedliche Erfahrungen beinhalten kann und derart auf Gott hin zusammenführt, ohne die Differenzen zu schmälern. Die Liebe begleitet alles, macht aber nichts unterschiedslos.
3. DIE INHALTLICHE DYNAMIK
Die rituelle Praxis nimmt die situativen Herausforderungen (von »gerettet werden« oder »in der Not bleiben müssen«) auf und steuert darin die Interpretation der narrativen Einheiten, wie sie aus der Tradition überkommen sind. Die inhaltliche Perspektive wurzelt in dem Glauben, dass JHWH das Elend seines Volkes hört und dass er rettet bzw. retten wird. Die Fixierung auf das eigene Volk wird aber dadurch gesprengt, dass sich diese Intention JHWHs auch gegen sein eigenes Volk richtet, wenn es sich selbst wie die »Ägypter« verhält und bei Anderen Elend verursacht.
Ps 135,9 verdeutlicht in der direkten Ansprache Ägyptens jene hermeneutische Inversion, in der Israel plötzlich als Ägypten angesprochen wird: Die Feinde sind die Möglichkeiten des Eigenen. Die Erwählung kann zur Verhärtung führen. Damit werden die Texte vor der Ideologisierung gerettet, sie als falsches Bewusstsein von dem zu gebrauchen, was tatsächlich der Fall ist. Sie stellen in sich selbst die Frage: Bin ich nicht schon auf der falschen Seite?
Die für die Inversion grundlegende Inhaltsdynamik ereignet sich besonders mit dem Jesajanischen und Jesuanischen Gottesknecht. Diese »Leuchtturmtexte« sind mit den Gottesknechtsliedern bei Jesaja auf der einen und den Passionsgeschichten Jesu in den Evangelien auf der anderen Seite gegeben. Oder man denkt an Ps 22 im Psalter und das Sterbegebet Jesu aus diesem Psalm im Markusevangelium. An solchen Texten schärft sich die Theologie eines mitfühlenden und verletzbaren Gottes, der keine himmlischen Heerscharen beansprucht. Die Entscheidung für den alttestamentlichen und neutestamentlichen Gottesknecht, nämlich Gewalt nicht auszuüben, sondern zu erleiden, und die von daher motivierte bzw. gelenkte Entdeckung ähnlicher Texte in der Bibel ergibt ein »Leuchtturmensemble«, das anders gelagerte biblische Stellen zu kritisieren vermag.
Für das gegenwärtige Verhältnis von Pastoral und Liturgie ist von dieser biblischen Einsicht her festzuhalten:
Die heute im Volk Gottes vorhandenen Liturgien können als außerbiblische »Leuchttürme« eine normative Bedeutung für die Pastoral haben. Diese Einsicht wird umso spannender, als man dabei die Pluralität unterschiedlicher Liturgien in Kirchen, Ländern und Erdteilen, also ihre jeweilige kulturelle und religiöse Prägung mit in den Blick nimmt. Wie beispielsweise am Weltgebetstag der Frauen gebetet und die Lit...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Liturgiewissenschaft in Transformation
- Bibel- und geschichtswissenschaftliche Perspektiven
- Systematisch-theologische Perspektiven
- Ökumenische und interreligiöse Perspektiven
- Kulturwissenschaftliche Perspektiven
- Praktisch-theologische Perspektiven
- Epilog
- Autorinnen und Autoren