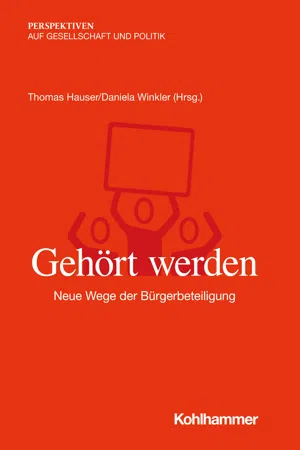![]()
Leitplanken des Rechts – Repräsentative und direkte Demokratie im Grundgesetz
Marc Zeccola
»Das Volksbegehren, die Volksinitiative […] ist […] in der großräumigen Demokratie die Prämie für jeden Demagogen«. (Theodor Heuss, Rede vor dem Parlamentarischen Rat, 9.9.1948)
Dieses Zitat wirkt aktuell, wenn man sich die Bilder der »Corona-Demonstrationen« vom 29. August 2020 und den damit verbundenen Versuch, in den Bundestag einzudringen, ins Gedächtnis ruft. Allenthalben sind »Wir sind das Volk«-Rufe zu hören und Forderungen, das Volk solle unmittelbar durch Volksentscheide die Corona-Maßnahmen bestimmen. Populistische Parteien machen sich diese Parolen zu eigen, um Wählerstimmen des Protestes abzugreifen: ein Lehrstück moderner Demagogie.
Proteste, Unzufriedenheit mit den Repräsentanten, ein Groll auf staatliche Institutionen insgesamt sind häufig mit der Forderung nach mehr direkten Einflussmöglichkeiten verbunden. Deshalb ist das Thema der direkten Demokratie aufgeladen durch eine Emotionalität, die einer sachlichen Debatte im Wege steht. Auch die bisweilen nüchterne Juristenzunft – vor allem die tendenziell konservativere Staatsrechtswissenschaft – bildet dabei keine Ausnahme. Gegenüber stehen sich Positionen, die kaum zu vereinbaren sind, da entweder ein Mehr an direkter Demokratie gefordert oder der Vorrang der repräsentativen Demokratie propagiert wird. Der wichtigste Grund für diese Divergenz liegt im Kern unserer Verfassung und betrifft das Grundverhältnis von repräsentativer und direkter Demokratie. Auch wenn die verfassungsrechtlichen Argumente längst ausgetauscht sind, sorgen soziale und politische Veränderungen für stetige Überlegungen, die direkte Demokratie auszubauen. Das Grundgesetz selbst ist vordergründig keine große Hilfe, da »Wahlen und Abstimmungen« (Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG) nebeneinander genannt werden und so auf den ersten Blick keine eindeutige Präferenz zu erkennen ist.
Direkte Demokratie berührt unterschiedlichste Aspekte: insbesondere demokratietheoretische, historische, verfassungsrechtliche, gesellschaftliche, die in den Diskussionen häufig durcheinandergeraten. Allen Aspekten ist aber gemein, dass Fragen der direkten Demokratie den Grundgehalt unserer Staatsform, also den Kern des gesellschaftlichen Zusammenlebens, berühren. Verfassungsrechtlich betreffen sie das Verhältnis vom Volk als Souverän zu den gewählten Vertretern, welches durch das Grundgesetz eingehegt wird.
Mittlerweile gibt es nicht wenige Vereinigungen (prominent beispielsweise Mehr Demokratie e. V.), die sich der Aufgabe verschrieben haben, für direkte Formen der Demokratie zu werben. Der Bundestag selbst greift das Thema regelmäßig auf und macht Vorschläge zur Integration direktdemokratischer Elemente ins Grundgesetz. In den Bundesländern werden die Hürden für direktdemokratische Instrumente weiter gesenkt, was sich aktuell wohl am deutlichsten im Koalitionsvertrag von Sachsen (2020) oder auch Baden-Württemberg (2021) ausdrückt. Virulent wird die Debatte jedoch vor allem in Phasen, in denen Defizite der repräsentativen Demokratie zutage treten bzw. das Vertrauen in die Repräsentation geschwächt ist. Diese Defizite sind nicht selten verbunden mit gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen, bei deren Bewältigung sich Teile des Volkes nicht vertreten oder ausgeschlossen fühlen. Denn der demokratische Diskurs benötigt Zeit zur Entfaltung: Nur so kann Akzeptanz für eine Entscheidung bzw. einen Konsens entstehen. Diese Zeit ist in Krisensituationen oft nicht vorhanden. Aktuelles Beispiel ist die Corona-Pandemie, in der Grundrechte kurzfristig tiefgreifend eingeschränkt werden mussten, in deren Vorfeld aber keine Zeit für die gesellschaftlich notwendige Diskussion blieb. Die Folgen waren und sind gesellschaftliche Proteste und Spaltungen, bei denen eine Minderheit nicht mehr bereit ist, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren. Aber auch permanente Herausforderungen wie die Klimakrise veranschaulichen das Dilemma. Auch hier können schnelle Maßnahmen unerlässlich sein, die im repräsentativen System so nicht angelegt sind. Zwar erkennt die Bevölkerung den grundsätzlichen Handlungsbedarf an, gegen konkrete Energiewendevorhaben aber gibt es große Widerstände – vor allem auf kommunaler Ebene. Als Folge dieser Entwicklungen kann u. a. das Vertrauen zu den gewählten Abgeordneten sinken, was einer repräsentativen Demokratie insgesamt abträglich ist. Sie wird hinterfragt und mit anderen Staatsformen verglichen – Alternativen werden überlegt. Solche Entwicklungen befeuern Diskussionen über den Wert der Demokratie an sich, wodurch die demokratische Grundhaltung in der Gesellschaft geschwächt wird. Thesen wie André Banks Renaissance des Autoritarismus (2009) oder Colin Crouchs Postdemokratie (2008) sollen hier nur beispielhaft genannt werden.
Neben dieser »krisenbedingten« Forderung nach mehr direktdemokratischem Einfluss hat sich in Deutschland das Verhältnis zwischen Bürger und Staat verändert. Bürger behaupten heute ihre
Mündigkeit gegenüber staatlichen Institutionen, wodurch das Über-/Unterordnungsverhältnis abgeschwächt und durch Kooperation ersetzt wird. Dies drückt sich in einem verstärkten Bedürfnis nach Partizipation aus, dem die Verwaltung mittlerweile immer mehr nachzukommen versucht. Insbesondere auf kommunaler und zum Teil auch auf Landesebene wird dieser Ruf bereits erhört. Kommunale Bürgerbegehren und auch Volksbegehren auf Landesebene haben zugenommen. Auch über Volksbefragungen oder Bürgerräte (
Beitrag Oppold/Renn) wird diskutiert, um Bürger in Entscheidungen einzubinden. Dieses neue mündige Selbstverständnis wird maßgeblich von der Exekutive (und zum Teil auch der Legislative) aufgegriffen und bedient, so dass verstärkt neue Beteiligungsformen in Wissenschaft, Politik und Verwaltung diskutiert werden. Dazu gehören auch die direkten Formen demokratischer Willensbildung, weshalb die Kenntnis über die verfassungsmäßigen Vorgaben unerlässlich ist.
Verfassungsrechtliche Grundlagen direkter Demokratie
Direkte Demokratie im Grundgesetz
Die Grundlage unserer Demokratie formuliert Art. 20 Abs. 2 des Grundgesetzes:
»Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.«
Dass die Staatsgewalt vom Volk ausgeht, ist die Grundbedingung der Demokratie. Hiermit erkennt das Grundgesetz die Volkssouveränität ausdrücklich an. Es enthält aber damit noch keine Aussage, in welcher Form das Volk an der politischen Entscheidung beteiligt ist. Dies beantwortet der folgende Satz, der zugleich das Dilemma direktdemokratischer Elemente der Verfassung enthält. Danach übt das Volk die Staatsgewalt unmittelbar durch »Wahlen und Abstimmungen« aus, mittelbar wird sie dann aber auf die »besonderen Organe« der drei Gewalten (Legislative, Exekutive und Judikative) übertragen. Diese Staatsorgane unterliegen einem Legitimationserfordernis, das sie bei der Ausübung der Staatsgewalt an das Volk bindet. Diese Legitimation ist das notwendige Bindeglied zwischen der staatlichen Gewaltausübung und dem Volk – und sichert also die Volkssouveränität.
Die Legitimationsvermittlung wird ebenfalls durch den zweiten Satz bestimmt, wonach das Volk durch Wahlen und durch Abstimmungen direkt in die Ausübung der Staatsgewalt eingebunden ist. Wahlen beziehen sich auf Personalentscheidungen des Parlamentes (also der Abgeordneten des Deutschen Bundestages). Das Grundgesetz bestimmt an dieser Stelle die repräsentative Demokratie als »Normalfall«. Das Verfahren und die Bedingungen der Wahl sind im Grundgesetz selbst verankert und legitimieren das Parlament damit unmittelbar. Exekutive und Judikative bleiben »nur« mittelbar legitimiert, wodurch zugleich die Stellung des Parlamentes als zentrales Verfassungsorgan hervorgehoben wird.
Abstimmungen sind hingegen Sachentscheidungen. Diese kennt das Grundgesetz als Territorialplebiszite an drei Stellen (Art. 29, 118, 118a). Sollen demnach territoriale Neuordnungen der Bundesländer umgesetzt werden, so müssen diese durch einen Volksentscheid bestätigt werden. Art. 118 und 118a GG enthalten spezielle Vorschriften zu Baden-Württemberg und Berlin bzw. Brandenburg. Durch die Gründung Baden-Württembergs aus den Ländern Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern im Jahre 1952 wurde Art. 118 GG obsolet. Art. 118a GG würde weiterhin im Rahmen einer Vereinigung von Berlin und Brandenburg Anwendung finden, auch wenn ein entsprechendes Vorhaben bereits 1996 gescheitert ist. Entscheidend ist, dass diese Sachentscheidung nur durch das von der territorialen Änderung betroffene Landesvolk, nicht das gesamte Bundesvolk getroffen wird. Außerhalb dieser Spezialfälle findet im Falle der Neugliederung Art. 29 GG Anwendung, wonach ebenfalls ein Volksentscheid des betroffenen Landesvolkes vorgesehen ist.
Neben diesen Territorialplebisziten nennt das Grundgesetz in Art. 28 Abs. 1 S. 4 GG ein weiteres direktdemokratisches Element: die Gemeindeversammlung. Dieses Element bezieht sich auf die kommunale Selbstverwaltung. Kleinere Kommunen können hiernach statt durch eine Gemeindevertretung (bspw. Gemeinderat) auch durch eine Gemeindeversammlung, also unmittelbar durch die (wahlberechtigten) Gemeindebürger über gemeindliche Angelegenheiten entscheiden. Praktische Relevanz hat diese Vorschrift kaum noch, da die für das Gemeinderecht zuständigen Bundesländer überwiegend auf eine landesgesetzliche Grundlage verzichtet haben. Lediglich Schleswig-Holstein sieht diese Möglichkeit noch für sehr kleine Gemeinden vor. Doch auch diese Stelle liefert keine Konkretisierung der Abstimmungen aus Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG, da keine unmittelbare Einbindung des gesamten Staatsvolks vorgesehen ist. Hieraus eine eindeutige verfassungsrechtliche Aussage für direktdemokratische Teilhabe des gesamten Volkes abzuleiten, wäre deshalb verfehlt.
Letztlich wird teilweise noch in Art. 146 GG ein obligatorischer Volksentscheid hineingelesen. Doch in der Verfassungsdogmatik nimmt diese Vorschrift eine Sonderrolle ein. Denn Art. 146 GG garantiert, dass das deutsche Volk über eine neue Verfassung selbst bestimmen kann, und definiert so das Volk als verfassungsgebende Gewalt. Das Verfahren wurde jedoch nicht konkretisiert, so dass auch aus Art. 146 GG eine Volksabstimmung nicht ausdrücklich herausgelesen werden kann.
Insgesamt kennt das Grundgesetz zwar in den genannten Spezialfällen Elemente direkter Demokratie. Abstimmungen für das gesamte Bundesvolk (Volksbegehren oder Volksentscheide) sind hingegen nicht ausdrücklich vorgesehen.
Formen direkter Demokratie und Begrifflichkeiten
Da es verschiedene Formen direktdemokratischer Instrumente gibt, ist es hilfreich, die Begriffe zu klären, um die verfassungsrechtlichen Zusammenhänge besser verstehen zu können. Denn nicht selten leiden Diskussionen an einem unterschiedlichen Verständnis der einzelnen direktdemokratischen Instrumente. So werden Begriffe in der Rechtswissenschaft wie Referendum und Plebiszit synonym verwendet oder »direktdemokratisch« wird durch »sachunmittelbar« ersetzt.
Gesetzliche Begrifflichkeiten bedürfen einer gewissen Unbestimmtheit, da so die Dynamik des Rechts garantiert wird. Diese Dynamik ermöglicht es, in der Rechtsanwendung auf die Besonderheiten von Einzelfällen einzugehen. Eine Konkretisierung muss hingegen möglich sein, da Rechtsfolgen absehbar sein müssen. Für diese Konkretisierung bedienen sich die Rechtswissenschaften bestimmter Auslegungsmethoden, die Auslegung erfolgt durch Rechtsprechung und Wissenschaft. Nicht selten variieren die dabei entwickelten Definitionen und es bilden sich bestimmte »herrschende Meinungen« heraus, die auf den schlüssigeren Argumenten beruhen. Im Folgenden dienen diese herrschenden Meinungen als Grundlage der Begriffe.
Vorweg ist der Begriff der sachunmittelbaren Demokratie zu erklären. Er ist im Verfassungsrecht häufig zu lesen und soll die direktdemokratischen Instrumente genauer spezifizieren. Denn strenggenommen ist die Wahl – also eine Personalentscheidung – das zentrale direktdemokratische Instrument der repräsentativen Demokratie. Um Ungenauigkeiten zu vermeiden, bezeichnen deshalb einige die Sachentscheidung in Form der Abstimmung als sachunmittelbare Demokratie. Dieser Begriff hat sich aber außerhalb der Rechtswissenschaften nicht durchgesetzt, so dass unter direktdemokratischen Instrumenten Abstimmungen zu Sachentscheidungen verstanden werden (ausführlich hierzu Neumann 2009).
Sicherlich am häufigsten werden in der gesellschaftlichen Diskussion die Begriffe Referendum und Plebiszit verwendet, da sie oberbegrifflich mehrere direktdemokratische Instrumente umfassen. Gerade ein Plebiszit dient in gewisser Hinsicht als Oberbegriff der direktdemokratischen Elemente insgesamt. Das Verfassungsrecht sieht lediglich vor, dass es sich um Abstimmungen über Sachfragen handelt, die das Volk (oder Teile des Volks) direkt entscheidet. Keine Eingrenzung erfolgt im Hinblick auf denjenigen, der die Abstimmung initiiert hat, auf welcher Ebene die Abstimmung erfolgen soll (Bundes-, Landes- oder Kommunalebene) und ob die Entscheidung für das Repräsentativorgan verbindlich ist.
Der Begriff des Referendums wird teilweise synonym zu dem des Plebiszits verwendet, enger meinen Referenden jedoch Sachentscheidungen, die nicht vom Volk initiiert worden sind (dazu gleich unter »Volkseinwand«). Ein obligatorisches Referendum ist im Gesetz ausdrücklich vorgesehen und verpflichtet die staatlichen Gewalten, über bestimmte Sachfragen abstimmen zu lassen (z. B. Art. 118, 29 GG s. o.). Das fakultative Referendum ist auf Landesebene bekannt und bedarf eines gewissen Unterstützungsquorums (z. B. auf Antrag eines Drittels des Landtages kann die Landesregierung eine abgelehnte Gesetzesvorlage zur Volksabstimmung bringen, Art. 60 Abs. 3 LV BW). Beiden Formen ist gemeinsam, dass die Referenden sich auf bereits ausgearbeitete parlamentarische Vorlagen beziehen müssen (Gesetze, Verfassungsänderungen etc.) und bei erfolgreicher Abstimmung durch das Volk verbindlich sind. Ob ein fakultatives Referendum auch durch eine qualifizierte Minderheit der Bevölkerung initiiert werden kann, wurde bisher verneint. Auf Landesebene wurde dieser Vorschlag nun aber durch den Volkseinwand im aktuellen Koalitionsvertrag in Sachsen aufgegriffen, was zu einer Erweiterung des Begriffs führen könnte (dazu Schmidt 2020, 772).
Demgegenüber wird auch ein konsultatives Referendum diskutiert. Hier wird das Volkes durch das Repräsentativorgan zu einer Sachentscheidung befragt, das Ergebnis ist aber nicht bindend. Ob ein konsultatives Referendum durch ein einfaches Gesetz eingeführt werden könnte, wird verfassungsrechtlich kontrovers diskutiert.
Konkret wird es bei den Begriffen der Volksinitiative, der Volksbefragung, des Volksbegehrens und des Volksentscheids, die das Grundgesetz und die Landesverfassungen ausdrücklich als direktdemokratische Instrumente nennen und die auch auf kommunaler Ebene als Bürgerinitiative, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in den jeweiligen Gemeinde-/Kommunalordnungen existieren (
Glossar). Bei einer
Volksinitiative (in manchen Landesverfassungen auch Volksantrag genannt) wendet sich das Volk mit einer konkreten Sachfrage an das Parlament. Erforderlich ist hierbei ein Unterstützungsquorum, das durch eine bestimmte Anzahl an Unterschriften belegt sein muss. Dadurch wird aber »nur« eine Befassungspflicht erreicht, d. h. das Parlament befasst sich zwar mit der Frage, kann sie aber auch verwerfen.
Die Volksbefragung ist letztlich ein konsultatives Referendum, bei dem das wahlberechtigte Volk über eine bestimmte Sachfrage »zu Rate« gezogen wird. Das Repräsentativorgan kann sie als politische Entscheidungshilfe verwenden. Im Grundgesetz ist sie nur in Art. 29 GG vorgesehen.
Das Volksbegehren ähnelt der Volksinitiative, indem eine Sachfrage (zumeist ein konkreter Gesetzesentwurf) dem Parlament zur Entscheidung vorgelegt wird. Das erfolgreiche Volksbegehren ebnet jedoch zugleich den Boden für den Volksentscheid. Der Volksentscheid (teilweise auch Volksabstimmung genannt) ist die direkte Abstimmung des Volkes zu einer bestimmten Sachfrage – dem Parlament wird die Entscheidungsbefugnis demnach entzogen, da es an das Abstimmungsergebnis gebunden ist.
Verfassungsrechtlicher Zielkonflikte direktdemokratischer Elemente
Der Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG sieht »Wahlen und Abstimmungen« für die Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk vor. Während manche Staatsrechtler in der Reihenfolge einen Vorrang der Wahl, also des repräsentativen Systems erkennen, sehen andere eine Gleichrangigkeit von Abstimmungen und Wahlen (vgl. nur Schuler-Harms 2013, 420 f. mit weiteren Nachweisen). Einig ist man sich zunächst, dass direktdemokratische Elemente in Form von Abstimmungen (abgesehen von den Territorialplebisziten) nicht konkret genug im Grundgesetz ausformuliert wurden, als dass sie das repräsentative, parlamentarische System komplett ablösen könnt...